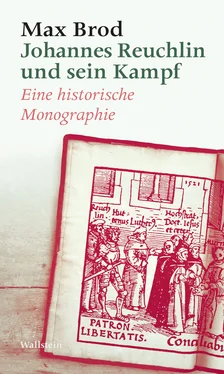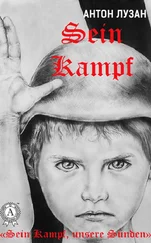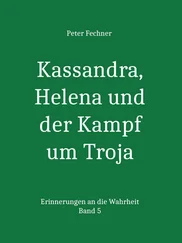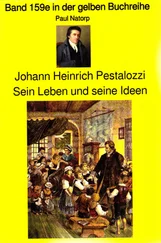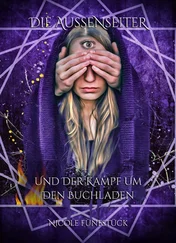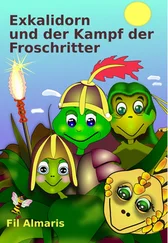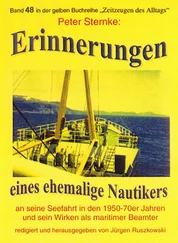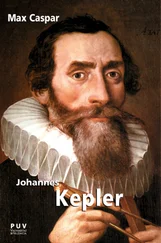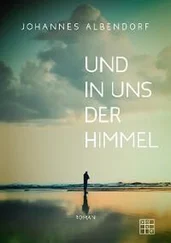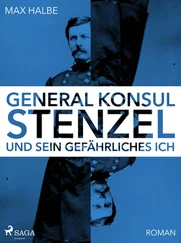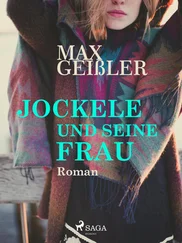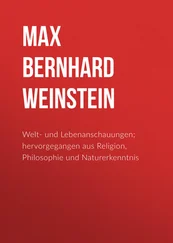In der melodiereichen Jugendnovelle nun bleibt Siena Siena, Kaiser Sigismund als Mittelachse verändert sich gleichermaßen nicht, alles andere aber tritt im antiken Kostüm auf, durchsichtig pseudonym, aus Schlick wird Euryalus, aus der schönen Sienesin eine Lucretia, der betrogene reiche Ehemann bekommt sachgemäß den Namen Menelaos. Bis hierher ist alles (nebst den vielen Zitaten und Anspielungen auf Martial, Vergil und andere Klassiker der Antike) im Rahmen der von den Humanisten geliebten Methode gehalten. Nun aber wird, schon gegen Schluß der Erzählung, ein Bruder des betrogenen Gatten eingeführt, ein Bruder, der »fürchterlich argwöhnisch ist und Lucretia bewacht, als ob er für sie verantwortlich wäre«. Dieser Bruder des Menelaos hat zunächst, als ganz unbedeutende Nebenperson, gar keinen Namen – plötzlich aber heißt er … nun, wie heißt er? Nicht anders als Agamemnon, obwohl er gar nichts Königliches, nichts Zentrales und überhaupt nichts vom ›Hirten der Völker‹ an sich hat. Er ist nur eben der Bruder. Und als Bruder des Menelaos muß er, wenn er überhaupt heißt, Agamemnon heißen. Als ich zu dieser Stelle kam, mußte ich unwillkürlich auflachen. Und mir war, als hätte ich im Augenblick mehr über den Humanismus und die Renaissance erfahren, als wenn ich lange gelehrte Abhandlungen über diese so oft behandelten Ideenrichtungen gelesen hätte. Denn die Karikatur sagt eben oft mehr aus als der beste Spiegel. – Die leise Komik, die sich so mißlich in die humanistische Erneuerung, in eine der edelsten Bewegungen eingemischt hat, deren die Menschheit je fähig gewesen ist, – diese Offenbach-Komik macht in dem zufälligen ›Agamemnon‹ ihren ironischen Knicks. Wir werden auf diesen Seiten solchen Knicksen noch mehr, als uns lieb ist, begegnen.
Was uns hier als Karikatur erscheint, ist nicht bloße Formvollendung, Anpassung an die ›Kunst des Tullius‹ (so nannte man die bewunderte glatte rhetorische ciceronianische Latinität), später an die blutvolleren griechischen Originale – es ist mehr: es ist Verweltlichung im Zeichen der römisch-griechischen Kultur. Warum wurde diese gerade damals erneuert, in einem Schwung sondergleichen, in einer Entdeckerfreude, die ganzen Generationen zuerst in Italien, später in Frankreich, Deutschland, England den Lebensnerv gab? Die einfachste, allerdings nicht die exakteste Antwort auf diese Frage liegt wohl darin: daß man die strenge Zucht einfach nicht länger ertrug, daß das Maß voll, die Uhr abgelaufen war. Die Zucht, in der während des ganzen Mittelalters die Kirche und die christliche Gemeinschaft, auf der Disziplin des altrömischen Imperiums aufgebaut, – eine spirituelle Variante des antiken Kolonialismus –, den Erdkreis der westlichen Welt unterworfen und in vielleicht heilsamer, wenn auch allzu luftloser Ordnung gehalten hatte: diese Zucht war einfach nicht mehr auszuhalten. Man lehnte sich auf.
Man wollte frei sein. Freiheit der körperlichen Triebe, zuerst idyllisch oder ästhetisch oder vornehm-stoisch, dann immer ungehemmter bis zu rasender Wildheit, unbeherrscht bis zu dem, was man mit dem scheußlichen Etikett des ›Renaissancemenschen‹ versieht und was zu so schreckenerregenden Monstren wie Cesare Borgia und seinem Vater-Papst geführt hat. Einem Geschichtsforscher (Willy Andreas), dem ich sonst für viel Belehrung, lichte Darstellung, reiches Datenmaterial u. ä. verbunden bin, entfährt (offenbar unwillkürlich) die Bemerkung: »An die italienischen Tyrannenfiguren des Quattrocento und Cinquecento erinnert keiner dieser deutschen Fürsten. Nirgends die unheimliche Mischung von Verbrechen und Raffinement, die jene so anziehend macht.« – Es steht wirklich »anziehend« da! Verbrechen – und gleich darauf: anziehend. Von einer derartigen Geschichtsbetrachtung mich völlig geschieden zu halten, sehe ich als eine meiner Hauptaufgaben an. Auf mich wirkt ein Verbrechen nie anziehend, immer abstoßend. Ich bekenne mich zu den ›Zehn Geboten‹.
Frei wollte man damals, im Renaissance-Zeitalter, allerdings auch im geistigen Sinn sein – bis zum Machiavellismus oder bis zur Autonomie der forschenden Vernunft, in der Folge bis zur Atombombe und der Sackgasse des heutigen technologischen und politischen Zustandes, in dem, sagen wir es offen, ein ausreichender Ersatz für die Herrschaft der genauen mittelalterlichen Ordnung noch nicht oder nur in schwachen Ansätzen gefunden worden ist. – Ansätze, die allerdings die heilige, ja die einzige Hoffnung der Menschheit bilden. Mögen sie gedeihen und Macht gewinnen, diese heiligen Ansätze, eine Macht, die entgegen dem bekannten Wort nicht mehr böse wäre!
Denn böse war ja auch das Mittelalter, in seiner Art sogar menschenfresserisch böse, ein gleichsam geordnetes Grauen, im Gegensatz zu dem ungeordnet labilen Grauen, das heute unser Schicksal ist. Böse war das Mittelalter, mit seinen Kreuzzügen, seinen Albigenserkriegen, seinem (noch nicht voll entwickelten) Hexenglauben, seinen Scheiterhaufen, seinen Geißelbrüdern, seinem von Aberglauben umgebenen ›schwarzen Tod‹ und ungezählten andern, durch Menschenunsinn gesetzten Ängsten und Toden, die es plagten und mehr als einmal weite Provinzen ausmordend bis in ihre Wurzeln zur Wüste machten. Böse war es, auch wenn wir die Einteilung übernehmen, die Friedrich Heer in seinem wissenden Buch ›Mittelalter‹ in Vorschlag bringt: die Einteilung in eine vergleichsweise heitere ›offene‹ Periode der ersten Jahrhunderte des Mittelalters (›offenes Europa‹ mit seinen beinahe toleranten, bunten, noch nicht durchdogmatisierten Erscheinungsformen) und eine dem Unheil zugänglichere, unfreiere, gleichsam zornigere Zeit, die um 1200 begonnen habe. Damals erlitt das Papsttum (nach Heer) seinen schweren Schock, indem es die Erfahrung machte: »Ganz Südwesteuropa, aber auch West- und Süddeutschland sind von ›Ketzern‹, von religiösen Nonkonformisten, unterwandert, die in einigen Fällen zur Gründung einer Gegenkirche schreiten.«
Die Thesen Heers sind so markant, daß ich sie im Wortlaut hierhersetze, ohne den Versuch, sie umschreiben zu wollen:
»Geschlossenes Europa: Wer die im 13. Jahrhundert mächtig voranschreitenden Prozesse innerer Abschließung und der Gleichschaltung, von gewaltigen und gewalttätigen Unifizierungen, die ja bis heute nicht zu Ende gekommen sind, verstehen will, muß diesen ersten Schock kennenlernen: In der Erfahrung, daß diese eine Christenheit plötzlich von Elementen unterwandert und durchsetzt ist, die religiös, weltanschaulich und bisweilen auch politisch sehr anders denken als die Kirche und ihr Kirchenvolk, setzt jene Kettenreaktion an, die durch innere Kreuzzüge (gegen die ›Ketzer‹), durch die Inquisition, die staatliche und kirchliche Überwachung des Denkens und Glaubens, die Fixierung des kirchlichen Glaubens und des weltlichen Wissens immer weiter getrieben wird.
Der Unbefangenheit, mit der im offenen Europa der andere, der Mensch eines anderen Volkes, Glaubens, Geistes, nicht selten aufgenommen wurde, entspricht die Befangenheit, die große Angst vor dem anderen, die nunmehr in Europa gesteigert und immer wieder neu belebt wird durch neue Schocks, die aber alle mit den Schockerlebnissen des hohen und späten Mittelalters zusammenhängen. Auf den Ketzer-Schock folgt der Türken-Schock. Neben diesen tritt der Schock vor den Hussiten, deren Heere ganz Mitteleuropa durchziehen. Jeanne d’Arc, die Jungfrau von Orléans, wollte gegen die Hussiten ziehen; ihre Feinde in Frankreich und England aber sehen sie selbst als eine Verwandte dieser ›Ketzer‹.«
Es scheint mir allerdings, daß man die Grenzscheide zwischen dem »offenen« und »geschlossenen« Mittelalter besser um etwa 100 Jahre weiter zurück ansetzen sollte: Nicht erst die frevlerische Ausrottung der Albigenser, der provençalischen Hochblüte, einer farbigen Vor-Renaissance unter der kultivierenden Herrschaft der ›Dame‹ und mit dem Stempel des ritterlichen Frauendienstes, der an Platon anknüpfte, wiewohl nur halb-bewußt, gleichsam träumend, – sondern schon vorher bringt der Beginn der Kreuzzüge die schlimme Verwandlung. Die imposant unnachgiebigen, despotischen Figuren der Päpste Gregor VII. und Innocenz III. sind die Merksteine. Unter Gregors VII. Widersacher, dem fränkischen Kaiser Heinrich IV., hatten die Juden in Deutschland noch unangefochten leben, alle Gewerbe ausüben, Grundbesitz erwerben können. Mit den Kreuzzügen begannen die Judenverfolgungen am Rhein, in denen zum erstenmal die große Verdunkelung der Epoche ihren symbolischen (und freilich auch fürchterlich realen) Ausdruck fand. Die Inquisition mit ihrem entsetzlichen Geheimverfahren und ihren entsetzlichen Strafen, Nicht-Christen wie »häretischen« Christen gleichermaßen gefährlich, wurde allerdings erst 1215 durch das Laterankonzil zur bleibenden Institution verfestigt und erwürgte mit zunehmender Intensität alles freie Leben, drückte dem von der Kirche regierten Abendland den Stempel eines grausam totalitären Systems auf.
Читать дальше