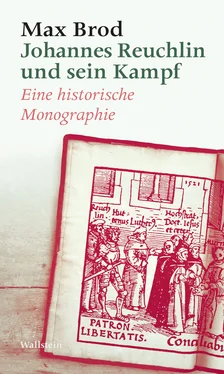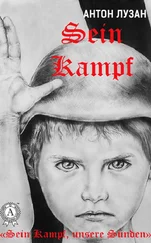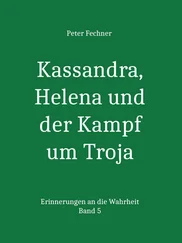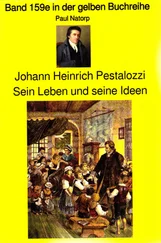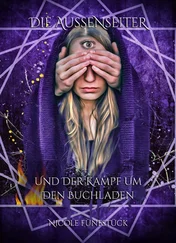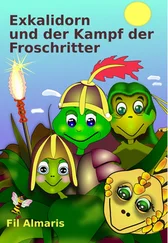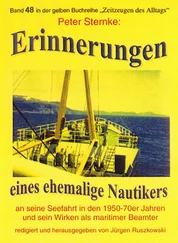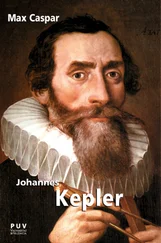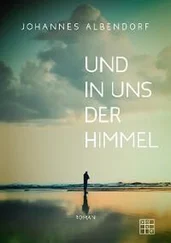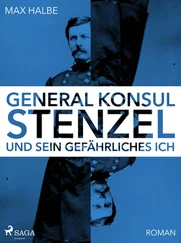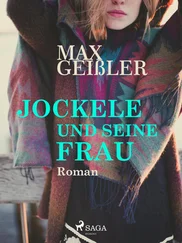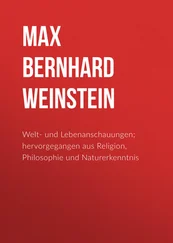Eobanus Hesse dagegen, der Dichter und Humanist aus Mutians Erfurter Kreis (Kampschulte widmet ihm ein blühendes Kapitel in seinem schönen Buch ›Die Universität Erfurt‹, 1858), der frohe Zecher und feurige Kampfgenosse in den Dunkelmänner-Jahren, hatte für die Symbolik des Wappens eine realistische Deutung. Er legte sie in einem Distichon nieder, das ich etwa folgendermaßen übersetzen würde:
Schon durch den Rauch verjagt dein Altar die lästigen Mönche.
Was wird die Flamme tun, bricht sie plötzlich hervor!
Den Abschluß des Unterrichts im Hebräischen erreichte Reuchlin bei Owadja Sforno aus Cesena. Er lernte ihn während seiner dritten Romreise 1498 kennen. – Der Name Owadja oder Obadja (Diener Gottes, arabisch Abdallah) kehrt bei Reuchlin in der lateinischen Form Abdias wieder, und in dieser Gestalt ist ›Abdias‹ der Held einer Dichtung Stifters, einer der schönsten deutschen Erzählungen geworden. Owadja Sforno war Arzt wie Loans, war Kabbalist; die letztere Eigenschaft qualifizierte ihn dazu, von dem großen Historiker Graetz ausgeschimpft und von Geiger zumindest recht kühl behandelt zu werden. Die jüdischen Gelehrten, die im vorigen Jahrhundert in dankenswerter Art die Geschichte ihres Volkes zu erforschen begannen und niederschrieben, waren fast alle eingeschworene Rationalisten, daher Gegner der Kabbala, deren Bedeutung erst in unseren Tagen, vorzüglich durch die Schriften von G. Scholem ans Licht gelangt. Es ist nicht leicht an den Schimpfkanonaden von Graetz vorbeizulesen (dies war, schon als ich meinen »Rëubeni‹ schrieb, meine bittere Aufgabe gewesen) und immer wieder da, wo das Erhabenste, sei es auch manchmal auf recht verworrene Art, sich verkörpert, nichts als »kabbalistischen Schwindel« oder »Abgeschmacktheit« vorgeführt zu bekommen, das liebliche Safed, eine der entzückendsten Stätten Israels, immer wieder als »Kabbalistennest« bezeichnet zu finden usw. – Übrigens spricht auch Reuchlin von seinem zweiten Hebräischlehrer auf den ersten Blick ein wenig zwiespältig, aber wirklich nur auf den ersten Blick. In der Einleitung zu den ›Rudimenta‹ läßt er ihn als jemanden auftreten, »der mich täglich während der ganzen Zeit meiner römischen Gesandtschaft überaus human im Hebräischen unterrichtete, nicht ohne bedeutenden Aufwand an Honorar«. Es verdient aber hier angemerkt zu werden, daß der Ausdruck »non sine insignis mercedis impendio« im Munde Reuchlins nichts Diffamierendes bedeutet. Er verwendet ja einen ähnlichen Ausdruck, um in der gleichen Vorrede die hohen Kosten zu rühmen, mit denen er seinem Bruder Dionysius in Florenz eine wissenschaftliche Ausbildung gewährleistet hat. Melanchthon glaubt freilich, sich aus der Erzählung seines Großoheims erinnern zu können, Sforno habe für jede Stunde einen Golddukaten genommen. Aber mein Freund, der neuhebräische Dichter Sch. Schalom, hat neulich in ländlicher Einsamkeit, in einer halbverschollenen dörflichen Bibliothek ein altes hebräisches Buch entdeckt, das sich als ›Kommentar zur Schrift‹ von Owadja Sforno erwies. Er hatte die Güte, mir einige Seiten aus dem alten Buch abzuschreiben. Ich übersetze aus seinem Zitat:
»Infolge der Lebenshast, Verknechtung und Mühsal und da die Unterdrücker Tag für Tag am Werk sind, wandten sich die Söhne unseres Volkes mit Auge und Sinn zum Gelderwerb, was ja menschlich ist und was ihnen einzig Obdach und Zuflucht vor den Sturmfluten der Zeitgenossen gewährt. Sie drehen sich wie die Bienen, bis ihnen jeder Begriff von Raum und Zeit entschwindet, und die Wunder unserer Lehre sehen sie nicht mehr. Sie wurden wie die Träumenden mitten unter den Völkern, die sich an sie herandrängten, und sie fragten sich: ›Was gibt uns unsere heilige Lehre, wenn sie sich nur auf die Materie bezieht und keine Hoffnung auf das ewige Leben enthält, und was für einen Sinn haben die vielen Erzählungen der Schrift, deren Zeitfolge unklar ist, die das Frühere später und das Spätere früher bringen?‹ – Als Antwort kommt von den Zehntausenden der Heiligen und vom Rest der Schriftkenner eine unklare Darstellung der Urlehre und manchmal ein ungenügender Bescheid, der die Zweifel nicht behebt; was uns zur Schande gereicht. – Und wie wollen wir uns rechtfertigen, wenn Gott sich erhebt und um der Ehre seines Namens willen Rechenschaft fordert? Das können wir nur, wenn wir auf die Wunder seiner Lehre hinweisen, die in ihrer Darstellung und Ordnung die Augen jedes Eingeweihten erleuchten und die im Aufbau und in der Vollendung der Bücher die Gerechtigkeit und Größe des Ewigen zeigen. Er gibt nach vollkommener Verzweiflung das Heil, denn er hat für immer seinen Bund geschlossen, der in reinen Aussagen zu verstehen und zu weisen ist – und, der auf den Grundlagen der Kontemplation und der tätigen Durchführung ruht. Wie der Ewige, er sei gesegnet, selbst bezeugt hat, indem er sprach: ›Und die Lehre und die Gesetze, die ich geschrieben habe, sie zu lehren.‹ Und damit hat er seine Absicht für die ganze Schöpfung bekanntgegeben. Das Ziel der Kontemplation liegt ja darin, diese Seite der Größe des heiligen Gottes zu erfassen und zu wissen. Hieraus entsteht für jeden Geistigen die Ehrfurcht vor Gott. Und aus der Erkenntnis der Wege seiner Güte und Gnade, die er vor allem dem Menschengeschlecht bezeugt, entsteht die Liebe zu Gott, sobald man sich klarmacht, daß Gott in den Zeitaltern der Welt stets darum bemüht war, den Menschen zu erheben und das zu verbessern, was der Mensch verdorben hat. So wird jeder Eingeweihte dazu gelangen, den Willen Gottes zu seinem eigenen Willen zu machen. Und auf jenen beiden, der Kontemplation und der tätigen Ausführung, ist der ganze tatsächliche Anteil unseres Tuns an der Weltgeschichte aufgebaut.«
Das sind herzlich liebenswerte Sätze. Sie könnten auch von Pico verfaßt sein. Sie lagen im Geist der Kabbala, und überhaupt im Geist jener Zeit, die besser war als die unsere.
Vielleicht also war dieser Rabbi Sforno doch nicht so unwürdig, mit dem großen Humanisten Reuchlin, sei es zunächst auch nur auf philologischer Grundlage, aber wahrscheinlich auch darüber hinaus in manchem religiösen Disput Umgang zu pflegen. Vielleicht hat auch er einige Züge zur Figur des großen edlen Juden Simon beigesteuert, die Reuchlins Meisterwerk darstellt und die bis heute eigentlich unbekannt geblieben ist, während Shakespeares ›schlechter‹ Jude, Shylock, erbarmenswert, doch auch ein Gegenstand gerechter Verachtung und des Spottes, fast allein die Bühne und mit ihr die weiteste Öffentlichkeit beherrscht.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.