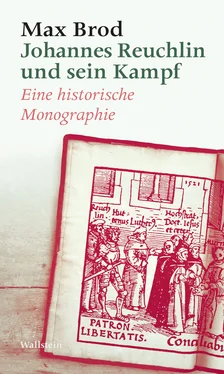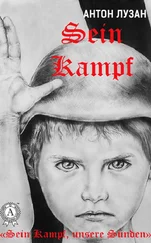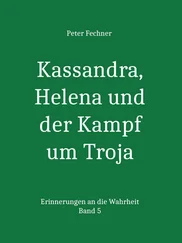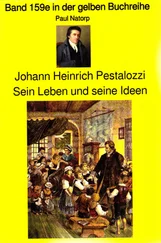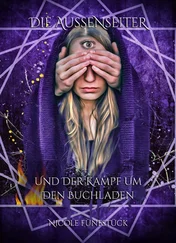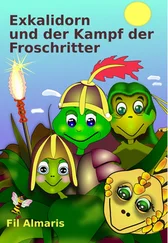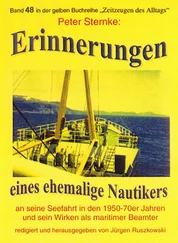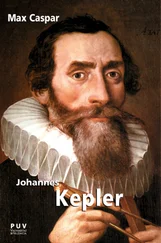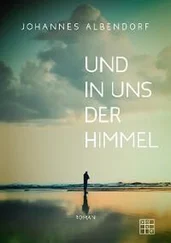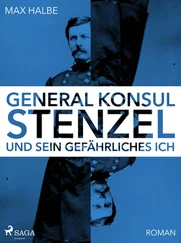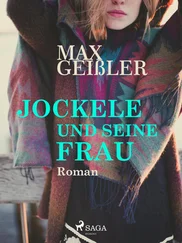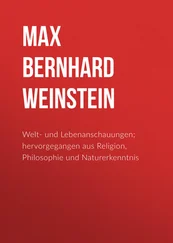Alle diese (unrichtigen) Sätze kehren bei Reuchlin wieder, zum Teil in aller Breite ausgeführt. So vor allem in ›De arte cabalistica‹ gegen den Schluß des 1. Teiles, wo Reuchlin ganz hanebüchen verkündet, der Messias werde vom Talmud nur als körperlicher Befreier aufgefaßt und beziehe sich auf den Sieg des Israelheeres (»ad Israelitici exercitus victoriam referre«). Wie falsch diese Gegeneinanderstellung ist, mag man aus der vortrefflichen Anthologie ersehen, in der Moritz Zobel unter dem Titel ›Gottes Gesalbter‹ alle auf den Messias bezüglichen Stellen des klassischen jüdischen Schrifttums (Bibel, Talmud und Midrasch) zusammengestellt hat, ohne kabbalistische Quellen zu benützen. Auch im Talmud wird durchaus nicht nur der politischen, den Staat wiederherstellenden Tätigkeiten des Messias gedacht. Sie werden nicht in den Hintergrund gestellt, aber neben der weltlichen Seite der Erlösung, der Einsammlung der Zerstreuten, der neuen Souveränität, wie wir sie zu unserem höchsten Glück gerade in unseren Tagen zu erleben gewürdigt worden sind, steht der ›himmlische‹ Aspekt (auf den wir allerdings noch warten), die geistige Erhebung und Verklärung des ganzen Volkes, ja der gesamten Menschheit und sogar des Kosmos in der messianischen Endzeit. Leidenschaftliche Bilder bei Jesaja z. B. 30, 26: »Das Licht des Mondes wird dem Licht der Sonne gleichen, und das Licht der Sonne wird siebenfach sein« wechseln mit Schilderungen seelischen Aufstiegs. »Die Sünde schwindet aus Israel«, faßt Zobel zusammen und belegt das mit vielen Prophetenzitaten, so aus Hoschea 3, 8: »Danach kehren die Kinder Israels um, suchen den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, und wenden sich bebend hin zu Gott und seinem Heil am Ende der Tage.« Oder nach Zefanjah: »Der Rest Israels meidet jedes Unrecht und kennt nicht Lug und Trug.« Oder Joel 3. Kap.: »Da alle Glieder des Volkes vom göttlichen Geiste beseelt sind, wird ihnen insgesamt die Gabe der Prophetie zuteil.« »Das Land ist voll von Gotteserkenntnis wie das Meer voll von Wasser« (bei einigen Propheten). Die Großmächte Assyrien und Ägypten, symbolisch für die ganze Menschheit gesagt, verbinden sich mit Israel zur gemeinsamen Verehrung des wahren Gottes. Der Ewige spricht (Jesaja 19, 24 f.): »Gesegnet sei mein Volk Mizrajim (Ägypten) und das Werk meiner Hände Aschur und mein Erbbesitz Jissrael.« – Dies ist das wahre Bild der messianischen Tage, wie es als letztes Ziel von nicht-kabbalistischen wie von kabbalistischen Schriften ohne Unterschied gezeichnet wird. Gerade das Auseinanderklaffen in eine politische und in eine spirituale Erlösung ist ein dem Judentum fremder Gedanke. Wenn der Erlösung entweder der spirituale oder der staatsbildende Bestandteil fehlte, so wäre sie unvollendet, unmessianisch. Es gibt natürlich unter den fast 200 Weisen des Talmud, die Zobel zu Wort kommen läßt, auch einzelne, die sich zu extremen Formulierungen in der einen oder andern Richtung versteigen. Der Hang zum Extrem gehört nun einmal zum Charakterbild der jüdischen Seele. Doch die Stimmen derer, die sich die irdische Art der Erlösung oder Vervollkommnung (Apokatastasis) ohne ihr spirituales Gegenbild nicht vorstellen mochten, überwiegen. Der Gegensatz von irdischer und himmlischer, volklicher und universal-kosmischer Erlösung ist also von Pico und Reuchlin zu Unrecht ins Judentum projiziert, um für die von ihnen postulierte Höherstufigkeit der Kabbala, resp. des Christentums Raum zu schaffen. In ähnlicher Weise polemisieren heute noch die vereinzelten Juden, die den Zionismus ablehnen, gegen die angebliche Nur-Weltlichkeit der zionistischen Konzeption, gegen eine fingierte Ideologie, die am besten von Schalom Ben-Chorins Buch ›Die Antwort des Jona‹, von den Gedichten Sch. Schaloms und von Bubers ganzem Wirken und Schaffen widerlegt wird. Ich könnte an dieser Stelle noch viele andere Namen in Israel nennen; auch mich. – Die Verwirklichung der messianischen Konzeption ist freilich noch äußerst mangelhaft, ja fast nur punktuell, also sozusagen gar nicht vorhanden, – an der Konzeption selbst aber (und diese ist es, die uns einige an dieser Stelle der Untersuchung bemäkeln) fehlt es weder in unserem alten, noch im neueren Schrifttum. Dies – und nur dies – habe ich an dieser Stelle gegen die Fehlkonstruktion Picos, die Reuchlin nicht ohne Behagen ausgebaut hat, erinnern zu müssen geglaubt.
Man hat in letzter Zeit versucht, den Einfluß, den Pico auf Reuchlin gehabt hat, als geringer, dafür den Einfluß des Nikolaus von Cues (Cusanus), der ja allerdings der philosophisch weitaus wichtigste von den dreien ist, als entscheidender hinzustellen. Zu der Sprachphilosophie Picos, die bei Reuchlin wiederkehrt, d. h. zur Beziehung zwischen Namen und Gegenstand, gibt es allerdings Parallelstellen beim Cusaner z. B. in der Schrift ›Idiota de mente‹ (›Der Laie über den Geist‹) Kap. III: »Gott ist eines jeden Dinges Genauigkeit. Wenn man daher von einem einzigen Gegenstand ein genaues Wissen besäße, hätte man notwendig ein Wissen von allen Dingen. Wüßte man den genauen Namen eines einzigen Dinges, so wüßte man auch aller Dinge Namen; Genauigkeit gibt es nur in Gott. Wer also einmal eine einzige Genauigkeit erreichte, der würde Gott erreichen, der die Wirklichkeit alles Wißbaren ist.« (Vgl. die lichtvoll schöne Einführung zu diesem Buch von Hildegund Menzel-Rogner, Hamburg 1949). Doch die reine Sicht Platons, aus der der Cusaner den Sachverhalt sieht, ist wohl dem Pico wie dem Reuchlin nicht zugänglich. Was als Verbindungsgut zwischen Pico und Nikolaus von Cues übrig bleibt, gehört der allgemeinen Zeitanschauung an. – Soweit ich sehen kann, wird der Cusaner und seine Hauptlehre, die coincidentia oppositorum (das Zusammenfallen der Gegensätze), von Reuchlin nur ein einziges Mal zitiert, und zwar in ›De arte cabalistica‹, XXI a (Hagenau 1517), wo von ihm als »Germanorum philosophissimus archiflamen dialis« die Rede ist. Der Kardinal und Bischof von Brixen als ›Oberpriester Jupiters‹, eine echt humanistische Floskel! (Den Hinweis auf dieses Zitat verdanke ich dem überragenden Buch von Gershom Scholem ›Ursprung und Anfänge der Kabbala‹.) Über ein zweites Zitat (ohne Namensnennung) später, im Heidelberger Kapitel.
Daß die Form des Dreigesprächs, die Reuchlin in seinen Hauptwerken verwendet, einen Beweis für seine Abhängigkeit von dem Cusaner abgeben soll, der diese Form gleichfalls liebte, scheint mir unrichtig. Ein Dreigespräch ist schon die christliche, von äußerster Urbanität durchwehte Streitschrift des römischen Advokaten Minutius Felix aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Und schon in einigen der platonischen Dialoge findet sich die Konstellation von drei Unterrednern (z. B. im ›Timaios‹, im ›Hippias minor‹). –
Auch beim ironischen Abwehren banausischer Feinde folgt Reuchlin fast wörtlich dem Grafen. In der schönsten Abhandlung, die Pico geschrieben hat, im Buch ›Über die Würde des Menschen‹ lesen wir: »Schon beim Hören des Wortes Kabbala schien meine Gegner ein Entsetzen zu überschleichen. Unter der Kabbala stellten sie sich nicht Menschen, sondern Zaubertiere, Kentauren oder irgendwelche Wunderwesen vor. Eine amüsante Episode. Einer der Gegner wurde gefragt, wer denn eigentlich Kabbala sei. Er antwortete: ›Das war ein abtrünniger Wicht und ein dämonischer Gesell, der Verfasser vieler Schriften gegen Christen‹. Kann irgend jemand, der diese Auskunft hört, das Lachen unterdrücken?« – Dazu Reuchlin im ›Augenspiegel‹, XII b: »Cabala / dar wider aber die maister der hailigen schrift vil redten und schriben / wie wol sie grüntlich nit wißten was doch Cabala für ain tiere were.« Der Scherz scheint Reuchlin besonders gut gefallen zu haben, denn in der ›Kabbalistischen Kunst‹ kommt er nochmals, und zwar fast wörtlich, auf das Bonmot Picos zurück: »Falso asseruerunt, Cabalam fuisse hominem diabolicum et haereticum, unde Cabalistas haereticos esse omnes. Abstinete obsecro si potestis a risu.« (»Fälschlich behaupten sie, Kabbala sei ein teuflischer und ketzerischer Mensch gewesen, daher seien alle Kabbalisten Ketzer. Bitte haltet euch, wenn ihr könnt, vom Lachen zurück.«)
Читать дальше