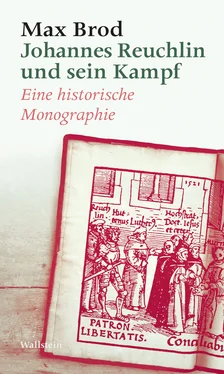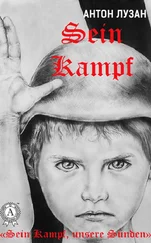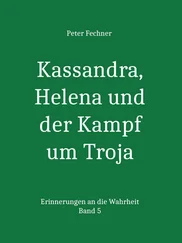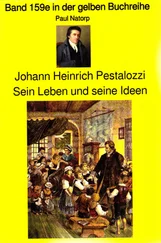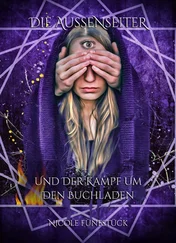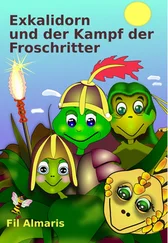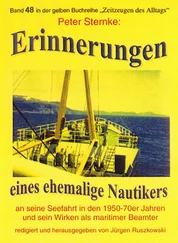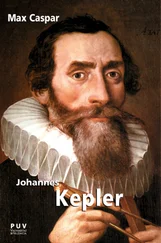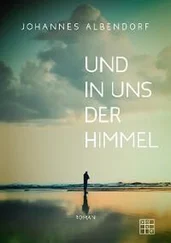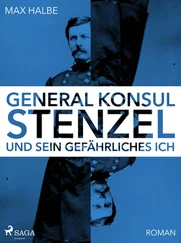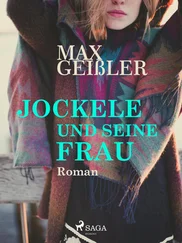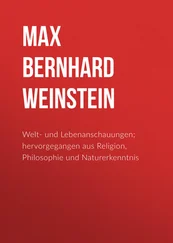Daß Rabbi Margolith nicht ganz Unrecht mit seiner Vorsicht hatte, auch wenn sie diesmal sich gegen den Unrichtigen kehrte und wehrte: das beweist der tragische Vorfall in seiner Familie. Sein Sohn (nach Selma Stern »Enkel des Talmudgelehrten Jacob Margolis aus Nürnberg, Sohn des Regensburger Rabbiners Samuel« – laut Geiger ›Briefwechsel‹ liegt die Gefahr vor, den Nürnberger mit dem Regensburger zu verwechseln. Ich kenne mich, offen gesagt, in diesen Familienverhältnissen nicht aus) sein Sohn oder Enkel also konvertierte. Hier ist der Ort, zwischen zwei Arten von Apostaten scharf zu unterscheiden: den nicht-aggressiven (wie den oben erwähnten Paulus Riccius), die nichts Besonderes tun, als daß sie einen mehrere tausend Jahre alten Geschichtszusammenhang verraten, und den Hetz-Apostaten, die gewissermaßen nach dem unausgesprochenen Grundsatz handeln: »Bin ich abtrünnig geworden, so sollen auch alle andern Juden von Volk oder Glauben oder von beiden abfallen.« Ganz ähnliche Figuren habe ich unter den Assimilanten aller Abarten kennengelernt, mit denen ich mein Leben lang im Kampfe gelegen habe. Es gibt auch da die harmlosen und jene, denen gleichsam das ungeschriebene Schlagwort vorschwebt: »Habe ich mich assimiliert, – zumindest glaube ich, daß das geschehen ist – so sollt und müßt auch ihr alle euch assimilieren, alle, alle. Jeder an sein Wirtsvolk. Keiner darf zurückbleiben. Früher werde ich mich nicht zufriedengeben.« (Ich werde später auf diese clownesk-traurige Menschenart noch zu sprechen kommen.) – Der Enkel also des berühmten Gelehrten nannte sich nach seiner Taufe Antonius Margaritha (was dasselbe bedeutet wie das hebräische Margalith, nämlich Perle), wurde Lektor der hebräischen Sprache und veröffentlichte ein von Verleumdungen strotzendes, dabei boshaft-geschicktes, mit manchen jüdischen Kenntnissen aus seiner frommen Jugend wahrheitsverdrehend auftrumpfendes Angriffsbuch. Trotz offenbarer Fehler machte es Eindruck, namentlich auf Kaiser Karl V., der zunächst die Beschuldigungen glaubte und in Zorn geriet, da er knapp zuvor in Innsbruck »Josels Verteidigungsrede zugunsten seines Volkes angehört, um nun von einem gelehrten Täufling die Beweise zu erhalten, daß sie (die Juden) in ihrer Synagoge Christus und den Kaiser selbst verfluchten und die Christen dem Judentum zu gewinnen versuchten«. Im Jahre 1530, also acht Jahre nach Reuchlins Tod, schien der Erzfeind Pfefferkorn wiederauferstanden. »Für die Juden war der Lektor der hebräischen Sprache ein gefährlicherer Feind als der ungebildete Metzger Pfefferkorn«, heißt es in dem Buch, das die lebendigste und wissensreichste Schilderung des Judenelends jener Jahre, zur Zeit Reuchlins und bald nachher, bringt, in ›Josel von Rosheim‹ von Selma Stern. Und weiter, ebenda: »Margaritha hatte sich der Mühe unterzogen, die sämtlichen jüdischen Gebete in die deutsche Sprache zu übersetzen, um aus ihnen zu beweisen, daß die Juden an jedem Tag des Jahres, am Morgen, am Nachmittag und am Abend, besonders aber an ihrem Versöhnungstag Gott anflehten, er möge das römische Kaisertum auswurzeln, alle christlichen Obrigkeiten und alle Königreiche vernichten und der ›Christen Blut an die Wand spritzen‹. ›O christlicher Leser, du mußt das merken, daß, wo die Juden um Rache bitten und fluchen über Edomiter, Esau, Seir, meinen sie allemal alle Obrigkeit samt den Untertanen des römischen Reichs … Sie haben Gebete, besonders das Alenugebet, in dem sie wagen, Christus selbst zu verfluchen. Wenn sie beten, sie (die Christen) knien und bücken sich vor einer Torheit und anbeten einen Gott, der nicht helfen kann, so beten sie hier klärlich wider Christus und die Christen. Denn unter Torheit und Eitelkeit verstehen sie Jesus, weil diese Worte dem Zahlenwert seines Namens entsprechen.‹ Am Schluß seiner Abhandlung bittet Margaritha die Regierungen, den Juden, die er des Diebstahls, des Wuchers, der Münzvergehen und anderer Laster bezichtigt, die Geldleihe zu verbieten und ihnen weder Schutz noch Rechtsbeistand zu gewähren.«
Die dramatisch erregte Darstellung der vor dem Kaiser abgehaltenen Disputation zwischen Margaritha und dem ›Befehlshaber der Judenschaft im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation‹ (das war eine Zeitlang der Titel, den Josel von Rosheim führte) sowie des Rosheimschen Sieges gehört zu den aufwühlendsten Partien historischer Prosa, die ich je gelesen habe.
Wir sind nicht allzu weit von unserem Thema abgekommen. Denn der Mann, bei dem Reuchlin endlich seine Sehnsucht nach guter systematischer Unterweisung im Hebräischen stillen konnte, der Leibarzt des Kaisers Friedrich III., Jakob ben Jechiel Loans, aus Mantua oder Ferrara, wie Reuchlin selbst berichtet, war vermutlich ein Verwandter jenes Josel (oder besser: Jossel oder Josef) von Rosheim, der in dunkelsten Tagen wiederholt auf mannhafte und kluge Art den Schutz seiner Stammesgenossen durchsetzte. Dieser »erste Sozialkritiker und Sozialreformer der deutschen Juden«, wie S. Stern ihn nennt, stammte aus einer Familie, die, einer alten Tradition zufolge, aus Frankreich in Deutschland eingewandert war – und zwar, wie ich dem oben genannten Buch dieser Autorin entnehme, aus dem Orte Louhans. (Louhans findet sich als Arondissementshauptstadt des französischen Departements Saône-et-Loire an der Lyoner Bahn.) »Er selbst unterzeichnete sich einmal auf einer Versammlung jüdischer Delegierter, in einer hebräischen Unterschrift, als Joseph ben Gerschom aus der Familie Louans«. – »Es lag daher nahe«, fährt Selma Stern fort, »Josele in verwandtschaftliche Beziehung zu Jakob Jechiel Loans zu bringen, nicht nur des gemeinsamen Namens wegen, sondern auch wegen mancher gemeinsamer Charakterzüge und der hervorragenden und privilegierten Stellung, durch die beide ihre Glaubensgenossen weit überragten.«
Wiewohl nun zweifellos Reuchlin der Bahnbrecher für das Studium der hebräischen Sprache und der Kabbala in Deutschland wurde, muß doch hervorgehoben werden, daß Reuchlin selbst und Loans bei Reuchlin Vorgänger hatten. Reuchlins Vorgänger in den deutschen Bemühungen um die ›heilige Sprache‹ sind die schon genannten Tübinger Theologen, dann der Humanist Agricola, ferner Conrad Pellikan, der Freund Zwinglis, dem die Priorität gebührt, eine kleine hebräische Grammatik nebst einem Wörterbuch zum eigenen Privatgebrauch (allerdings sehr mangelhaft, wie Geiger ausführt) zusammengestellt zu haben. Dieses Werk Pellikans zirkulierte in vielen Abschriften bei seinen Freunden. Dies alles gehört zum Charakterbild der Renaissance. – Das nach der scholastischen Erstarrung neu erwachte wissenschaftliche Interesse für die Ursprache des ›Alten Testaments‹ gab es da und dort, – unter dem Einfluß der ›modernen‹ humanistischen Tendenzen, die den Ruf ›ad fontes‹ (›zu den Quellen‹), wenn auch zunächst nur theoretisch, erhoben; so etwa besaß der Bischof von Worms, Johann von Dalburg, in seiner reich ausgestatteten Bibliothek, die Reuchlin rühmt, auch viele ›hebraica volumina‹, hebräische Bände. – Reuchlin aber war der erste, der dieses ad fontes, was das Hebräische anlangt, ganz ernst nahm, – indes der gefeierte Erasmus sich auf das Griechische (das Neue Testament) begrenzte. »Die Kabbala und der Talmud, was immer das sein möge, haben mir nie zugelächelt«, erklärte Erasmus dezidiert in einem Brief an Albrecht v. Brandenburg. (»Cabala et Talmud quicquid hoc est meo animo nunquam arrisit.«) Es gibt noch andere Sätze des Erasmus, in denen er sich geradezu rühmt, nicht mehr als die Anfangsgründe des Hebräischen zu verstehen.
Reuchlins autodidaktische Bemühungen um Erlernung der hebräischen Sprache sind oben erwähnt. Seit der Zeit, da Geiger seine Reuchlin-Forschungen veröffentlicht hat, ist (wie ich dem gelehrten Essay von Prof. Hans Rupprich in F. 2 entnehme) eine in München befindliche Handschrift zum Vorschein gekommen, die beweist, daß Reuchlin 1486 einen Juden namens Calman zum Lehrer im Hebräischen hatte, der ihm gegen Entlohnung das Wörterbuch des Menachem ben Saruk (aus Tortosa) abschrieb.
Читать дальше