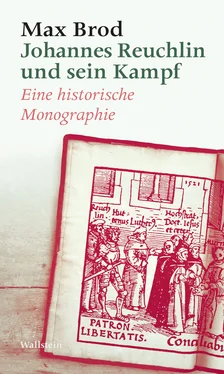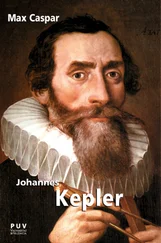Graf Eberhard entsandte Reuchlin in einigen Fällen als seinen Repräsentanten (mit anderen vornehmen Herren) zu bedeutenden Staatsakten, so 1486 zum Reichstag nach Frankfurt, wo Maximilian von den Kurfürsten zum ›römischen König‹ gewählt wurde. Noch zu Lebzeiten seines Vaters, des Kaisers Friedrich III. Im Anschluß an dieses Ereignis war Reuchlin unter denen, die den neugewählten König und präsumptiven Thronfolger zur Krönung nach Aachen begleiteten. – 1490 folgte Reuchlins zweite Italienreise, die ihn (wahrscheinlich in Begleitung eines natürlichen Sohnes Eberhards, eines begabten jungen Mannes, der in Italien studierte) fast ein volles Jahr in Florenz und Rom festhielt. Hier erneuerte er die in Frankfurt geschlossene Freundschaft mit Hermolaus Barbarus, dem Gelehrten und venezianischen Gesandten, der Maximilian im Namen seiner Vaterstadt festlich begrüßt hatte, ohne zu ahnen, daß später eine der hartnäckigsten, allerdings auch erfolglosesten kriegerischen Unternehmungen des jungen Kaisers gegen eben dieses Venedig gerichtet sein würde. – In Rom traf er den fleißigen Herausgeber von Handschriften antiker Werke, eben jenen Hermolaus, als Gesandten beim Papst. Reuchlin bildete sich bei Hermolaus zum vollkommenen Lateiner – und Hermolaus erteilte ihm gewissermaßen den höchsten Humanistenorden, er gab ihm den neuen, griechisch tönenden Namen. »Da der fremdartige Klang seines Namens die Ohren der Gebildeten (eruditorum aures) verletzte, hieß ihn Hermolaus den Namen Capnio tragen. Willig folgte Capnio der Autorität eines so großen Mannes« – heißt es in einem zeitgenössischen Bericht. »Tanti viri auctoritatem libenter est secutus Capnio.«
So hoch stand damals in den Augen der Welt der berühmte venezianische Gesandte über dem bescheidenen deutschen Hofbeamten und Humanistenjünger, der seinen eigentlichen Weg noch nicht gefunden hatte. Die beiden waren etwa gleichaltrig.
Doch gerade während der zweiten italienischen Reise sollte der Schwerpunkt sich verrücken. Zwei große Erlebnisse änderten die Blickrichtung Reuchlins. Er traf mit dem gedanklich revolutionären jungen Grafen Pico von Mirandola zusammen, der sich, sei es auch in unvollkommener, recht phantasiereicher Art, einen gewissen Schatz von Kenntnissen in der hebräischen Sprache und der Kabbala angeeignet hatte (1490). Und zwei Jahre später begann Reuchlin, anläßlich einer Gesandtschaft in Linz, wo damals vorübergehend Kaiser Friedrich III. residierte, sein gründliches Studium des Hebräischen. Bei Friedrichs Leibarzt Jakob ben Jechiel Loans. – Es war eines der tragischesten Jahre der jüdischen Leidensgeschichte oder Diaspora, das Jahr, in dem die Juden Spaniens vertrieben, aus einer hochentwickelten, jahrhundertealten Symbiose massenhaft in Tod und Elend gestoßen wurden. Seltsames Zusammentreffen: In dem gleichen Jahr fuhr Christoph Kolumbus (laut Madariaga vermutlich jüdischer Abstammung) aus, um den spanischen Majestäten den Weg nach Zipangu (Japan) und Indien zu finden; in Wirklichkeit entdeckte er einen neuen Kontinent, der dann in viel späteren Zeiten einer jüdischen Masseneinwanderung eine neue Zufluchtsstätte und verhältnismäßig ruhige Heimat darbieten sollte. Und in dem gleichen Jahr lernte zum erstenmal ein deutscher Gelehrter systematisch und gründlich das Hebräische, – auch er ein Entdecker eines ungeahnten Kontinents, eines geistigen Erbbesitzes von unübersehbaren Ausmaßen.
Aus der Zeit zwischen den beiden italienischen Reisen gibt es interessante Briefe Reuchlins an Jakob Louber, den Prior der Dominikanerkartause in Basel. Reuchlin übersendet dem »reverendo et egregio patri, domino suo, doctori Jacobo Louber, priori Carthusiae Basiliensis« die von ihm selbst verfaßte, handschriftliche Übersetzung einer Schrift des Bischofs Proclus aus frühchristlicher Zeit. Dieser sowie ein zweiter in vertrautem Tone gehaltener Brief (sei es auch mit den dem Zeitgeist entsprechenden Schnörkeln humanistischer Höflichkeit) beweist deutlich, daß Reuchlin bis zu dem großen, durch den rasenden Konvertiten Pfefferkorn verursachten Zusammenstoß mit den Predigermönchen (Dominikanern) in bestem Einvernehmen mit diesen Ordensbrüdern stand. Die Neigung zu ihnen hatte er wohl von seinem Vater übernommen, der ja in ihren Diensten gelebt hatte. In der Folgezeit, bis zu dem erwähnten Zusammenstoß, hat Reuchlin ihnen als Anwalt ihre Rechtsangelegenheiten geführt, und zwar nie entgeltlich, stets nur um Gotteslohn. – In dem zweiten Brief (gleichfalls 1488) erbittet Reuchlin, Louber möge ihm eine Handschrift aus den Bücherschätzen des Dominikanerklosters leihen, ein Neues Testament im griechischen Original, und zwar auf Lebenszeit, er brauche es. Das für Reuchlin so charakteristische Mißtrauen gegen Übersetzungen (sogar gegen die kirchlich approbierte lateinische Vulgata) findet plastischen Ausdruck in den Briefworten: »Die Ursprache jedes Werkes ist süß; und Wein, der mehrmals aus einem Fasse in ein anderes gegossen wird, verliert an Vortrefflichkeit.« »Wenn du meine Bitte erfüllst«, heißt es weiter mit Humanistenpathos, »so hast du mir ein Königreich oder dem Halbtoten das Leben geschenkt.« Dem mit so viel Leidenschaft vorgebrachten Anliegen konnten die Mönche nicht widerstehen. Obwohl der Band eigentlich nicht verliehen werden durfte, dem testamentarischen Willen des Spenders gemäß (eines dalmatinischen Kardinals, der den einem sehr frühen Jahrhundert entstammenden Kodex aus Ragusa zum Konzil nach Basel mitgebracht hatte). Man beschloß, Reuchlin die Handschrift zu leihen, – die denn auch wirklich erst nach seinem Tod in den Besitz des Klosters zurückgekommen ist. In dem Brief, mit dem das Kloster dem Gelehrten die kostbare, auch bibliophil bemerkenswerte Leihgabe übermittelt, heißt es: der Konvent wolle lieber auf die Handschrift als auf Reuchlins Zuneigung verzichten. Und diese ausgesucht höfliche, menschenfreundliche Zuschrift ist vom Ordensprovinzial der Dominikaner, F. Jacobus Sprenger, unterzeichnet. (Preisendanz in F. 2, ferner in den ›Reden und Ansprachen im Reuchlinjahr 1955‹, – sowie ›Briefwechsel‹.)
Man erschrickt. Ist das derselbe Sprenger? Der freilich auch die Gründung der ersten Rosenkranzbruderschaft in Deutschland angeregt hat, dieses lieblichen Dienstes, den Dürers freundlich-festliches Bild im Strahover Stift zu Prag verherrlicht? – Ja, es ist derselbe. Sprenger, der Verfasser des ›Hexenhammers‹, eines der blutigsten entsetzenerregendsten Bücher aller Zeiten. Derselbe Papst Innocenz VIII., der 1486 Picos gutgemeinten, wenn auch leicht chimärischen Weltkongreß der Philosophen in Rom untersagt hatte, autorisierte ein Jahr später dieses fürchterliche Konkokt des Hasses und des Wahnsinns.
Wir können die Gegensätzlichkeiten in Reuchlins Seele, die nie völlig ausgeglichen wurden, sowie den Übergang aus einer immer noch stark vom Mittelalter geprägten Umgebung in das geistige Klima einer Menschlichkeit, wie es in Milde rund um den Grafen von Mirandola und Jakob Loans sich ausbreitete, nicht besser andeuten, als indem wir einen Augenblick bei Sprenger und seinem Hexenglauben verweilen. Das mag auch als Ergänzung zu den Zeitbildern unseres 1. Kapitels verstanden werden. Ich zitiere wieder das verläßliche Werk von Willy Andreas ›Deutschland vor der Reformation‹:
»Zwei Dominikaner waren es, die theoretisch und praktisch gleich unheilvoll und richtunggebend eingriffen, zunächst in Oberdeutschland, dann aber auch über diesen Bereich hinaus. Sie luden damit viel der Schuld, daß diese wahnwitzige Ausschreitung sich weiter einbürgerte, auf ihr Haupt. Es war der hemmungslose und verfolgungswütige Heinrich Krämer, genannt Institoris, der von einer pathologischen Leidenschaft für die Sache ergriffen war, und der Theologieprofessor Jakob Sprenger, der etwas hinter seinem Ordensbruder zurücksteht. Aber er war es, der von Kaiser Maximilian das Patent erwirkte, das die Tätigkeit der zwei Inquisitoren förderte. Diese beiden sind die Verfasser des sogenannten Hexenhammers, des Malleus maleficarum, worin die wichtigsten Lehrmeinungen der Scholastik in Hinblick auf das peinliche Verfahren zusammengestellt waren und der Satz ausgesprochen wurde, daß es Ketzerei sei, zu behaupten, es gäbe keine Hexen. Dies Buch brachte den Hexenwahn, indem es alle auf diesem Gebiet denkbaren, vorgestellten und eingebildeten Verbrechen genau bis ins einzelne festlegte, in ein förmliches literarisches System, und schuf damit auch von dieser Seite her eine Grundlage für die Praxis der Verfolgungen. Die Ansichten über die Arten der Hexerei wurden damit sozusagen planmäßig zusammengefaßt, und so ging denn auch von diesem durch und durch ungesunden Werk eine verheerende Wirkung aus; denn nun hatte der Unsinn Methode gewonnen. Die ohnehin schon im Fortschreiten begriffene Bewegung erfuhr erneut eine Stärkung. Vorausgegangen war die Bulle Innocenz’ VIII., die, beginnend mit den Worten ›Summis desiderantes‹ unter Aufzählung vieler Schändlichkeiten den Glauben an Hexen und ihre fleischlichen Bündnisse mit dem Satan im vollen Umfang bejahte. Eine der verhängnisvollsten Auslassungen des Heiligen Stuhls! – Von den Verfassern des Hexenhammers erbeten und in ihr Buch aufgenommen, um freie Bahn zu gewinnen, gab diese Bulle den um sich greifenden Hexenprozessen durch den Stempel der höchsten kirchlichen Stelle autoritativen Halt; ausdrücklich bestätigte sie die Befugnisse der beiden Dominikaner, aufs schärfste gegen die Hexerei in den südlichen und westlichen Kirchenprovinzen einzuschreiten und den weltlichen Arm hierfür in Anspruch zu nehmen.
Читать дальше