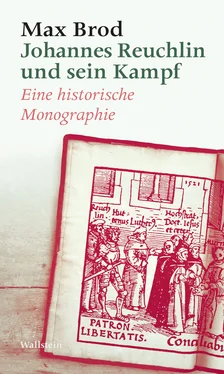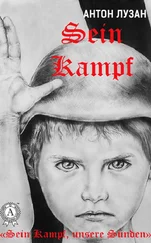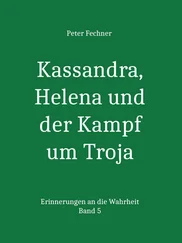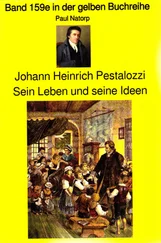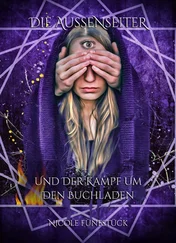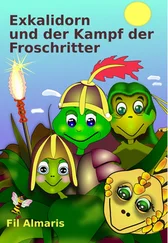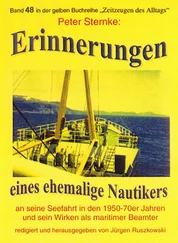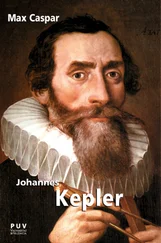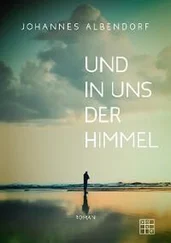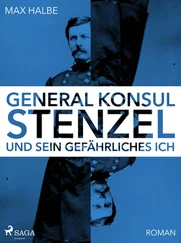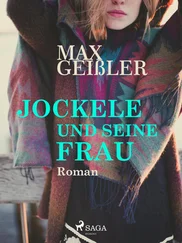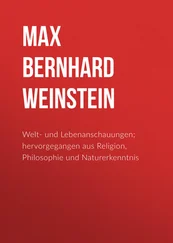In Rom hatte Graf Eberhard Geschäfte beim Vatikan zu erledigen, Streitigkeiten über Vergebung geistlicher Lehen zu bereinigen, wobei Reuchlin vermutlich als juridischer Berater mitwirkte. Unter den Gelehrten in Rom lernte er den Griechen Johann Argyropulos kennen, mit dem er in einen echt-humanistischen, uns heute etwas kindisch anmutenden Wettstreit eintrat. Er scheint dabei viel Beifall gefunden zu haben. Rom zeigte ihm damals gleichfalls ein freundliches Gesicht. Papst Sixtus IV. hatte kurze Zeit vorher einen schweren Konflikt mit den Medici gehabt (die Verschwörung der Pazzi, Ermordung des Giuliano beim Hochamt in der Kirche, zwei Geistliche als Täter, päpstliche Intrigen als Hintergrund), doch der diplomatischen Kunst Lorenzos war eine Versöhnung mit dem Papst gelungen. Der allgemein erwartete Krieg brach nicht aus. Giraudoux wurde antizipiert. So wurden die aus Florenz anlangenden Gäste in Rom freundlich aufgenommen. – Sixtus IV., der Stifter der sagenhaft bedeutsamen Sixtinischen Kapelle, hat in der Kunstgeschichte eine führende Bedeutung. Er förderte Künstler vom Rang eines Botticelli, Ghirlandaio, Verrocchio, er berief den unsterblichen Komponisten Josquin de Près nach Rom. Aber er legalisierte auch die Einsetzung des entsetzlichen Torquemada und anderer Dominikaner als Inquisitoren in Spanien; anfänglich hatte er die Einführung der Inquisitionstribunale in Spanien abgelehnt, später bewilligt, und diesem ursprünglich weltlichen Instrument des spanischen Königtums die kirchliche Autorisation verliehen, die es dann jahrhundertelang behielt. Es begann ein massenhaftes Quälen und Abschlachten unschuldiger und wehrloser Menschen, wie es erst wieder in unserer Zeit Geschichte geworden ist, die das Blut vor Entsetzen gerinnen macht. Jetzt freilich ins Vieltausendfache vergrößert und völlig unfaßbar. –
Erst 1490 kam Reuchlin wieder nach Italien. Die erste Reise scheint keine geistige Umwälzung in Reuchlin ausgelöst zu haben, obwohl sie vermutlich reich an großen Eindrücken war. Anders die zweite, die das Zusammentreffen mit Pico della Mirandola zeitigte. Hier wurde ein neuer Lebensabschnitt begonnen.
Im Intervall zwischen den beiden Italienreisen erlangte Reuchlin das Doktorat der Rechte und heiratete. – ›LL doctor‹ oder auch ›legum doctor‹ oder auch ›doctor juris‹ nennt er sich jetzt. – Was die Heirat anlangt, so sind wir heute ein wenig besser über Reuchlins Familienverhältnisse unterrichtet als zur Zeit, da Geiger seine Reuchlinbiographie schrieb. Obwohl sich Reuchlin mehrmals ausdrücklich als ›digamus‹ (zweimal verheiratet) bezeichnet, findet Geiger für diesen einfachen Ausdruck recht künstliche Deutungen, die irreführend wirken. Die Wirklichkeit ist viel einfacher als die Hypothesen des gelehrten Biographen. Über die Person der Gattin oder der beiden Gattinnen war dem damaligen Stande der Forschung nichts bekannt. Inzwischen sind durch Eugen Schneider u. a., vor allem durch Hansmartin Decker-Hauff (›Bausteine zur Reuchlin-Biographie‹ in F. 2) Dokumente entdeckt und ausgewertet worden, die uns in manchen Punkten Klarheit verschaffen – ohne freilich die Hauptsache, die seelische Beziehung der Eheleute zueinander, zu erhellen. Decker-Hauff macht es wahrscheinlich, daß Reuchlin eine Bürgerstochter aus einer Familie Müller, die der altwürttembergischen Führerschicht, der sogenannten ›Ehrbarkeit‹ angehörte, geheiratet hat. Sie war in der Ortschaft Ditzingen und in Stuttgart reich begütert. Die Braut war mindestens um 5 Jahre älter als Reuchlin. Noch 1529 heißt der große Besitz, den Reuchlin in Ditzingen bei Leonberg hatte, ›der Doktorin Gut‹. Den Beweis hat Victor Ernst erbracht. Von einem Teilstück dieses Besitztums wissen wir, daß es rund 15 Morgen Äcker und Wiesen umfaßte. Es gab aber noch andere Reuchlinsche Parzellen in der Ditzinger Markung. Reuchlin liebte das Landleben und wird nicht müde, in seinen Briefen »von der Bewirtschaftung und dem Ertrag des Gutes, von seinen Annehmlichkeiten und seiner heiteren Schönheit« zu erzählen. –

Ulrich von Hutten: Nach einem Holzschnitt aus der ersten Ausgabe von ›Cum erasmo Roter, Expostulatio‹. Straßburg 1522.
Decker-Hauff stellt fest: »Der Reichtum der Frau ist das einzige, was wir sicher von ihr wissen. Die übrigen Zeugnisse widersprechen einander: Schneider wies auf den hübschen Zug hin, daß Reuchlin ihr mitten aus den Geschäften einer Gesandtschaftsreise heraus ›von Liebe‹ schrieb – demgegenüber steht das Zeugnis, daß sich Reuchlin – mindestens zeitweilig – mit Scheidungsgedanken getragen haben soll.« Eine Stelle aus einem Brief des Kardinals Raimund von Gurk an Reuchlin, die ausdrücklich von Scheidung spricht, wird von Geiger als (möglicherweise) scherzhaft gemeint interpretiert. Ich kann in ihr keinen Hinweis auf einen Scherz finden. Auch scheint die Tatsache, daß die Frau ihm nicht in sein drei Jahre dauerndes Heidelberger Exil gefolgt ist (von diesem Exil später!) nicht gerade für ein verliebtes Einverständnis der beiden zu sprechen. Decker-Hauff kommt zu der auch anderweitig gestützten Schlußfolgerung: »Man geht wohl nicht fehl, wenn man, wie es auch die Zeitgenossen taten, in der Wahl vor allem den Versuch zu materieller Sicherstellung sieht.« Die reiche Stuttgarter Bürgerstochter mochte dem jungen und am Hofe wohlgelittenen, aber nicht sehr reichen Mann wohl nach altwürttembergischem Brauch »angemutet und wohlbezeichnet« worden sein. – Doch Decker-Hauff hält an der Hypothese einer Konvenienzehe selber nicht fest. Er paralysiert sie durch eine andere Hypothese, die eine Jugendbekanntschaft im Kreise zweier seit eh und je befreundeten Familien annimmt und urkundlich zu belegen sucht. Wie dem auch sei: im allgemeinen galt in Humanistenkreisen das Motiv einer Geldheirat durchaus nicht als den guten Sitten widersprechend. Ich übersetze aus einem Brief, den der gelehrte Augsburger Ratsherr und Historiker Conrad Peutinger, einer der Gesandten und zeitweilig einflußreichsten Ratgeber des Kaisers Maximilian, 1499 an Reuchlin gerichtet hat. Da heißt es, nicht ohne daß ein leiser Ton des Sich-Berühmens durchklingt: »Und um mich von der Freiheit eines lasziven Lebens zu erleichtern, sowie um der göttlichen Einrichtung zu gehorchen, habe ich eine Frau genommen, eine Jungfrau, nur um weniges kleiner als ich, noch nicht 18 Jahre alt, züchtig, maßvoll, schön, ehrsam und ein wenig mit lateinischer Literatur durchtränkt, die auch in den Augen ihrer Hausgenossen nie als streitsüchtig oder schimpfworteliebend erfunden worden ist. Von guten Eltern unserer Stadt stammend, erhält sie eine Mitgift von zweitausend Gulden, überdies ist sie, falls sie überlebt, die einzige Erbin. Ich danke daher Gott und werde ihm immer danken, daß er meinen Studien eine Gefährtin und mir auf eine so vertraute Art eine Parteigängerin zugesellt hat.« In diesem Brief sind viele löbliche Gaben der Braut hochgepriesen, doch als letzte Sprosse der Klimax findet die zahlenmäßig genau angegebene Mitgift ihren besonders wichtigen Platz. In vielen schlechten Romanen wird heute eine solche Wertung gern mit den Klischeeausdrücken »echt amerikanisch« oder »echt jüdisch« gekennzeichnet, was natürlich Unsinn ist. – Dem Mystiker Reuchlin möchte man allerdings eine bessere Wertskala zutrauen als die hier vermutete. Sie ist ja aber durchaus nicht etwa erwiesen, sondern als bloße Hypothese anzusehen.
Reuchlins zweite Frau: ein ganz anderes Bild. Und ein etwas deutlicheres, wenn auch nicht ganz klares. Sie war, wie Decker-Hauff auf Grund eines Briefes des Humanisten Beatus Rhenanus berichtet, »jung und hübsch«. Auch sie galt als sehr reich. Es geht indirekt aus einer alten Stammtafel hervor, daß diese zweite Frau Anna geheißen hat. Der Vorname der ersten Frau ist bisher unbekannt geblieben. Mit der zweiten Frau hat Reuchlin ein Kind gehabt, das in frühester Jugend starb. Auch dies: Vermutungen. Sicher ist, daß Reuchlin neben der zweiten Frau in der Stuttgarter St. Leonhards-Kirche begraben ist. Wenngleich nicht an dem Ort, den der heute in der Leonhardskirche befindliche Grabstein anzeigt, der sich übrigens ursprünglich in der Hospitalkirche (Dominikanerkloster) befunden hat. Es ist seltsam, wie alles Intime und ganz Persönliche Reuchlins in Dunkel gehüllt bleibt. So besitzen wir ja auch kein einziges echtes Porträt Reuchlins, nur eine winzige Zufallsdarstellung auf einem figurenreichen Flugblatt – und eine Reihe abenteuerlicher Bildnis-Fälschungen; während sich die größten Meister der Zeit (Dürer, Holbein, Quinten Matsys u. a.) darum bemüht haben, die Gesichtszüge des Erasmus deutlich und feierlich für die Nachwelt festzuhalten. (Vgl. Schlußkapitel.)
Читать дальше