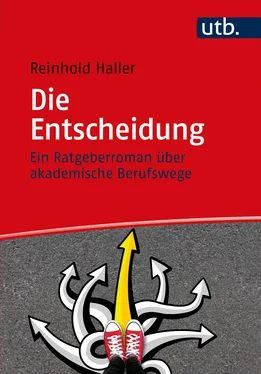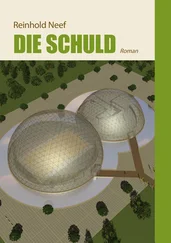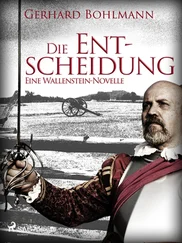Um diesem inflationär gewordenen Bewertungssystem etwas entgegenzusetzen, einigte man sich erneut auf den neuen Qualifikationsstatus unique , also einzigartig. Wer heute eine wirklich abgesicherte Existenzberechtigung erreichen will, muss also irgendwie nahezu einzigartig sein. Wodurch und womit auch immer; ein jeder auf seine Art.
Derlei Behauptungs- und Verdrängungswettbewerb ist im wissenschaftlichen Bereich aber wahrlich nicht neu. Dazu ein kleiner Ausflug in die Geschichte: Um an einer Universität eine Lehrbefugnis zu erhalten, also praktisch Professor:in zu werden, reichte früher, je nach Fachgebiet und Fakultät, der akademische Abschluss als Magister oder Doktor. Letzteres heißt ja bekanntlich auf gut Deutsch nicht mehr als ‚der oder die Gebildete‘.
Erst im napoleonischen Zeitalter setzte sich die HabilitationHabilitation durch; sozusagen als zweite akademische Hürde. Dies geschah vor allem deshalb, weil es schlicht viel mehr Magister oder Doktoren gab, als für den Lehr- und Wissenschaftsbetrieb nötig – und erst recht, um die raren Spitzenämter zu besetzten. Jetzt brauchte man also als zusätzliche Befähigung eine Habilitation, um die sogenannte Venia LegendiVenia Legendi beziehungsweise in Österreich oder der Schweiz die Venia DocendiVenia Docendi zu erlangen. Erst mit dieser Auszeichnung hatte man dann die Weihen erlangt, um in die sicheren Sphären des Forschungs- und Lehruniversums aufgenommen zu werden. Man sieht, der Wettbewerb in der Wissenschaft hat eine lange Tradition.
Zurück zur Neuzeit: Wer heute unbefristete oder gar verantwortliche Stellen in Wissenschaft und Forschung mit entsprechender Raum-, Mittel- und Personalausstattung bekleiden will, muss sich in diesem Wettbewerb erfolgreich behaupten als außergewöhnlich gut, exzellent oder gar als einzigartig. Oder man schafft es mit Ausdauer und Geschick, längerfristig so überzeugend zu wirken, als ob man es wäre. Auch solche Fälle gibt es vereinzelt im Wissenschaftsbetrieb.
Damit meine bereits beschriebene persönliche Begeisterung für dieses Berufsfeld nicht vergessen wird, möchte ich noch einmal ausdrücklich betonen: Die Arbeit im Bereich Wissenschaft und Forschung kann sehr motivierend sein und sich für viele Menschen als nachhaltig erfolgreich und erfüllend erweisen. Aber die Rahmenbedingungen sind ähnlich beschwerlich wie im Sport oder im künstlerischen Bereich.
Selbst im Leistungssport schafft es bekanntlich nicht jedes Talent trotz Begabung, Fleiß und Leidensfähigkeit in eine gute, sichere und auf Dauer existenzsichernde Position zu kommen. Letztlich ist dies ja überall so im Arbeits- und Erwerbsleben, wo die Konkurrenz groß ist und die angestrebten Stellen selten sind. Henry Ford soll einmal gesagt haben: ‚Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten besitzt, die im Moment gefragt sind.‘ Wenn die Fähigkeiten dazu nicht ganz hinreichend sind oder das richtige Momentum fehlt, wird es schwierig mit der nachhaltigen Sicherung des Berufswunsches.
Drittens: Hier muss ich aufpassen, nicht zu klagen, denn von diesem Tatbestand lebe ich letztlich als Berater, Trainer und Coach im Wissenschaftsbereich. In einem weiteren Bereich unterscheidet sich der Wissenschaftsbetrieb von anderen Organisationen in der Verwaltung oder der freien Wirtschaft: Viele Wissenschaftler:innen, selbst solche in höheren Positionen, sind für breite Bereiche ihres Tuns und Schaffens nicht wirklich solide ausgebildet. Die Folge dessen spüren viele Insider des Wissenschaftsbetriebes mehr oder weniger, früher oder später irgendwann am eigenen Leib.“
„Wie meist du das?“, fragte Niko, Amisha Bruder. „Die meisten Wissenschaftler:innen haben doch ein Bachelor- und darauf aufbauend ein Masterstudium hinter sich gebracht. Sie haben einige Jahre als Doktorand:innen und vielleicht weitere Jahre als junge PostDocs Erfahrungen gesammelt und sich enormes Wissen angeeignet. Manche haben sich sogar habilitiert und sind als Hochschullehrer:in oder Dozent:in tätig. Mit diesem Pensum sollte man doch ausreichend gut ausgebildet und erfahren sein.“
„Vollkommen richtig!“, entgegnete Leo. „Aber das betrifft ausschließlich die fachliche, wissenschaftliche Ausbildung. Wenn du jedoch in der wissenschaftlichen Ausbildung das Gröbste hinter dir hast, beginnst du, mehr und mehr Verantwortung zu übernehmen. Irgendwann leitest du eigenständig Projekte, vielleicht leitest du eine kleine Gruppe an oder du betreust selbst schon Auszubildende im Praktikum oder Studierende.
Später bekommst du vermutlich formale Führungsverantwortung für deine Mitarbeitenden. Deine Aufgaben und Verantwortung summieren sich mit der Zeit. Und dann stellst du irgendwann fest, dass du Organisations- und Managementkompetenzen brauchst, wie etwa eine strategische Planung, ProjektmanagementProjektmanagement, KonfliktmanagementKonfliktmanagement für den Umgang mit Kolleg:innen, Mitarbeitenden und Kooperationspartner:innen oder dass du Elemente des Changemanagements einsetzen musst, wenn es hin und wieder Organisationsstrukturen, Teams oder Prozesse zu verändern gilt.
Spätestens dann merkst du – das ist zumindest zu hoffen und zu wünschen –, dass du fachlich top bist, aber im Bereich der eben genannten Themen ziemlich auf dem Schlauch stehst. Dann wird immer offensichtlicher, dass du wenig Konkretes und Praktisches gelernt hast über den erfolgreichen Umgang mit Prozessen, Organisationen, Menschenführung oder über den Umgang mit deinem Selbst- und Zeitmanagement.
In den meisten Bereichen der Verwaltung und erst recht in der Wirtschaft und Industrie werden angehende Führungskräfte und verantwortliche Manager erst einmal gründlich aus- oder weitergebildet, bevor sie als Führungskraft oder im sogenannten Management auf die Menschheit losgelassen werden.
Im Wissenschaftssystem ist es hingegen so, dass offensichtlich die Meinung vorherrscht, dass die oberen Hierarchien diesbezüglich klug genug seien und entsprechende Weiterqualifikationen nicht brauchen. Fragt man dann aber das wissenschaftliche oder wissenschaftsnahe Personal wie Laborand:innen, Techniker:innen oder Sachbearbeiter:innen im administrativen Bereich, dann zeigen sich viele der Beschäftigten demotiviert und enttäuscht von ihrer jeweiligen Führungsebene.
Ende der sogenannten Nullerjahre, ich glaube es war 2009, erschien dazu eine Studie meiner Kolleg:innen Boris Schmidt und Astrid Richter in der Deutschen Universitätszeitung. Wenn ich recht erinnere, lautete der Titel: ‚Das FührungszeugnisFührungspraxis an Universitäten‘. Untersucht wurde das Führungsverhalten von Führungskräften an deutschen Universitäten. Und das Ergebnis war traurig bis desaströs. Wenn es jemand von euch interessiert, kann ich euch den Artikel gerne per E-Mail schicken. Jedenfalls zeigten sich in dieser Studie viele Beschäftigte an den Universitäten sehr unzufrieden mit ihren Führungskräften. Mittlerweile kamen weitere solche Studien leider zu ähnlichen Ergebnissen. Die logische Folge: Man muss in der Tat damit rechnen, im Umfeld von Wissenschaft und Forschung mit relativ spärlich kompetenten Führungskräften konfrontiert zu werden.
Dies ist umso gravierender, als dass eben diese Führungskräfte durch den andauernden Wettbewerb des Systems eher weniger Kapazitäten haben für wissenschaftsfremde Tätigkeiten wie Führung, Organisation oder Teammanagement.
Viertens, und das ist nicht nur seltsam, sondern ärgerlich: Es gibt hin und wieder selbst in der Wissenschaft Organisationen, die beständig die Wirksamkeit des sogenannten Peter-PrinzipPeter-Prinzip unter Beweis stellen. Dieses, nach dem Lehrer und Berater Laurence Peter genannte Gesetz besagt sinngemäß: Hierarchisch ausgeprägte Organisationen neigen dazu, Beschäftigte so lange zu befördern, bis deren höchstmögliche Stufe der Inkompetenz erreicht ist.
Das heißt, dass des Öfteren Menschen in Positionen kommen, in welchen sie mindestens so viel oder gar deutlich mehr Unheil anrichten, als sie Gutes beitragen.
Читать дальше