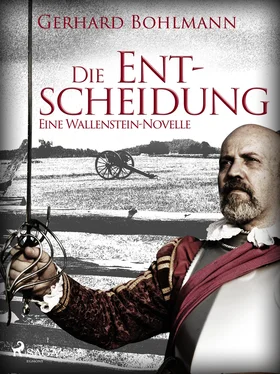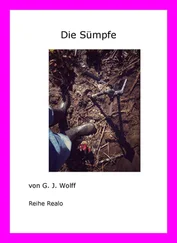Gerhard Bohlmann
Die Entscheidung
Eine Wallenstein-Novelle
Saga
Es war im Juni, als die kaiserlichen Schiffe von Wien losmachten und die Donau hinauffuhren; sie wollten nach Regensburg, zum Kurfürstentag.
Über Nacht war mit südlicher Wärme der Sommer gekommen, und die Flotte des Kaisers glitt in heiße Tage hinein. Die Schiffe schoben sich zwischen den grünenden Hängen des Donautals dahin, an rauschenden Uferweiden entlang; auf den Höhen schimmerten Klöster und Burgen, ziegelrote Städte betteten sich in die Matten, und eine Kapelle spiegelte sich im Wasser des Stroms, aber die Schiffe zogen dunkel und stumpf durch den Sommer. Schwarz geteert waren die bauchigen Rümpfe, über jedem Bug stand ein Kreuz aus dicken Silberbalken und gleißte im Licht; das Heck wurde durch einen Aufbau erhöht, dort befanden sich schmiedeeiserne Träger und hielten Laternen, in denen zur Nacht rote Lichter brannten. Schwarz geteert waren auch Mast, Tauwerk und die Rahen, zwischen denen die Segel sich blähten; die Jungfrau Maria war darauf gemalt, wie sie sich, mit dem Knaben im Arm, aus blauen Wolken erhebt; ihr rotes Gewand leuchtet, und um ihren Scheitel schwebt ein Kreis goldener Sterne.
Zehn Schiffe fuhren die Donau hinauf, zum Kurfürstentag, nach Regensburg. Im ersten wohnten Kaiser und Kaiserin, im nächsten die Räte, in den anderen waren Köche und Diener, Schreiber und Musikanten und Soldaten der Leibwache untergebracht. Ein Zug von Särgen schob sich auf dem Wasser des Stroms dahin und trug zehn flimmernde Silberkreuze mit beschwörender Gebärde durch den Sommer vor sich her.
Es war am Morgen. Von einer Kirche klang die Glocke zur frühen Messe über das Tal hin, da stieg aus den Kabinen des ersten Schiffes der Kaiser an Deck, Ferdinand, der Kaiser des Krieges, der dreißig Jahre dauern sollte, ein hagerer, schmalschultriger Mensch, der sich ganz in Schwarz trug. Mit kleinen sparsamen Schritten begab er sich sogleich zum hohen Aufbau am Heck, der als Kapelle eingerichtet war. Als er die Tür öffnete, quoll ihm der Duft von Weihrauch entgegen, und er trat in den Raum, dessen Wände mit stumpfem Schwarzholz getäfelt waren. Im Hintergrunde schimmerte der elfenbeinerne Leib des Kruzifixus, der mit Goldnägeln auf die dunkle Fläche geschlagen war, zu seinen Seiten leuchteten rote Ampeln und hauchten einen blutigen Schein über den Gemarterten.
Der Kaiser nahm den spitzen Samthut vom Kopf, verneigte sich vor dem Bilde und bekreuzte sich; dann ging er in kauernder Haltung vor und kniete nieder. Ferdinand begann zu beten. Zuerst war es ein stummes Flehen; dann, als der Weihrauch die Kammer erfüllte, rang er die Hände gegen den Gekreuzigten, und der hagere Körper des Knienden geriet in trunkene Bewegung: „Wer kann, Allmächtiger, deine Wege begreifen“, flüsterte er, „wer wollte wider die Prüfungen murren, die du uns auferlegst! Da wir aber von Herzen verzagt sind, so erkläre dich uns und beweise deine Stärke vor unseren Augen! Sind nicht die Feinde deiner alleinseligmachenden Kirche auch die des Kaisers, hat mein Haus dir nicht treu gedient durch die Jahrhunderte — warum ließest du das Unkraut der Ketzerei aufschießen in der Welt? Sende die Glut deiner Sonne, damit es verdorre; schleudre den Blitz deines Himmels, damit es brenne! Schütze mich, Allmächtiger, schütze mein Haus, halte die Hand über meine Heere, denn sie sind auch die deinen; segne die Unternehmungen meines Generals Colalto, der vor Mantua steht, und laß ihm die Einnahme der Stadt gelingen, erleuchte die Sinne meines Feldherrn Wallenstein und schenke ihm ein treues und rechtschaffenes Herz zu deiner Ehre, und so schütze alle meine Freunde, damit sie dir anhangen und danken — aber erschrecke unsere Feinde und vernichte sie! Schlage mit Blindheit den schwedischen König, und wenn er gegen uns aufbricht, so laß seine Schiffe an den Küsten zerschellen, damit die Welt deinen Zorn erkenne. Amen.“
Als der Kaiser aus der roten Dämmerung der Ampeln und dem Weihrauchnebel kam, blinzelte er in die Sonne, die auf dem weißgescheuerten Deck lag und blendete, und bedeckte den Kopf mit dem samtenen Spitzhut. Ferdinand war fünfzig Jahre alt, aber er sah noch jung aus; sein dunkellockiges Haar begann an den Schläfen zu ergrauen, aber der Bart, der das blasse Gesicht umgab und über den Lippen lag, kräuselte sich schwarz. Der schmalschultrige, hagere Körper des Kaisers steckte in schwarzem Samt, aus dessen Schlitzen Silberbrokat spärlich hervorquoll. Ferdinand begann über das Deck zu gehen, dessen weiße Fläche leer vor ihm lag. Die Reling des Schiffs bestand aus einer Balustrade schwarzer Säulen; daran schritt er entlang, immer mit den gleichen sparsamen Schritten, er ging dahin, ohne aufzusehen. Als er aus der Kapelle trat, war seine Haut von einer Röte überflogen, wie immer, wenn er sich erregte; die verging jetzt, er wurde sehr blaß, und die Nase stand bleich und nüchtern in seinem Gesicht. Über ihm rauschte der Wind im geblähten Segel, die Taue knarrten, das Wasser schäumte am Bug, und die Gestade glitten prangend vorüber; er sah nicht auf, er ging mit seinen kargen Schritten an den gedrechselten Säulen dahin. Er hielt die Arme auswärts gewinkelt, und die blutleeren Hände ruhten schützend auf seinen Lenden; diese Hände waren schmal und entartet, unnatürlich war die spinnenhafte Länge seiner Finger, die in spitzen Nägeln endeten. Aus dem Samt wehte ein Duft von Weihrauch. Unablässig schritt der Kaiser über die weiße Fläche des Decks.
Er hielt an, als er einen Schatten bemerkte: die Kaiserin stand vor ihm, Eleonore, eine mantuanische Prinzessin von zwanzig Jahren, die vor einigen Wochen dem Kaiser vermählt worden war. Er blickte sie an. Er sah, wie das Licht auf ihrem blauschwarzen Scheitel ruhte, wie sich die Brüste aus schwarzen Spitzen erhoben, wie das Mieder die schmalen Hüften umspannte, er sah die gemeißelte Schönheit des jungen Gesichts. Da glänzten die Augen Ferdinands, und die Röte flog wieder über das bleiche Gesicht. Aber er legte zur Begrüßung die Finger an den samtenen Spitzhut, er begann in seinem kargen Ton: „Ich habe die Kaiserin wiederum bei der Morgenandacht vermißt — warum? Es ist wohlgefällig, wenn Kaiser und Kaiserin ihre Bitten gemeinsam vortragen; zwei demütige Herzen erwirken mehr als ein einzelnes: warum geschieht es nicht?“
Eleonore wagte nicht aufzusehen. „Ich kann es nicht. Ich kann es nicht über mich bringen, neben dem Kaiser zu beten, wenn er um die Vernichtung Mantuas fleht. Mantua ist für mich Kindheit, Jugend und Glückseligkeit. In Mantuas Gärten, wo im Grünen die griechischen Götter stehen, habe ich als Kind mit Bällen gespielt, unter seinen Zypressen fand ich die Freundin; in der Kathedrale von San Andrea ging ich zur ersten Beichte, in ihrem Gewölbe empfand ich den ersten Schauder der Orgel, die Bilder der Heiligen und das Gold des Altars — wie könnte ich beten, daß diese Stätten vernichtet würden? Es wäre Lüge. Der Kaiser wird mich nicht zur Unwahrhaftigkeit zwingen wollen.“
Sein verschleierter Blick weidete sich an ihrem Wuchs, aber seine Stimme klang nüchtern und streng: „Das wäre es. Als ich die Belagerung Mantuas begann — meine Überzeugung und mein General Wallenstein rieten dazu — schickte ich meinen Rat Eggenberg vorsorglich zur Kaiserin, um sie vorzubereiten, ich bin mit Schonung und Achtung verfahren. Die Kaiserin wird es nicht leugnen.“
„Mit Achtung und Schonung“, wiederholte sie in leiser Erbitterung, „ich leugne es nicht.“
Ferdinand wurde durch ihren Ton gereizt: „Eleonore ist nicht mehr Prinzessin von Mantua, sie ist Kaiserin und dem habsburgischen Hause verbunden, die Interessen des Kaisers sind die ihrigen geworden. Wenn es Habsburg gefällt, seine Macht auch jenseits der Alpen zu befestigen, wird es um einer mädchenhaften Erinnerung willen nicht unterbleiben.“ Er erregte sich, da Leonore in stummem Widerstreben vor ihm stand: „Ich vermute wohl richtig, wenn ich auch die schwarze Kleidung, in der ich die Kaiserin seit einiger Zeit sehen muß, mit dem mantuanischen Krieg in Zusammenhang bringe? Sie soll Trauer und Widerspruch ausdrücken — ist es so?“
Читать дальше