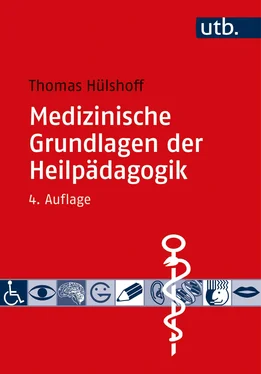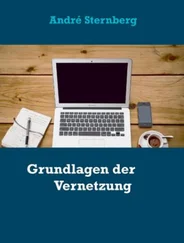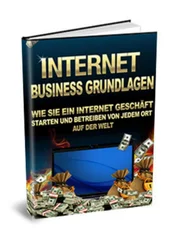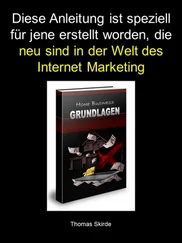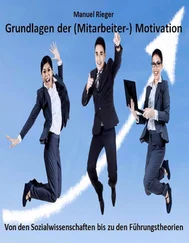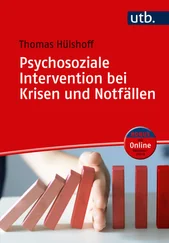Auch die Krätzmilbe geht mit außerordentlich starkem Juckreiz, vor allem nachts und in Wärme, einher. Kratzspuren an den Händen, insbesondere in den Fingerzwischenräumen, sind charakteristisch, ebenso Milbengänge in diesem Bereich. Krätzmilben verbreiten sich vor allem bei Körperkontakt sowie engem Zusammenleben und einem Nichttrennen der Wäsche. Dies erfordert u. a. eine ausreichend lange Behandlung der Betroffenen, aber auch das Abkochen der Wäsche bzw. Spezialbehandlung nichtkochbarer Wäsche. Falls erforderlich, muss das gesamte familiäre Umfeld behandelt werden.
An diesen beiden Beispielen (zu nennen wären noch weitere, wie z. B. der Befall mit Flöhen) zeigt sich, dass parasitäre Erkrankungen häufig dann auftauchen, wenn Menschen auf engstem Raum zusammenleben. Zwar können mangelhafte hygienische Verhältnisse solchen Erkrankungen Vorschub leisten, doch muss dies keineswegs zwangsläufig der Fall sein. Kinder können sich auch auf einem Kindergeburtstag mit einem der eben genannten Erreger infizieren und der Befall von Kopfläusen oder Krätzmilben ist keineswegs zwangsläufig mit sozial schwierigen Verhältnissen gekoppelt.
Stigmatisierung
Dennoch kann der Befall mit diesen Krankheitserregern sozial in besonderer Weise stigmatisierend sein – insbesondere deswegen, weil die Kinder erst dann wieder in den Schulunterricht kommen dürfen, wenn eine Heilung durch den Kinderarzt bzw. das Gesundheitsamt bestätigt wurde. Aufgabe einer möglicherweise stattfindenden begleitenden Pädagogik ist hier nicht nur die hygienischen Maßnahmen, sondern auch die potenziellen sozialen Stigmatisierungsphänomene sowie die individuellen seelischen Kränkungen zu kennen und empathisch aufzuarbeiten.
Das Kind im Krankenhaus
Schließlich soll noch kurz auf das Kind im Krankenhaus eingegangen werden. Kinder können zum einen wegen kurzfristiger und temporärer Störungen (z. B. Operationen) in ein Krankenhaus eingewiesen werden. So dramatisch dieses Geschehen im Erleben von Kindern und Eltern ist, so schnell ist es unter günstigen Bedingungen aber auch erledigt und verarbeitet. Anders sieht es aus, wenn Kinder beispielsweise aufgrund einer Krebserkrankung über lange Zeit, mitunter Monate oder sogar Jahre, immer wieder einmal ins Krankenhaus müssen und dieses fast schon zum „zweiten Zuhause“ wird. Meist ist das Kind im Krankenhaus einer großen Anzahl ihm unbekannter Funktionsträger und Menschen ausgesetzt und kann dies nur schwer in sein Erleben integrieren. Das Krankenhaus ist eine Welt mit Instrumenten, Geräten und Operationssälen, endlos langen Gängen, vielfach sich gleichenden Türen, eigenartigen Gerüchen, vielen fremden Menschen unbekannter Herkunft und noch unbekannterer Kleidung. Diese ist dem Kind oft sehr fremd und lässt es sich nach einer vertrauten Umgebung sehnen. Die Krankenhaus-atmosphäre kann das Kind verwirren und schwer überschaubar sein.
Mit Hilfe der Eltern ist es leichter, diesen Zustand zu ertragen und sich auf die Begegnung mit neuen Menschen einzulassen. Die Verunsicherung schreitet fort, wenn Kinder in fremden Umgebungen und von fremden Menschen mit Untersuchungen und Maßnahmen konfrontiert werden, die sie als bedrohlich empfinden. Untersuchungen, Spritzen, Fieber messen, Verband wechseln und präoperative Vorgänge können zu Ängsten, mitunter auch zu Schmerzen führen. Unzählige, insbesondere ungewohnte Dinge verunsichern das Kind und müssen von geduldigen und verständnisvollen Eltern und Pädagogen aufgefangen oder bearbeitet werden. Trennung von den Eltern kann den Stress zusätzlich erhöhen, weswegen die Anwesenheit der Eltern so weit wie möglich von Nutzen ist. Die fremde Umgebung bedarf vertrauter Bezugspersonen, ausreichender Vorbereitungszeit, bekannter Gesichter etc.
Fremde Pflegepersonen sollten von den Eltern vorgestellt und positiv konnotiert werden. Wechselnde Pflegepersonen könnten durch Gruppenpflege oder ein Bezugspflegesystem ergänzt werden. Unverständliche Signale oder medizinische Fachsprache bedürfen der Übersetzung in eine kindgemäße Sprache, die von dem Kind auch verstanden werden kann, wobei auf die oben schon genannte Symbolik einzugehen ist. Auch die Nahrung und der Tagesablauf können als ungewohnt und unbekannt klassifiziert werden. Ähnliches gilt für Erziehungsstil u. a. Anforderungen, die im positiven Falle von Krankenschwestern, pädagogischem Personal und Eltern gemeinsam abgesprochen werden. Auch sollten alle beteiligten Erwachsenen auf noch nicht verstandene Krankheitsphantasien, Ängste und inadäquate kindliche Auseinandersetzungen mit dem unbekannten Geschehen eingehen können. Schmerzen und Bewegungseinschränkungen sind ebenfalls Faktoren, auf die Erwachsene Rücksicht nehmen sollten.
Hospitalisierung
Eine längerfristige Trennung von Kindern und ihren Eltern kann im Rahmen eines stationären Aufenthaltes zu schweren seelischen Hospitalisierungsschäden führen. Diese sind zunächst durch eine Phase des Protestes gekennzeichnet – Kinder protes-tieren energisch, lautstark und mitunter wütend gegen diese Trennung –, werden dann aber von einer Phase der Verzweiflung und schließlich der Verleugnung abgelöst. Deshalb ist es besonders wichtig, Eltern und Kindern viel gemeinsame Zeit zu ermöglichen. Geschieht dies nicht, kann in einer zweiten Phase der Verzweiflung das Kind zwar äußerlich ruhiger werden, zeigt allerdings zunehmende Apathie und Monotonie, hat wenig Interesse an der Umwelt und verfällt schließlich in eine tiefe Trauer um Vater und Mutter.
Schließlich kann bei längerem Aufenthalt ohne täglichen Besuch der Eltern das Kind seinen seelischen Schmerz nicht länger ertragen, es verdrängt und verleugnet ihn und damit auch die Gefühle für die Eltern. Nach außen wirkt das Kind zwar wieder aufgeschlossener, und es versucht sein Bestes aus der Situation zu machen. Häufig ist jedoch zu beobachten, dass die Kinder in dieser Situation von ihren Eltern keine Notiz mehr zu nehmen scheinen und sich nicht mehr für sie interessieren – sie haben die Trauer verdrängt. Es handelt sich hier nicht um einen Adaptationsvorgang, sondern um eine ernste seelische Krise der Kinder. Um Verhaltensstörungen, Angstneurosen und seelischen Hospitalismus zu vermeiden, ist also ein intensiver und tragfähiger Kontakt zwischen Eltern und Kindern vonnöten.
Krankenhaus-pädagogik
Pädagogen sollten Eltern die dafür notwendige Hilfe geben. Das fängt bei Beratung auch in finanzieller und arbeitsrechtlicher Hinsicht an, geht weiter über systemische Familienberatung und Familientherapie (auch gesunde Geschwisterkinder sind hierbei mit einzubeziehen) und führt schließlich zu psychoedukativen Gesprächen. Bei diesen werden Eltern über die kindlichen Adap-tations- und Verarbeitungsmöglichkeiten körperlicher Krankheit informiert. Der Krankenhauspädagogik kommt darüber hinaus auch eine pädagogisch-therapeutische Aufgabe in Bezug auf die kranken Kinder zu. Diese können häufig erst im Spiel, in der Zeichnung, in der Musik und bei anderen kreativen Gestaltungsmöglichkeiten über ihre Ängste, Nöte und Sorgen berichten.
Neben den quasi therapeutischen Aktivitäten ist die Hauptaufgabe eines krankenhauspädagogischen Dienstes aber die, Kindern auch bei längerem Krankenhausaufenthalt ein adäquates Umfeld zu geben, das ihre kindliche Entwicklung ermöglicht und perpetuiert. Auch kranke Kinder sind nicht in erster Linie Patienten, sondern Kinder. Einerseits ist unbestreitbar, dass die primäre Aufgabe eines Krankenhauses in Diagnostik, Therapie und Pflege besteht. Das Primat ärztlicher und pflegerischer Tätigkeit soll nicht bestritten werden. Andererseits ist als „dritte Säule“ der Begleitung kranker Kinder auch die Pädagogik vonnöten. Ihr muss ein neben dem medizinisch-pflegerischen Aspekt ausreichendes räumliches, zeitliches und personelles Gewicht zugestanden werden.
Читать дальше