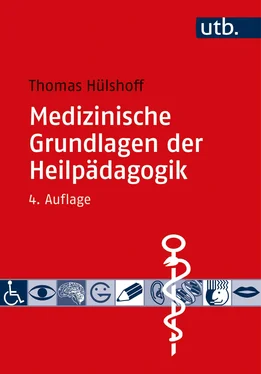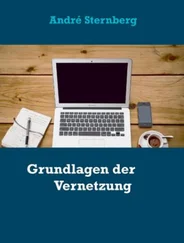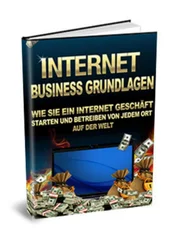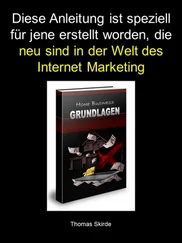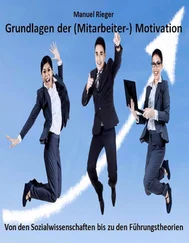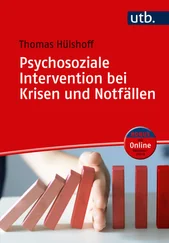In der „International Classification of Functioning, Disability and Help“ (ICF) von 2001 wird besonderer Wert auf das Aktivitätspotenzial und die Partizipation behinderter Menschen gelegt. Es ist aber wichtig, sich klarzumachen, dass Behinderung nicht mit Krankheit identisch ist: Zwar können Krankheiten zu Behinderung führen und Behinderung manchmal mit erhöhter Vulnerabilität einhergehen, aber eine Behinderung selbst ist keine Krankheit, sondern eine „Variante der Daseinsform in der Vielfalt menschlicher Daseinsformen“ (Nicklas-Faust, zit. in Hülshoff 2010, 2).
Die oben genannten Resilienzfaktoren können also auch bei Menschen mit Behinderung dazu führen, trotz vielfältiger Belas-tungen und Krisen gesund zu bleiben und ein gelingendes wie teilhabendes Leben trotz und mit zum Teil erschwerten Bedingungen zu führen. Die notwendigen Rahmenbedingungen einer so verstandenen Gesundheitsförderung auf sozialer und politischer Ebene umfassen gemäß der eingangs erwähnten Ottawa-Charter der WHO unter anderem „Frieden, angemessene Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung […], soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit“ (zit. nach Michel in Schwarzer 2010, 71). Es ist aufschlussreich, dass sich diese Aussage keineswegs exklusiv auf Menschen mit Behinderung, sondern, (wenn man so will inklusiv), auf alle Menschen einer Gesellschaft bezieht.
2.4Soziale Dimensionen von Krankheit

Der zehnjährige Kevin wird wegen heftiger, chronischer Kopfschmerzen, Spiel- und Lernunlust sowie des dringenden Verdachtes einer erheblichen kindlichen Depression in die Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik überwiesen.
Anamnese und familientherapeutische Gespräche und eine „Helferkonferenz“ mit Eltern, Lehrer und begleitendem Sozialarbeiter ergeben folgende Hintergründe: Der 50-jährige Vater ist seit drei Jahren arbeitslos, nachdem er zuvor lange Zeit wegen eines Alkoholproblems erhebliche Schwierigkeiten am Arbeitsplatz hatte. Die Mutter hat ebenfalls mit depressiven Verstimmungen zu tun und hat seit ihrer Jugend heftige Migräneanfälle. Kevins 13-jährige Schwester leidet unter Asthma bronchiale, das vor allem in Spannungssituationen vermehrt auftritt. Die ebenfalls in der Familie lebende Großmutter ist wegen einer massiven Herzinsuffizienz auf konstante medizinische und mitunter pflegerische Hilfe angewiesen.
Der vorherrschende Bindungsmodus in dieser Familie ist der des Mitleidens und Mitleids. Gerade weil man sich wertschätzt und liebt, möchte man dem anderen Leid ersparen: Wer am meisten leidet, so die Tradition dieser Familie, bekommt die meiste Beachtung, Zuwendung und Schonung. Am Anfang dieser Familientradition besteht also ein durchaus verständliches, von Mitmenschlichkeit, Achtung und Liebe geprägtes Bild der familiären Beziehung. Verabsolutiert hingegen führten solche nun erstarrenden Beziehungsmuster dazu, dass nur noch Leid beachtet wird: Jede Regung von Lebensfreude, Spontaneität oder Aggression führte dazu, dass man aus dem Blickpunkt geriet oder mit Aufgaben überfordert wurde. So wurden in der hier vorgestellten Familie Aufgaben im Haushalt oder unangenehme Konfrontationen dem jeweils „Gesündesten“ angetragen. Schlimmer noch: Der Bindungsmodus des Mitleidens wurde zur Chiffre familiärer Zugehörigkeit und Solidarität. Lebensfreude und Vitalität konnte sich der Einzelne kaum noch gestatten, wurde es doch als eine Art „Verrat“ an den anderen gesehen.
Zur Symptombesserung und schließlich zur Heilung des zehnjährigen Kevin trug bei, dass ihn Eltern und Großmutter von entwicklungshemmendem „Mitleiden“ freisprachen und verdeutlichten, dass sie sich über seine Vitalität freuen, auch wenn sie selbst aus den unterschiedlichsten Gründen belastet sind. Wichtig war aber ebenso, dass der Junge in Schule und Übermittagsbetreuung altersentsprechende Aufgaben fand, dass es ihm gelang, zunächst in einem Fußballverein, später in einer Jugendgruppe tragfähige Kontakte zu knüpfen, und dass ihm das „Helfersys-tem“, maßgeblich durch die temporäre sozialpädagogische Familienhilfe repräsentiert, Hilfestellung bei seiner Individuation gab. Darüber hinaus lebt Kevin in einer Gesellschaft, die neben familiärem Zusammenhang auch Individuation und persönliche Entwicklung als einen eigenständigen Wert postuliert.
Indexpatient
An diesem Beispiel wird deutlich, dass die zweifellos somatischen, funktionell sehr wirksamen Schmerzen des „Indexpatienten“ in ihrem sozialen Kontext eine noch andere Bedeutung finden, als wenn man sie isoliert sieht. Auch eine „Therapie“, die die psychosozialen Aspekte berücksichtigt, wird sich nicht mit autogenem Training und schmerzlindernder Medikation begnügen – so sinnvoll solche Maßnahmen sein mögen.
Wie mit einem Teleskop kann man den Fokus der Aufmerksamkeit auf die somatischen, psychischen oder sozialen Komponenten einer Erkrankung richten. So können auf der somatischen Ebene genetische Faktoren (z. B. eine veranlagungsbedingte Überreaktion auf Schmerzen), zelluläre Faktoren (z. B. ödematöse Bezirke) oder Fehlfunktionen (Minderdurchblutung oder Blutdruckschwankungen) eine Rolle beim Entstehen von Kopfschmerzen spielen. Auf der psychischen Ebene können verdrängte Konflikte und damit verbundener primärer Krankheitsgewinn ebenso wie ein ängstliches Beobachten körperlicher Fehlfunktionen oder das Gefühl von Niedergeschlagenheit, Depression und Hoffnungslosigkeit das subjektive Empfinden von Kopfschmerzen beeinflussen. Auf der sozialen Ebene, um die es in diesem Kapitel vorrangig geht, kann man das Mikro- vom Meso- und Makrosystem unterscheiden.
Mikro-/Meso-/Makrosystem
Zum Mikrosystem gehören die nächsten Angehörigen und Bezugsgruppen, insbesondere die Familie. Ihre Regeln, Beziehungs- und Kommunikationsmuster, soziale Unterstützung sowie Bindungs- bzw. Ablösemuster beeinflussen maßgeblich das Erleben des Einzelnen auch bei Krankheit und Krankheitsempfinden. Zum Mesosystem zählen wir Netzwerke sowie Institutionen im mittleren Sozialbereich: Wenn Kevin in die Kinder- und Jugendpsychiatrische Abteilung kommt und hier Distanz zum familiären Geschehen gewinnt, so ist dies ebenso zum Mesosystem zu zählen wie die Aktivitäten von Schule, Sportverein, Jugendgruppe und sozialpädagogische Familienhilfe. Dies alles spielt sich aber im soziokulturellen Kontext der Gesellschaft und der Zeit, in der Kevin lebt, ab. Die Gemeinde und die in ihr verorteten Schulen, Krankenhäuser und Jugendgruppen, der Informationsgrad der Bevölkerung über Krankheiten und Krankheitseinstellungen, die öffentliche bzw. veröffentlichte Meinung hierzu, epochale Einflüsse und „Vorurteile“ sowie kulturelle und politische Rahmenbedingungen sind hier von Bedeutung. Auf all diesen Ebenen werden zum einen die Entstehung und der Verlauf von Krankheit beeinflusst, zum anderen speist sich auch das Krankheitsempfinden von solchen sozialen Faktoren.
soziale Faktoren
Nach Misek-Schneider (in Schwarzer 2010, 31ff) lassen sich soziale Faktoren im Prozess der Krankheitsentstehung, im Verlauf der Krankheit sowie bei der Krankheitsbewältigung aufzeigen. So kann der Ausbruch einer Krankheit durch psychosoziale Momente mitbestimmt werden, wenn beispielsweise in Zeiten überhöhter und unphysiologischer beruflicher Beanspruchung ein Erschöpfungssyndrom zu erhöhter Infektanfälligkeit führt oder drohende Arbeitslosigkeit Bluthochdruck, Ängste und eine koronare Herzkrankheit begünstigen. Aber auch ob und wann die aufgetretenen Beschwerden vom „Patienten“ als Krankheitszeichen wahrgenommen und adäquat behandelt werden, wird maßgeblich von sozialen Faktoren beeinflusst: Je aufgeklärter und ausgebildeter der Betroffene, je höher sein sozialer Status und je größer seine finanziellen Ressourcen sind, desto eher wird er adäquate medizinische Hilfe suchen und finden. Bereits im Vorfeld von Erkrankung, nämlich im Ernährungs- und Gesundheitsverhalten, zeigen sich eindeutige Korrelationen zwischen sozioökonomischem Status und einem der Gesundheit zuträglichen Verhalten (wenngleich es natürlich individuelle Ausnahmen gibt). Allgemein kann gesagt werden, dass Armut, Unwissenheit und niedriger Sozialstatus ein erhebliches Gesundheitsrisiko sind, auch in hochtechnisierten Gesellschaften.
Читать дальше