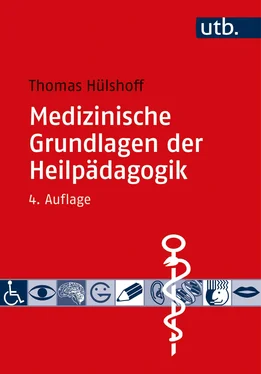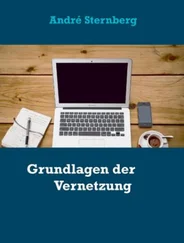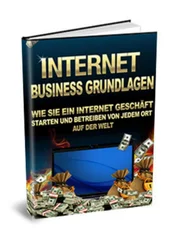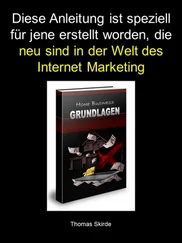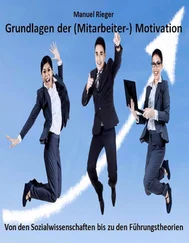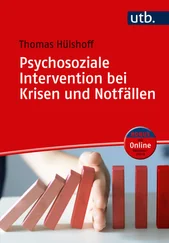Objekt und Raum
Entwicklungsbedingt ist auch der Objektbegriff: Bis etwa zum Ende des zweiten Lebensjahres kann sich ein Kind nicht vorstellen, dass seine Eltern auch außerhalb seines Sehfeldes existieren. So ist beispielsweise für ein Kleinkind, dessen Eltern jenseits der Besuchszeit das Krankenhaus verlassen, nicht deutlich, dass die Eltern weiterhin existieren und verlässliche Bezugspersonen sind. Eng mit dem Objektbegriff ist auch das Raumdenken verbunden. Erst sehr langsam dehnt sich das Begreifen von Raum von dem unmittelbaren Nahbereich des Zimmers, der Wohnung auf das Zuhause und das nähere Umfeld aus: Je kleiner das Kind, desto schwerer die Gewöhnung an neue Räumlichkeiten, was insbesondere bei längeren Krankenhausaufenthalten zu beachten ist.
Kausalität und Zeit
Das kausale Denken entwickelt sich mit zweieinhalb bis drei Jahren. Jetzt fangen Kinder an, nach dem Warum zu fragen, und können in Ansätzen begreifen, dass z. B. Eltern nicht immer im Krankenhaus sein können. Deren Abwesenheit wird jetzt zunehmend nicht mehr als Bestrafung des Kindes, sondern als Sachzwang anderer Genese verstanden. Doch wird dieses noch keineswegs immer tragfähig akzeptiert.
Dasselbe gilt auch für den Zeitbegriff: Die menschliche Fähigkeit, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu leben, entwickelt sich relativ spät. Erst am Ende des dritten Lebensjahres taucht die Frage des „Wann“ auf. Das Zeitgefühl orientiert sich zunächst am Tagesrhythmus, größere Zeitabstände (z. B. das Wiedergesundwerden nach absehbarer Zeit) können frühestens ab dem vierten Lebensjahr ansatzweise begriffen werden. Regelmäßige Rhythmen und eine verlässliche Tagesstruktur sind also bei gesunden, erst recht bei kranken Kindern sehr wichtig. Größere Zeitabläufe wie Wochenperioden oder monatliche bzw. jahreszeitliche Rhythmen werden erst jenseits des vierten Lebensjahres als solche erkannt: Brauchtumsriten, Adventskalender etc. können hier wichtige Hilfen zur Etablierung des Zeitbegriffes darstellen.
Hinsichtlich des kranken Kindes im Krankenhaus heißt dies, dass Kinder schon bei geringfügigen Verspätungen oder Veränderungen des Tagesrhythmus panisch reagieren können: Hat sich ein Kind erst einmal daran gewöhnt, dass der Vater grundsätzlich um 15.00 Uhr – nämlich immer dann, wenn nachmittags der Kuchen verteilt wurde – zu Besuch kommt, kann es kaum verstehen, geschweige denn akzeptieren, dass der Vater sich wegen eines Verkehrsstaus um 20 Minuten verspätet.
emotionalesKrankheitserleben
Kinder können sich Krankheiten nicht logisch erklären. Daher neigen sie dazu, Krankheiten einer äußeren Urheberschaft zuzuschreiben. Sie empfinden sich bei Schmerzen schlecht behandelt, bedroht oder bestraft. Je nach der Vorstellung, mit der Schmerzen assoziiert wurden, kann das Kind auch mit Ärger, Wut, Unterwerfung und Schuldgefühlen reagieren. Manche Kinder kapseln sich ab und ziehen sich zurück, andere erwarten in besonderer Weise Aufmerksamkeit und Liebe von den Bezugspersonen. Schuldgefühle (objektiv völlig fehl am Platze, subjektiv jedoch sehr häufig) resultieren teilweise aus frühkindlichen Vorstellungen von „Bestrafung“ durch Krankheit – ein Phänomen, dass wir gelegentlich selbst bei Erwachsenen vorfinden, wenn sie in kindliche Krankheitsbewältigungsschemata regredieren. Elterliche unbedachte Äußerungen können ein ihres tun, solche Fehlentwicklungen zu fördern. Stattdessen ist es wichtig, in kindgemäßer Art und Weise andere Erklärungsmus-ter für die Krankheitsentstehung anzubieten.
Bewegungs-einschränkung
Letztlich bietet Krankheit eine Belastung durch die Einschränkung des natürlichen Bedürfnisses eines Kindes nach ständiger Bewegung. Folglich werden Kinder im Krankheitsfall oft ungeduldig, zappelig oder quengelig. Mitunter können sie auch aufgrund ihrer Bewegungsarmut aggressiv werden. Vor allem die Abhängigkeit von pflegenden Personen (auch den Eltern) kann von den Kindern als narzisstische Kränkung erlebt werden.
Symbole
Wichtig ist schließlich, dass sich Kinder in und über Krankheit vor allem symbolisch äußern: Im Spielen, auch im Rollenspiel, im Umgang mit Kasperle u. a. Puppen, in Zeichnungen, in den Reaktionen auf vorgelesene Geschichten und in vielen anderen kindgemäßen und kindadäquaten Interaktionen können Kinder ihre Nöte, ihre Ängste und ihr Erleben von Krankheit und Gesundung viel besser ausdrücken als in rein verbalen Gesprächen. Dies zu berücksichtigen ist eine wichtige Aufgabe begleitender Heilpädagogik.
Krankheitsgruppen
Natürlich bestehen große Unterschiede, ob ein Kind vorübergehend an einer zwar heftigen, letztlich aber harmlosen Kinderkrankheit wie z. B. den Masern erkrankt oder eine lebensbedrohliche Leukämie aufweist. Es ist hier nicht der Ort, jedes einzelne Krankheitsbild, das im Kindesalter auftreten könnte, dezidiert zu besprechen: Dazu wird auf die weiter unten angeführte Fachliteratur verwiesen. Stattdessen soll ein erster Überblick über mögliche Krankheitsgruppen gegeben werden, der den Studierenden eine erste Orientierung bietet.
Akut bedrohliche Krankheiten: Akut bedrohliche Krankheiten können (anders als häufig bei Erwachsenen) im Kindesalter sehr plötzlich und akut auftreten und häufig genug ebenso schnell wieder verschwinden. Beispiele hierfür sind die Austrocknung (Exsikkose) und der Pseudo-Croup.
Exsikkose
Die Austrocknung (Exsikkose) kann schon nach ein bis zwei Tagen heftigen Erbrechens, Nahrungsverweigerung, Flüssigkeitsverlust durch Fieber und Schwitzen sowie wässrige Durchfälle auftreten. So können Säuglinge, die mehrere Tage diese Symptome aufweisen, 10% ihres Körpergewichts verlieren, was sie in einen lebensbedrohlichen Zustand versetzt (Erwachsene würden Vergleichbares gar nicht mehr überleben können). Säuglinge mit eingefallenen Augen, trockener Haut, trockener Zunge, der Unfähigkeit, zu speicheln oder Tränen zu produzieren, sind also hochgradig gefährdet und gehören sofort in die Klinik. Dort lässt man ihnen eine Flüssigkeitssondierung oder eine Infusionsbehandlung zuteil werden, und oft sind sie schon nach wenigen Stunden oder einigen Tagen wieder völlig gesund. Anderenfalls allerdings sind schwere Hirnschädigung oder sogar der Tod durch Austrocknung möglich.
Pseudo-Croup
Ebenso ist der Pseudo-Croup als ein solcher kindlicher Notfall zu werten. Hierbei handelt es sich um eine akute entzündliche Erkrankung des Kehlkopfes und der Bronchialschleimhaut, die mit Schleimhautanschwellung, Sekretbildung und akuter Luftnot einhergeht. Typische Symptome des Pseudo-Croups sind Luftnot, inspiratorischer Stridor (also Schwierigkeiten beim Einatmen, oft mit „juchzenden“ Geräuschen), ein Anstieg der Pulsfrequenz, ein charakteristisch-bellender Husten sowie die Angst der Kinder, zu ersticken. Die Behandlung muss sofort erfolgen, da eine Zunahme der Symptome (man unterscheidet vier Stadien des Pseudo-Croups) im vierten Stadium zu Erstickung führen kann. Die Grundprinzipien der Sofortmaßnahme sind Beruhigung, feuchte und kalte Luft und ggf. – falls vorhanden – Kortison in öliger Suspension, das in den Enddarm eingeführt wird und innerhalb von Minuten wirkt.
Der Pseudo-Croup ist im Kindergartenalter besonders häufig anzutreffen, weil die zuführenden Luftwege hinsichtlich ihres Querschnitts in diesem Alter relativ klein sind und (für Erwachsene harmlose) Infekte der oberen Luftwege mit den damit verbundenen Schleimhautschwellungen aufgrund der anatomischen Verhältnisse sehr schnell zu einer Verengung der Luftwege führen: Jenseits des sechsten bis siebten Lebensjahres tritt der Pseudo-Croup relativ selten auf. Manche Kinder sind durch ihre anatomischen Verhältnisse und ihre konstitutionell bedingte Infektanfälligkeit sowie aufgrund ihres Lebensalters besonders croup-anfällig. Deshalb soll nicht verschwiegen werden, dass auch Umweltfaktoren eine Rolle spielen: Insbesondere Smog- und Inversionslagen führen zu einer stärkeren Belastung der Atemwege und vermutlich auch deswegen zu einer stärkeren Gefährdung durch Pseudo-Croup.
Читать дальше