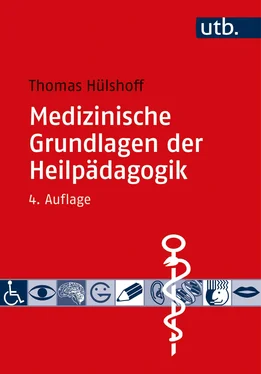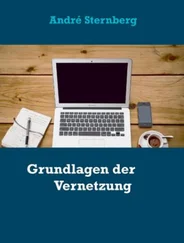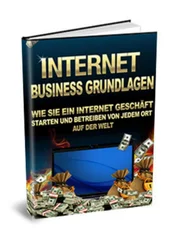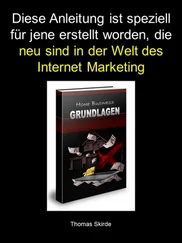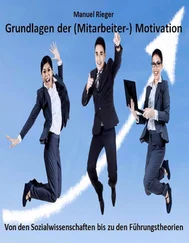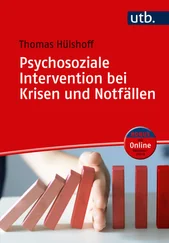Infektiöse Kinderkrankheiten: Eine nächste Gruppe von Kinderkrankheiten besteht in Infekten der oberen Luftwege, so genannten Common-Cold-Krankheiten, sowie den infektiösen „Kinderkrankheiten“. Letztere können in erster Annäherung in virale und bakterielle Krankheiten eingeteilt werden.
bakterielleKrankheiten
Bakterielle Krankheiten werden von Bakterien, einzelligen Lebewesen, hervorgerufen. Da Bakterien sich fortpflanzen und einen Stoffwechsel aufweisen, sind sie – anders als Viren – prinzipiell durch chemische Substanzen „zu vergiften“ (Anti-Biotikum: gegen das bakterielle Leben gerichtet). Bakterielle Erkrankungen – und nur sie – können also prinzipiell durch Antibiotika behandelt werden.
virale Krankheiten
Demgegenüber sind Viren im Grunde nichts anderes als Erbsubstanzen, eingehüllt in Eiweißhüllen, die auf Wirtszellen angewiesen sind und sich nicht von alleine verstoffwechseln und fortpflanzen können. Ihre medikamentöse Behandlung ist deswegen so schwierig, weil es nur selten gelingt, einen Virus zu schädigen, die Wirtszelle aber nicht.

Folgende Krankheiten werden von Viren hervorgerufen (und sind deswegen prinzipiell nicht mit Antibiotika zu behandeln): Masern, Röteln, Windpocken, Gürtelrose und Mumps. Von Bakterien werden u. a. Tuberkulose, Scharlach, Keuchhusten, Tetanus und Salmonellen hervorgerufen.
Eine infektiöse Kinderkrankheit (Infektionskrankheit) entsteht, wenn Infektionserreger – Viren oder Bakterien – durch eine Eintrittspforte in den Körper gelangen. Solche Eintrittspforten können der Nasen-Rachen-Raum sein, wenn via Tröpfcheninfektion, insbesondere durch Husten, die Erreger weiterverbreitet werden. Aber auch von der „Hand in den Mund“ können Bakterien in den Magen-Darm-Trakt geraten. Durch den Darm ausgeschieden und durch unzureichende Handhygiene weiterverbreitet, können sie über Spielzeug oder Nahrungsmittel in den Mund geraten und somit weitere Kinder infizieren. Auch die verletzte Haut ist eine potenzielle Eintrittspforte.
Inkubation
Unter der Inkubationszeit versteht man die Zeit, in der sich die Keime im Körper vermehren, ohne bereits Krankheitssymptome auszulösen. Oft sind die Kinder in dieser Zeit schon ansteckend, obwohl sie noch keine Krankheitszeichen zeigen – dies führt dann dazu, dass sich ganze Kindergartenkohorten infizieren.
■Erste unspezifische Krankheitszeichen zeigen sich in der Prodromalphase , in der die Kinder oft uncharakteristisch Fieber, Husten, Schnupfen oder Durchfall aufweisen und allgemein matt und apathisch wirken. All dies sind unspezifische Krankheitsabwehrzeichen: Durch das Fieber wird z. B. die Körpertemperatur so erhöht, dass Bakterien an weiterer Ausbreitung und Vermehrung gehindert werden. Durch die Schleimhautschwellung und das Ausstoßen von Sekret soll die Keimzahl ebenso vermindert werden wie durch Erbrechen oder Durchfall. Mattigkeit und Erschöpfung sind Reaktionen des Körpers, der der Schonung um seiner Regeneration Willen bedarf.
■Spezifische Krankheitszeichen treten in der Manifestationsphase auf: Hier haben wir dann die beispielsweise für Masern oder Windpocken typischen Krankheitszeichen, die eine Diagnose und damit Prognose ermöglichen.
Immunreaktionen
Schließlich wird sich das Immunsystem des Körpers so weit mit den als Antigenen wirkenden Krankheitskeimen befassen, dass zunächst unspezifische, später spezifische Antikörper gebildet werden. Diese immunologische Abwehr führt zum einen dazu, dass Krankheitskeime umflossen und phagozytiert, also verdaut, zum anderen durch das Bombardement von körpereigenen Abwehrstoffen koaguliert, also verklumpt, werden. Jedenfalls lernt das Immunsystem, mit fremden Krankheitserregern umzugehen – ein Vorgang, den wir als „Immunisierung“ oder „Feiung“ bezeichnen. Bei einer späteren Auseinandersetzung mit denselben Keimen hat das Immunsystem gelernt, gegen Keime spezifisch vorzugehen, so dass eine Krankheit ausbleibt. Krankheiten mit lebenslanger Immunisierung sind beispielsweise die Masern, Krankheiten mit nur sehr geringfügiger Immunisierung die Grippe-Epidemien. In letzterem Falle verändern sich die Erreger so häufig, dass eine Krankheitserkennung oft nur über Monate oder höchstens Jahre möglich ist.
Impfung
Dem Prinzip der Immunisierung liegen auch die Impfschemata zugrunde. Unter aktiver Impfung verstehen wir die Kontamination des Körpers mit abgeschwächten, abgestorbenen oder nur partikulären Krankheitskeimen. Das Immunsystem lernt, mit diesen Bruchstücken von Krankheitskeimen umzugehen, und ist immun gegen die in der freien Wildbahn auftauchenden Krankheitskeime. Manchmal muss parallel eine Passivimpfung durchgeführt werden, bei der den gefährdeten Personen Antikörper in Form von Seren appliziert werden. So dient z. B. bei der Tetanusimpfung nach akuter Gefährdung die Passivimpfung dazu, eine akute Infektion zu verhindern. Die parallel durchgeführte Aktivimpfung triggert das Immunsystem, um einer späteren nochmaligen Tetanusinfektion vorzubeugen.
Chronische Erkrankungen: Das chronisch kranke Kind muss sich über lange Zeit mit den Folgen seiner Schwierigkeiten und Krankheiten auseinander setzen und daran adaptieren – sinngemäß Ähnliches gilt auch für sein familiäres Umfeld. Dabei sind in diesem psychosozialen Adaptationsprozess Krankheitsbedingungen, Entwicklungsdimensionen, die Reaktionen der sozialen Umwelt sowie das familiäre Reaktionsgefüge von ausschlaggebender Bedeutung.
Psychosomatische Störungen: Eine weitere Kategorie kindlicher Erkrankungen besteht in psychosomatischen Störungen des Kindesalters. Als Beispiel wird in Kap. 9 die Enuresis aufgeführt. Einem psychosomatischen Symptom liegt oft eine enge Wechselwirkung zwischen psychischer Störung oder Not und körperlicher Manifestation zugrunde. Dabei sind einseitige Schuld- und Kausalitätszuweisungen fehl am Platze.
So kann beispielsweise im Einzelfalle die Adipositas als Folge einer Deprivation oder Depression und als Versuch, orale Lustbefriedigung anstelle anderer tragfähiger Frustrationsbewältigungsstrategien zu finden, gesehen werden. Andererseits führt die Adipositas mit den damit verbundenen möglichen Stigmatisierungen, Hänseleien oder Isolierungstendenzen und Insuffizienzgefühlen reziprok wiederum oft zu vermehrtem depressivem Rückzug. Dies kann in einer Endlosschleife erneute orale Lustbefriedigung zur Folge haben. Körperliche und seelische Dimensionen verstärken sich also in einem zirkulären Prozess. Es gibt psychosomatische Störungen, bei denen eher die körperliche Dimension, andere, bei denen eher die seelische Dimension im Vordergrund steht.
Psychische Krankheiten: Psychische Krankheiten im Kindes- und Jugendalter sind von zunehmender Bedeutung und betreffen Medizin wie Heilpädagogik gleichermaßen: Depressionen und Angstsyndrome beispielsweise sind zweifellos Krankheiten des Kindes- bzw. Jugendalters, jedoch manifestieren sie sich vorwiegend auf der seelischen Ebene. Näheres hierzu in Kap. 9.
Behinderungen: Auf Behinderungen im Kindes- und Jugendalter wird in den folgenden Kapiteln detailliert eingegangen. Als exemplarische Beispiele werden u. a. Autismus und geistige Behinderung beschrieben.
Parasitäre Erkrankungen: Für die Pädagogik sind parasitäre Krankheiten insofern von einer gewissen Bedeutung, als sie einerseits epidemiologisch, andererseits hinsichtlich ihrer psychosozialen Stigmatisierung belastend sein können.

So können beispielsweise Juckreiz, zerkratzte Stellen und weiß anhaftende Strukturen an den Haaren Hinweise auf einen Befall mit Kopfläusen sein. In einem solchen Fall müssen nicht nur die Haare hinsichtlich des Befalls mit Läusen, sondern auch der Nissen, der oft fest anhaftenden Eier behandelt werden.
Читать дальше