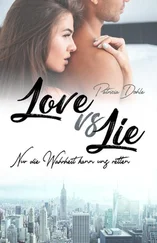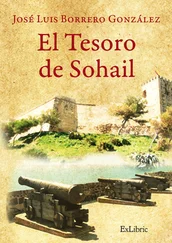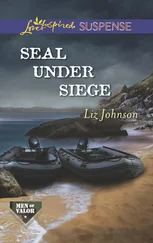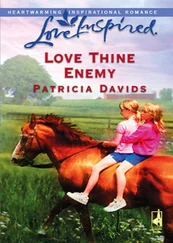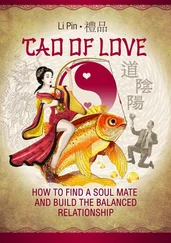***
Ich hatte drei Tage Zeit bis zum Wochenende, wo ich bei Marc sein wollte. Ich packte meine Sachen, fuhr in Omas Haus, das ja jetzt eigentlich mir gehörte, wo ich aber noch nicht leben konnte, weil ich mich zu einsam fühlte. Aber jetzt, für die drei Tage, war es genau richtig, um Abstand zu gewinnen und über mein Leben nachzudenken, darüber, wie alles überhaupt so weit kommen konnte. Ich kaufte mir noch was zu essen ein und eine CD von Rihanna, etwas, was mich nicht an Nadim erinnerte.
Ich fing an, meine Vergangenheit auszugraben und die unvergessenen Augenblicke zu ordnen. Ich wurde schon als Neunjährige mit dem Tod konfrontiert, als mein kleiner Bruder mit vier Jahren an Leukämie starb. Wir konnten seinen Tod nicht aufhalten. Diese Sicherheit und Geborgenheit, die ich als Kind verspürt hatte, ging mit ihm verloren. Auf einmal war nichts mehr sicher, außer der Tod. Mein Dasein selbst wurde zu einer Gratwanderung zwischen Leben und Tod. Meine Mutter wurde zunehmend kälter. Sie befand sich monatelang in einem Schockzustand, zu dem ich keinen Zugang hatte. Mein Vater verdrängte es durch seine Abwesenheit. Die Einzige, die mich auffing, war Oma. Mein Wachsengel hatte meine Bitte erhört. Ich durfte zu ihr, weg von all dem Dilemma, das meine kindliche Welt verdunkelte. Bei Oma konnte ich wieder Geborgenheit finden und fast alles vergessen. Nach einem Jahr sollte ich wieder nach Hause zurück, weil ich in eine andere Schule musste. Meine Eltern zogen in ein anderes Viertel, das viel zu weit weg von Oma war. Zu Hause hatte ich die Hölle auf Erden. Mein Vater trank immer mehr, und meine Mutter ließ ihre Unzufriedenheit an mir aus. Erst in den großen Sommerferien durfte ich wieder zu Oma. Am letzten Schultag stand Oma auf der anderen Straßenseite, und als ich sie sah, ging endlich die Sonne wieder auf. Voller Freude wollte ich zu ihr hinüberlaufen, und dabei erfasste mich ein Auto, das um die Kurve kam. Es war zum Glück nicht schnell dran gewesen. Ich stürzte auf die Straße, und als ich die Augen aufmachte, sah ich Omas entsetztes Gesicht, ein paar andere entsetzte Gesichter und ein seltsames Licht, das mich so faszinierte, dass ich noch eine Weile länger liegen geblieben wäre, wenn der Schmerz meines Beines nicht stärker gewesen wäre. Ich stand mit dem anderen Bein auf und hielt mich an Oma fest. Die anderen Leute wollten einen Arzt holen, aber ich wollte nur nach Hause. Meine Oma meinte, dass ich einen Schutzengel gehabt hätte. Mein Bein war zum Glück nur geprellt. Ich war wirklich froh, dass ich noch lebte, und es gab wieder Augenblicke, in denen ich wieder glücklich war. Ich wusste aber auch, dass meine Kindheit zu Ende war, denn ich kannte auch die Schattenseite des Lebens, die zu meinem ständigen Begleiter wurde. Gott war für mich gut und böse, er war Leben und Tod, er war gütig und grausam, Licht und Schatten, Liebe und Hass, Belohnung und Bestrafung. Er war alles in einem. Er war das Schicksal und die Prüfung. Wir konnten es leben, mit Glaube, Hoffnung, Kraft und Liebe oder mit Hader, Wut, Zweifel, Hass und Neid, denn alles war in uns. Das war unser freier Wille, unsere Entscheidung. Wir konnten das Beste oder Schlechteste daraus machen. Wir konnten das Schicksal aber auch durch unsere Taten, Gedanken und Worte herausfordern. Viele hofften oft auf die Gnade Gottes, und ich fand, dass er oft gnadenlos war, auch wenn er Gnade erweisen konnte. Er war unser Ebenbild oder umgekehrt, nur in der höchsten Instanz. Er war der große Gott, der unser Leben bestimmte, und wir die kleinen Götter, die mitbestimmen konnten. Gott wirkte durch uns. Wenn man betete, konnte man sich seine Liebe zugänglich machen, aber manchmal nutzte auch das Beten nichts, weil er anders entschieden hatte. Ich dachte immer, dass das Gute siegen müsste, dass dies Gerechtigkeit war, bis Nico, mein Bruder, starb. Er war gut, jung und unschuldig. Wieso konnte stattdessen nicht irgendein ein alter, böser Mensch sterben, ein Mensch, der es verdient hatte? Gott war nicht gerecht, er konnte ziemlich hart sein. Meine Oma sagte immer, dass alles irgendwie einen Sinn hätte. Ich fand, dass das Leben ein unsinniges Geschenk war, aus dem man vielleicht einen Sinn machen konnte. Mancher hatte mehr, mancher weniger Zeit, aber der Sinn oder Unsinn lag nicht in der Zeit, sondern in dem, was wir daraus schöpften, lernten oder hinterließen. Die Zeit war relativ. Nur der Augenblick zählte, er entschied über Glück oder Unglück. Wenn ich das Glück fühlte, dann war es, wie wenn der Himmel die Erde berührte.
In den Ferien bei Oma war ich glücklich. Wenn ich dort im Mohnblumenfeld lag und vor mich hin träumte, war ich glücklich. Wenn ich barfuß bei Regen in der Wiese laufen konnte, war ich glücklich. Wenn Oma von Opa erzählte, der auch viel zu früh gestorben war, oder wenn Omas Haus nach Apfelstrudel roch und damit sogar eine schlechte Schulnote vertreiben konnte oder wenn mein Hund Sammy, den ich von Oma bekommen hatte, über die Felder lief, dann war ich glücklich. Wenn ich Nadim sehen durfte, dann war ich glücklich. Er war Perser und war mit vierzehn Jahren nach Deutschland gezogen, weil seine Eltern hier Asyl hatten. Er hatte schwarze Haare, war einen Kopf größer als ich und hatte dunkelbraune Augen. Sein Akzent verzauberte mich. Am Anfang dachte ich mir, was will der von mir? Er schrieb mir immer Gedichte und war sehr hartnäckig. Er ging in meine Parallelklasse, war ein Jahr älter als ich, und er mochte mich, trotz meiner dicken Brille. Ich war weitsichtig und musste diese dicken Gläser auf meiner Nase tragen. In der Schule nannten sie mich alle Brillenschlange, und ich hatte dadurch wirklich Komplexe bekommen. Manchmal rannte ich auch ohne Brille herum, aber dann stolperte ich immer über alles. Jeden Tag wünschte ich mir, wieder richtig sehen zu können, aber Gott tat mir den Gefallen nicht. Nadim meinte, dass ein schönes Gesicht nichts entstellen könnte, und verteidigte mich immer vor den anderen. Er wohnte nicht weit von uns weg, und wir spielten immer mit den Nachbarskindern Völkerball. Einmal fing er mich auf, als ich fast hingefallen wäre, weil ich den Ball unbedingt fangen wollte, und mein Herz machte Purzelbäume. Er hatte das schönste Lächeln, das ich kannte. Wir verbrachten jede freie Minute miteinander. Ab und zu schnupperten wir Großstadtluft, die eine halbe Stunde S-Bahn-Fahrt entfernt war. Unser Geheimtreff war ein kleiner Baggersee, zwei Stationen von unserer Stadt entfernt, wo wir oft badeten. Er war am Anfang oft bei mir, aber ich durfte nie zu ihm mit, denn seine Eltern mochten mich nicht. Nur einmal war ich bei ihm, einen Tag nach meinem vierzehnten Geburtstag, weil seine Eltern nicht da waren und seine Schwester auch nicht, denn die hätte uns verraten. Sie wollten erst am Abend kommen, aber sie kamen früher. Nadim und ich standen im Wohnzimmer, und er küsste mich das erste Mal. Ich war gefangen. Ich ließ mich fallen, und er fing mich auf. Er war wie Nektar für meine hungrige Seele. In seiner Nähe fühlte ich mich sicher. Es kam mir vor wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Ich hatte meinen Prinzen gefunden, mit dem ich immer zusammen sein wollte. Wir waren so versunken, dass wir gar nicht hörten, dass seine Eltern gekommen waren. Sie standen auf einmal da, als hätten sie sich hergebeamt. Seine Mutter schimpfte und sah mich an, als wäre ich eine Hure, die ihren Sohn verdarb. Ihr Gesicht war richtig hasserfüllt. Ich verließ gleich fluchtartig das Haus und rannte nach Hause, wie von bissigen Hunden gehetzt.
Meine Mutter fand es auch nicht mehr so gut, dass ich mich mit ihm traf. Sie meinte zuerst, dass er nur ein Schulfreund wäre, der mir beim Lernen half, aber dann spürte sie doch, dass mehr dahintersteckte. Sie beobachtete, wie er mich küsste, als er ging, und verbot, dass er zu mir kam. Sie meinte, dass er mir nicht guttäte und ich durch ihn die Schule vernachlässigte; außerdem wäre ich ein paarmal zu spät nach Hause gekommen. Die Kulturunterschiede wären auch zu groß, und er würde mich nur unglücklich machen, weil es keine Zukunft hätte. Außerdem hätte sie noch Angst, dass ich schwanger würde. Ich versuchte, ihr zu erklären, dass er anders war, aber sie blieb hart und meinte, dass ich ihr das nicht antun solle. Ich würde schon wieder einen anderen finden und hätte ja noch Zeit. Sie machte mir auch noch Schuldgefühle. Ich fuhr zu Oma und erzählte es ihr. Sie meinte, dass sich meine Mutter nur Sorgen machte, aber sie meinte auch, dass man gegen die Liebe nichts machen könne, man könne sie nicht einfach auslöschen. Wo die Liebe hinfällt, meinte sie. Womit sie recht hatte. Ich wollte diese Liebe auch gar nicht auslöschen. Wir sahen uns zwar nicht mehr so oft, und wenn, dann mussten unsere Freunde für ein Alibi herhalten. Aber an unseren Gefühlen änderte sich nichts, und wir genossen jeden Augenblick.
Читать дальше



![Serg Aill&Lex Lux - Идефикс. Жажда силы [СИ]](/books/422633/serg-aill-lex-lux-idefiks-zhazhda-sily-si-thumb.webp)