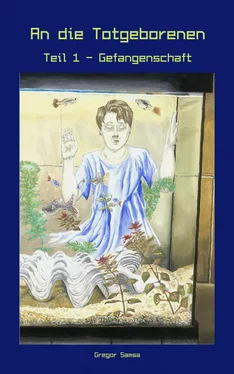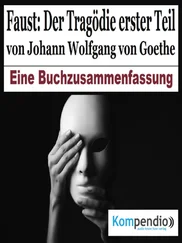Endlich hatte ich den letzten Wagen hinter mir gelassen. Ich lief, so schnell ich konnte, immer die Schienen entlang. Nach einer Stunde gelangte ich an die Schlucht. Doch wo war die Brücke? Unmittelbar vor dem Abgrund endete das Gleis. Auf der anderen Seite konnte ich keine Fortsetzung bemerken. Ich schaute hinab. Es war kein Grund zu sehen. Der Canyon schien bodenlos zu sein. Steil fielen die Abhänge in die Tiefe. Ich sah, dass sich hier nie eine Brücke befunden hatte. Vielleicht war einmal eine geplant gewesen – die Schienen führten ja bis zum Rand – doch zur Ausführung war es nie gekommen. Wie waren wir bloß herübergekommen? Wir konnten nie diese Kluft überquert haben.
Ich fand mich nicht mehr zurecht. Die zurückliegenden Stunden kamen mir wie ein Märchen vor. Jetzt jedenfalls war die Schlucht ein unüberwindliches Hindernis.
Ich kehrte um. Der Rückweg schien viel kürzer zu sein. Nach wenigen Minuten kam der Zug wieder in Sicht. Ich erschrak. Etwas Unheimliches musste mit ihm während meiner Abwesenheit geschehen sein. Es war, als wäre ein versehrendes Feuer über ihn hinweggefahren. Die Scheiben waren zersprungen. Die Farbe war größtenteils abgeplatzt. Große Rostflecken überzogen die Wagen.
Ich stieg in mein Abteil. Eisgraue, steinalte Gesichter starrten mir entgegen. Oh Gott, wie viele Jahre bin ich weg gewesen? Und mir schien es, als wären nur Stunden verflossen. Ich wische den Staub weg und setze mich auf meinen Platz.
„Wie lange wir schon stehen“, meint der eine uralte Soldat mit dem schlohweißen Haar, „immer diese Baustellen.“
Ein zittriger Greis öffnet die Tür. Ich erkenne in ihm den Schaffner wieder. „In zehn Minuten fahren wir weiter“, sagt er mit bebender Stimme und wackelt bedenklich mit dem Kopf.
Ich versuche zu schlafen. Ich habe Angst, wieder vom Zuge wegzugehen. Vielleicht würde ich bei meiner Rückkehr nur noch Skelette vorfinden. Und wohin sollte ich auch gehen? So sitze ich mit den anderen und warte. Ich warte, und höchstens der Umstand beunruhigt mich ein wenig, dass ich der Einzige bin, der weiß, dass dieses Warten hoffnungslos ist.
Sie wussten, dass nichts mehr sie retten konnte. Reglos lag ihr U-Boot in 80 m Tiefe wie ein sterbender Fisch, während über ihnen das Dröhnen der Dieselmotoren immer mehr anschwoll. Systematisch suchten die feindlichen Kriegsschiffe das Gebiet mit ihren Radargeräten ab. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wann sie ihr Opfer entdeckt haben würden. Flucht wäre sinnlos gewesen. Das Motorengeräusch hätte sie sofort den gegnerischen Horchposten verraten. So konnten sie nur noch auf ein Wunder hoffen – ein Versagen eines Gerätes oder die Unaufmerksamkeit eines Beobachters – doch all ihre Erfahrung sagte ihnen das Gegenteil. Sie befanden sich in einem erbarmungslosen Krieg, der Gegner würde sich keine Schwäche leisten.
Diszipliniert nahmen sie ihre aussichtslose Situation hin. Sie hatten gewusst, dass einmal dieser Tag kommen würde – das war einkalkuliert, das war ihr Risiko, gehörte mit zu ihrem Handwerk. Tausenden Menschen hatten ihre Torpedos Verderben gebracht, nun waren sie selbst an der Reihe. Ohne Wimpernzucken würden sie heute den Heldentod sterben für ihr Vaterland, das irgendwo weit in der Ferne lag.
Da fielen die ersten Wasserbomben. Das Unvermeidliche nahm seinen Lauf. Ihr Fahrzeug wurde von den Detonationen hin und her geschleudert wie von den Fangarmen eines gigantischen Kraken, der seine Beute nicht mehr fahren lässt. Eine heftige Explosion riss den Rumpf mitten entzwei und ließ die Wrackteile in die Tiefe stürzen.
Sie sanken in unermessliche Abgründe. Das Licht im Inneren war erloschen. Und draußen umtanzten märchenhaft leuchtende Wesen erstaunt das eiserne Ungetüm, das in ihre schweigende Welt eindrang. War das schon der Tod? Wie oft hatten sich die Männer diesen Augenblick auszumalen versucht, doch ihre Fantasie hatte nicht ausgereicht. Zwar hatten sie sich ständig mit der Tatsache vertraut gemacht, einem Himmelfahrtskommando anzugehören, zwar hatten sie immer wieder erlebt, wie viele U-Boote nicht mehr vom Einsatz zurückkamen, doch der Gedanke, jetzt sterben zu müssen, überstieg alle Vorstellungskraft.
In diesem Moment flammte fahles Licht auf. Der Maat hatte das Notstromaggregat in Gang gebracht. Für Sekunden erblickten sie die Furcht in ihren bleichen Gesichtern, dann rissen sie sich zusammen. Auch jetzt noch waren sie Soldaten. Der sorgfältig ausgearbeitete Katastrophenplan trat in Kraft. Als Erstes galt es, sich Klarheit über die Situation zu verschaffen. Fünf Mann waren sie im Mannschaftsraum, wo der Alarm sie während der Freizeit in ihren Kojen überrascht hatte. Um sie herum war ein Gewirr von zertrümmerten Geräten und aus der Halterung gerissenen Gegenständen.
Der Maat stieg über einen Torpedo hinweg, der sich aus der Laufkatze an der Decke gerissen hatte und jetzt nutzlos im Raum herumlag, und klopfte mit einem Hammer die hintere Trennwand ab. War hinter ihr noch Leben? Vergeblich lauschten sie nach einer Antwort der anderen. Nur das Echo der eigenen Schläge klang ihnen schauerlich hohl entgegen. Sie waren allein, die einzigen Überlebenden der Katastrophe. Da erst wurde ihnen bewusst, dass sie verloren waren. Sie waren nüchtern genug, ihre Lage einzuschätzen.
Sie waren versunken, irgendwo tief in der ungeheuren Weite des Atlantischen Ozeans, von wo es keine Rettung mehr gab. Im Einsatzstab würde man ihr Boot auf die Verlustliste setzen und eine kurze Mitteilung an ihre Angehörigen verschicken, während andere U-Boote ihre Aufgabe fortsetzen würden.
Der Maat gab den Befehl, den engen Raum, in dem man nicht einmal richtig aufrecht stehen konnte, notdürftig in Ordnung zu bringen. Er wusste aus Erfahrung, dass Beschäftigung das beste Mittel gegen Panik war. Er war jetzt der Ranghöchste an Bord, auf ihm ruhte die schwere Verantwortung. Zum Glück war er mit zuverlässigen Leuten zusammen. Sie kannten sich von vielen Einsätzen und hatten gemeinsam mehr als eine brenzlige Situation gemeistert. Er wusste, dass er sich auf jeden Einzelnen verlassen konnte. Ihre Aufgabe war es jetzt nur noch, in Haltung zu sterben – ein anständiger Soldatentod, ihres Vaterlandes würdig.
Sie dachten an die Angehörigen in der Heimat, die sie nicht mehr wiedersehen würden. Sie beschlossen, Abschiedsbriefe zu schreiben. Der Maat verteilte Schreibpapier, das er zufällig in seiner Mappe hatte. Sie hockten sich in ihre Kojen und starrten die weißen Bogen an. Alles, was sie mitteilen wollten, war so bedeutungslos. Niemand würde ihre Zeilen finden. So blieben die Blätter leer.
Später spielten sie Karten, aber es machte keinen Spaß. Ihre Einsätze waren unsinnig hoch, doch wem nützte der Gewinn. Sie bereiteten sich Speisen aus Konserven. Sie wollten sich noch einmal etwas Gutes leisten, doch ihre Kehlen waren wie zugeschnürt. Sie würgten ein paar Bissen hinunter und ließen den Rest stehen. Wozu sollten sie essen – bevor sie verhungerten, wären sie längst erstickt.
Der Maat öffnete eine Pressluftflasche und ließ die zusätzliche Luft in den kleinen Raum strömen. Schmerzhaft stach der Druck in ihre Schläfen. Um ihre Augen tanzten feurige Kreise. Sie wussten, dass das Sterben nicht einfach werden würde. Sie dachten an die anderen. Die hatten jetzt schon alles hinter sich.
Schweigend saßen sie da. Der Maat versuchte, ein Gespräch zu beginnen, doch ihm fiel nichts ein. Worte waren überflüssig geworden. Gefasst sahen sie ihrem Ende entgegen. Der Maat war innerlich zufrieden. Niemand hatte in der gewiss nicht einfachen Situation die Nerven verloren. Es herrschte eine bewundernswürdige Disziplin. Sie waren eine verschworene Gemeinschaft, Kameradschaft und Treue waren ihre höchsten Tugenden. Das war ihre Überlegenheit. Der Feind wäre in ähnlicher Lage schon längst demoralisiert, hätte sich in sinnloser Angst in einem mörderischen Kampf um jeden Atemzug Luft gegenseitig abgeschlachtet. Wie turmhoch standen sie über solchen Gedanken. Gemeinsam würden sie sterben, wie sie gemeinsam gekämpft hatten. Ihre überlegene Moral war es, die ihnen den Endsieg bringen würde. Darin lag der Sinn ihres Todes.
Читать дальше