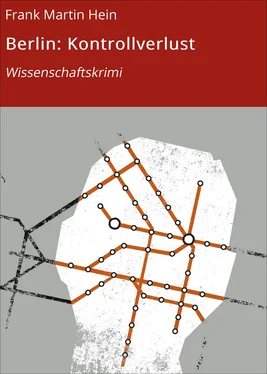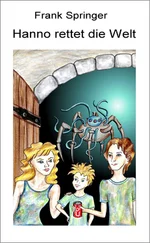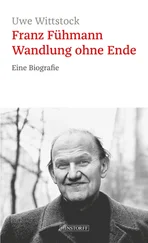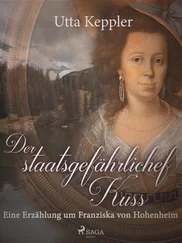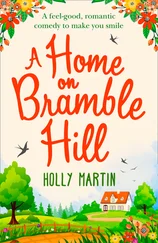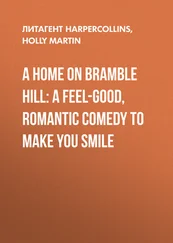Lommel pausierte nur kurz und legte dann noch einmal zu, um seinen Vortrag zu Ende zu bringen, bevor die Aufmerksamkeit im Raum nachließ: „Zwei Fragen folgen: Erstens, was machen Menschen, wenn es noch weniger Begrenzungen gibt? Weder physische, noch geografische oder moralische, ja, wenn sogar die rechtliche Haftung für Handlungen nicht mehr existiert? Was machen die Menschen, wenn sie eine andere Person wie – wie … ihren Avatar mit der Maus durch die Gegend schubsen können – das aber in echt? Und zweitens, wie freiwillig ordnen die Menschen ihren freien Willen einer anderen Person unter – wenn es eigentlich keinen großen Unterschied mehr macht, was du selbst willst? Weil ja – ohne echte Grenzen – sowieso alles möglich ist, und austauschbar?“
An diesem Punkt kam Peter auf die Frage der Hypothese zurück: „O. K., gute Analyse, Michael. Aber was willst du denn nun eigentlich beweisen?“
Michael richtete sich auf, als ob die anderen nicht sowieso an seinen Lippen hingen. „Also, ich glaube, erstens, dass den meisten Menschen klar ist, dass sie es eh nicht schaffen, bei dem, was ich Celebrity-Benchmark genannt habe, zu bestehen. Sie vergleichen ihr Leben mit dem von anderen, arbeiten hart an ihren Zielen, schaffen es aber nicht, irgendwie besser oder was Besonderes zu werden. Daher fühlen sie sich schlecht und geben auf. Deswegen, zweitens, sind die Menschen jetzt wieder offener dafür, gesagt zu bekommen, was sie tun sollen. Sie glauben daran, dass ihr Leben durch Dritte aufregender, bedeutsamer wird, als sie es selbst hinbekämen. Die anderen bringen sie dazu, Sachen zu machen, die sie sich selbst nie trauen würden. Das ist ihre Hoffnung. Aber, drittens, es wird nichts Besonderes passieren. Die meisten Menschen werden nicht über die Stränge schlagen, wenn sie anderen ihren Willen aufzwängen dürfen. Sie werden nichts wirklich Übles verlangen, auch wenn sie Druck ausüben können. Anders ausgedrückt: Ich bin überzeugt, dass ihre Lebenspläne und Optionen mehr durch ihre inhärenten Limits als durch externe Faktoren und Regeln begrenzt werden.“
„Das ist aber eine sehr pessimistische Sichtweise“, brach es aus Petra heraus. „Wir können alles erreichen, wenn wir nur wollen.“ Sie war überzeugt, sie könne alles erreichen. „Also meiner Meinung nach wird diese Idee, egal, wie sie denn nun letztendlich realisiert wird – was ja nun doch noch ziemlich unklar ist, wenigstens mir –, schnell kommerzialisiert werden. Und in der populären Kultur aufgehen. Im Mainstream sozusagen“, kommentierte Luc.
„Na ja, Petra, da bin ich dann aber nicht so sicher“, erwiderte Lommel. „Unser ,freier Wille‘ gibt uns doch eh nur eine eingeschränkte Auswahl. Klar, wir glauben, dass das Gras bei Nachbars grüner ist und dass die Kirschen süßer schmecken. Aber wer macht sich denn schon die Mühe, dafür über den Zaun zu klettern? Viele Leute bringen nicht mal die Energie auf, sich nach dem zu bücken, was quasi vor ihren Füßen liegt. Im Grunde genommen verteidigen die meisten ihr limitiertes Repertoire an Ideen – und ignorieren damit ihre tatsächlichen Möglichkeiten – selbst wenn Alternativen ohne große Mühen zu erreichen wären!“
„Bis auf solche, die es darauf anlegen, ihren Kurs zu ändern“, fügte Batch an.
„Genau, die ausgenommen. Wandel wird von vielen erträumt, aber von noch mehr Menschen gefürchtet, oder gar als real erreichbar betrachtet. Ein kleines bisschen freien Willen aufzugeben, nur zeitweise, wohlverstanden, kann das Tor zu Nachbars Garten öffnen. Und dafür wird nicht einmal eigene Energie fällig! Das ist doch eine tolle Perspektive! Alles kann dem passieren, der nur die Kontrolle über sich selbst eine Weile abgibt“, sagte Lommel und fuhr gleich fort: „Also noch mal, zwei Sachen werden in unserem Experiment passieren: Erstens, die Muster, die der Person entsprechen, die bei Milgram der ,Lehrer‘ war, werden sich insgesamt nicht wesentlich von ihrem üblichen Verhalten unterscheiden. Dass hier brave Bürger Revolutionen anzetteln, glaube ich halt nicht. Zweitens, und das ist vielleicht mutiger als Annahme, meine ich, dass die Menschen darauf scharf sind, von anderen geführt zu werden – also die Rolle des Schülers oder ‚Agens‘ einzunehmen. Liegt nicht auch ein Reiz darin, zugegebener Weise ein bizarrer, den eigenen Willen aufzugeben? Und ach ja, ehe ich es vergesse: Wir werden, anders als Milgram, natürlich keine Schauspieler für die Rolle der Schüler einsetzen.“
„Doc, das ist jetzt aber wirklich sehr pessimistisch“, beklagte sich Petra noch mal. Lommels Ansichten verletzten ihr idealistisches Menschenbild nicht nur. Sie stellten es komplett infrage. Sie respektierte Lommel viel zu sehr, um das einfach ignorieren zu können.
„Das werden wir schon sehen, Petra“, antwortete der leichthin. „Freiheit ist relativ. Manchen ist sie eine Last. Manchmal ist sie uns eine Last. Und für uns – als Wissenschaftler – kann es sehr aufschlussreich sein zu sehen, bei was – und bei welcher elektrischen Spannung – die Menschen nicht mehr mitmachen und sich verweigern.“
„O. K. Langsam würde ich doch gerne mal hören, wie du dieses Projekt konkret organisieren willst. Bis jetzt haben wir nur viele philosophische Blasen aufsteigen sehen“, meckerte Luc. „Na ja, bis auf den Punkt, dass es bei uns echt elektrische Schocks geben soll“, sagte Peter. „Wenn die andere Person ihn erteilt“, dachte Batch gut vernehmlich voraus. Und damit war Luc schon wieder bei seinem Thema – eben wie das alles funktionieren sollte: „Peter, wir haben keine Details wie diese elektrischen Schläge bisher besprochen. Rien! Wir haben nichts über den Versuchsaufbau gesagt. Keine Begriffe definiert, keine Spannungen, nichts über die Steuerung der Kandidaten, Datenaufzeichnung, noch nicht einmal, welche Parameter wir überhaupt aufzeichnen oder fixieren wollen. Et en plus …“
Luc war erregt. Lommel ignorierte den negativen Unterton. Er freute sich über die lebhafte Diskussion, blätterte zu einer freien Seite des Flipcharts und schrieb in großen Blockbuchstaben: SETUP.
„Luc, du hast völlig Recht. Lass uns das doch jetzt schrittweise versuchen. Ich mache mal den Anfang. Also zum Beispiel brauchen wir eine Konsole für die Rolle, die Milgrams Lehrer entspricht“, sagte Lommel und schrieb den Begriff gleich auf. „Die Konsole wird aber nur eine Internet-Anwendung“, warf Peter ein, „zumindest an ihrem Front-End, wenn ich dich richtig verstehe.“ „Das stimmt. Zweitens also brauchen wir eine Internet-Anwendung.“ „Und dabei sollten die Aufzeichnung und die Statistikprogramme gleich integriert werden, sodass wir die Daten als einen Satz zusammen in unsere SPSS weiterleiten können.“ Wie nicht anders zu erwarten, kam dieser Hinweis von Luc. Lommel vermerkte die Punkte unter drei und vier. „Einen Plan, also einen Terminplan, wer wann was macht und so …“, merkte Petra an. „Und dann sollten wir die Studenten randomisiert in Versuchspaarungen kombinieren …“ „Sehr gut, Petra, das ist Punkt fünf. Um jetzt auch mal über die Empfängerseite zu sprechen: Wenn also die Kommandos – ich nenne sie lieber Direktiven – von den ‚Lehrern‘ erteilt und via Internet verteilt werden, dann brauchen wir auch passende Empfänger, Punkt sechs. Nur so kommen sie ja bei den ‚Schülern‘ an. Und das ist nicht ganz trivial“, vermerkte Lommel.
Batch war anderer Ansicht: „Lommel, so schwer ist es nun auch nicht. Schlag mal eine neue Seite auf. Hier sind die Kriterien, auf die es ankommt: Erstens können wir natürlich keinen elektrischen Stuhl gebrauchen, damit läuft niemand herum. Das Ding muss leicht sein, tragbar und nicht auffallen. Ultimativ sollte es einfach aussehen wie ein Smartphone, oder? Zweitens, anders als bei Milgram, können wir natürlich keine Kupferkabel mit dem Teil verbinden. Wir brauchen die totale Mobilität – wenigstens in einem gewissen Umkreis. Ja, und drittens brauchen wir natürlich eine Zwei-Wege-Übertragung. Direktiven hin, Signale zum ‚Lehrer‘ zurück, Feedback, was passiert, eben.“
Читать дальше