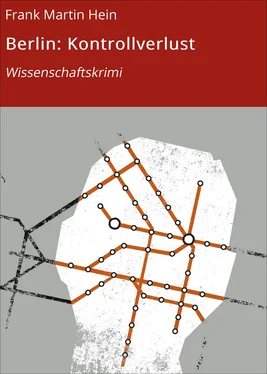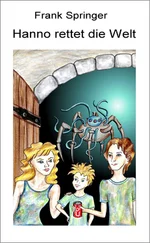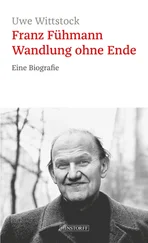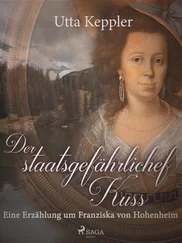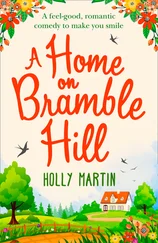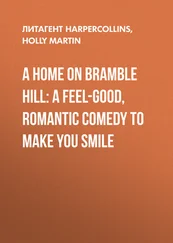Draußen schlug die Tür. Jemand betrat die Nachbarkabine. ‚Jetzt zünde einen Böller an und wirf ihn rüber.‘ Maria schaute ungläubig die grobschlächtige Zeichnung eines erigierten Penis an, als der Schmerz zwischen ihren Ohren erneut spürbar wurde, stärker denn je. ‚Verdammte Trantüte. Jetzt mach, die Zeit läuft uns weg!‘ Als das Gefühl in ihren Ohrmuscheln gerade wiederkam, riss sich Maria die Stöpsel heraus, schmiss die Böller in die Toilettenschüssel und zog die Spülung. Ohne sich die Kamera vom Hals zu nehmen, stürmte sie aus der Herrentoilette und rannte in die Cafeteria, wo sie sich für später mit einer Freundin verabredet hatte. Als sie dort ankam, merkte sie, dass sie die Wasserpistole noch immer fest umklammert hielt. Ihre Hand schmerzte und die tropfende Feuchtigkeit brannte auf ihrer Haut. Sie schaute auf ihre Finger. „Por lo que un cerdo pervertido!“
Batch ignorierte die Beschreibung der Arbeiten Milgrams komplett, blieb einfach sitzen und schaute in die Luft. Ein gutes Zeichen, dachte Lommel, sagte aber nichts. Falls Batch das Projekt abgelehnt hätte, wäre der Stuhl bereits leer. Mit normalen Maßstäben war Batch sowieso nicht zu messen. Für die meisten im Institut war Batch bestenfalls ein Rätsel, wenn nicht ein Geist, viel beschworen und nie gesehen. Niemand kannte Batchs Alter. Niemand war hier im Gebäude angestellt, der noch vor Batch gekommen wäre. Batch war schon immer da. Batch passte in keine Konventionen, was Bekleidung betraf (wenn Batch gesehen wurde, dann meistens in einem unauffälligen, alten grauen Mao-Anzug), was den Haarschnitt anbelangte (auf der einen Seite kurz, zwischen grau und rot changierend), bei der Hygiene (fragwürdig nach einigen Berichten, aber einwandfrei zurzeit), bei den Antwortzeiten (oft quälend lang), dem Sozialverhalten (keines beobachtet), dem Spezialgebiet (keines bekannt), den akademischen Pflichten (keine dokumentiert), dem Wissen (Gerüchten zufolge praktisch grenzenlos), bei den Gewohnheiten und Stundenplänen (sie blieben nebulös – Batch war da, oder eben nicht). Schließlich aber, und das war besonders irritierend, kannte niemand Batchs Geschlecht. Kurz: Batch hatte den Status eines Faktotums ohne jede erkennbar Funktion. Was diese einmal gewesen sein könnte, darüber gingen die Meinungen auseinander: Einige hielten diese magere, bizarre Person für ein kommunistisches Überbleibsel, einen Abkömmling Honeckers vielleicht. Andere vermuteten einen ehemaligen Ingenieur vom Hausdienst, mehr ignoriert als toleriert. Und einige glaubten, Batch wäre bei einem Experiment übrig geblieben, das vor Jahrzehnten begonnen wurde, aber nie offiziell beendet. Legenden gab es viele, aber noch nie eine Besprechung, zu der Batch kam und blieb. Lommel schloss das Fenster und begann Phase zwei seiner Sitzung.
„Also. Bevor es weiter geht: Vergesst bitte nicht, dass wir Vertraulichkeit vereinbart haben. Wir haben dazu das Standard-Formular der Uni auf jedem Platz verteilt. Dürfte ich euch bitten, jetzt den Raum zu verlassen, wenn ihr nicht bereit seid, es zu unterschreiben?“ Lommel machte eine Pause. Peter und Petra unterschrieben sofort und ohne nachzudenken. Luc schüttelte nur kurz den Kopf, überflog den Text und unterschrieb auch. Petra sammelte die Zettel ein, aber vermied jeden Blick auf Batch. Es war ihre erste Begegnung.
„Ich danke euch. Ich weiß, das ist ungewöhnlich, aber das ist auch unser Plan. Und weil das so ist, dachte ich mir, wir sammeln erst mal eure Fragen hier auf dem Flipchart.“
Peter schoss als Erster los: „Was nehmen wir als elektrischen Stuhl?“ „Müssen wir die Teilnehmer zu ethischem Benehmen verpflichten?“, fragte Petra. „Cyber-Existentialismus. Sartre reloaded. In Frankreich längst durch“, bemerkte Luc. „Ist das eigentlich rechtens, also ich meine, legal?“, fragte Peter. „Mich erinnert das an den Minority Report“, sagte Luc. Lommel kam kaum mit dem Notieren nach. „Was ist das?“, fragte Petra und verschaffte ihm so etwas Zeit. „Ein Spielfilm von Spielberg mit Tom Cruise. Basiert auf einer Story von Philip K. Dick von 1956. Determinismus und persönliche Verantwortung sind zentrale Konzepte. Ach ja, übrigens: Die Idee verweist auch auf Elemente des Zimbardo-Experiments“, erklärte Luc. „Klar, sein Aufsatz von 1971 zu den Versuchen ist schon im Ordner, Luc, keine Sorge. Aber wir sollten auch an die praktischen Aspekte denken. Wir brauchen Kandidaten, Schauspieler, Räume. Und eine Arbeitsteilung.“ Petra schaute sich im Raum um. „Also, wenn du den Versuchsaufbau meinst, dann stimme ich dir zu“, sagte Peter.
Dann fing Batch zum ersten Mal an zu sprechen. Die Stimme klang etwas gequält, so wie nie benutzt: „Guter Punkt, junger Mann. Aber jetzt zu dir, Lommel. Du hast dir doch sicher schon überlegt, wie das Projekt laufen soll, oder? Sonst hättest du uns nicht gerufen. Wie also? Was hast du vor? Willst du nur die Milgram-Simulation von Mel Slater an dem Virtual Reality Centre der Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya und dem Department of Computer Science des University College London von 2006 kopieren? Dann muss niemand hier diesen Vertraulichkeitszettel ausfüllen …“
Noch bevor Lommel überhaupt antworten konnte, meldete sich Luc. Es war unerträglich für ihn, dass dieses undefinierbare Etwas hier schneller zur Sache kam als er selbst. Mit Schärfe im Ton und der strengen methodischen Schulung seines Heimatlandes fragte er: „Alle guten Experimente beziehen sich auf eine Theorie, eine Hypothese, die man überprüfen will. Wieso meinst ausgerechnet du, Michael, du kämst ohne aus? Hast du denn gar keine?“
„O. K., Batch, natürlich geht es mir um was Neues. Also, ich kann das vielleicht so erklären“, sagte Lommel: „Milgram wollte ja zeigen, dass die Amerikaner weniger gehorsam sind als die Nazis in Deutschland. Wie ihr wisst, ist das misslungen. Und genauso erging es seinen Kollegen in diversen Ländern, die seinen Versuch wiederholt haben. Drei Dinge sind heutzutage anders: Erstens, wir leben mit dem mobilen Internet. Zweitens, die Neurobiologen wissen erheblich mehr als zu Milgrams Zeiten. Und drittens sind sich die Menschen in den westlichen Kulturen viel unsicherer darüber, was sie wollen, als vor fünfzig Jahren. Die Nachkriegsagenda – der Kampf gegen Hunger, Armut, Unrecht – abgearbeitet. Das Bedürfnis nach Ethik, Moral, Teilhabe – eingelöst. Dann der kalte Krieg, der Kampf gegen den Kommunismus. In den Sechzigern ging es gegen die Autoritäten, den Terror in Vietnam. Zusammen die ideale Basis für Milgrams Konzepte. Später kam das Internet. Ende der Neunziger haben die Menschen angefangen, damit etwas Neues auszuprobieren: ,Social Media‘. Seitdem stellen Online-Communities und Blogger die Macht infrage, die Informations-Asymmetrien. In einigen Ländern sehen wir das ja bis heute. Teilweise auch schon wieder das Gegenteil, durch neue Autoritäten, neue Kontrolle.
Eine technische Entwicklung nach der anderen hat uns neue Freiheiten beschert: die Befreiung von physikalischen, sozialen, ökonomischen und intellektuellen Einschränkungen. Einmal und für alle Zeit! Zumindest haben wir das gedacht, wenigstens eine Zeit lang. Dann kam die ‚Blase‘, und viele Träume stürzten ein. Erst die ökonomische und dann die soziale Sicherheit waren wieder dahin. Innerhalb einer Generation entgleiste die Planungssicherheit. Und jetzt? Kriege lassen sich nicht mehr gewinnen, sind unberechenbarer denn je. Für jeden getöteten Araber, Terrorist oder nicht, wechseln drei die Seite.“
Lommel kam immer weiter in Fahrt. „Oder die Umwelt. Der globale Umweltschutz macht einen Schritt vorwärts und zwei zurück. Das Private: Scheidungen werden häufiger, der Einfluss der Kirche sinkt. Und so weiter. Im Prinzip ist es trivial: Die Leute haben mehr Auswahl denn je, aber immer weniger ist sicher. Den Menschen fehlt Orientierung. Es gibt kein eigenständiges, allseits akzeptiertes Rollenmodell mehr und keinen allgemein akzeptierten Führer. Um es auf den Punkt zu bringen: Viele Leute haben sich verloren. Aber, aber: Mit den neuen sozialen und den traditionellen Medien zusammen können Menschen sich mit immer mehr anderen Menschen verbinden und diesen folgen. Menschen, die wirklich faszinierende Sachen machen. Faszinierendere als das, was man selbst macht. Sie können Menschen folgen, die mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als sie selbst. Menschen, die besser aussehen und mehr Geld verdienen als sie selbst. Ach ja, dann gibt es noch eine Unzahl von kleinen Vorbildern, die ich Microleader nenne. Jeder von uns kann jemanden im Netz finden, der seine – meine – Sache besser macht. Egal, um was es geht. Es ist wie die Geschichte von Hase und Igel: Egal, was ich mache, jemand anderes war schon da. Ein Klick im Netz – und du weißt, wer dich in deiner Ambition schlägt. Wer origineller ist, mehr Regeln verletzt. Wer schlauer ist, mutiger oder noch öffentlicher agiert. Schlicht: Wer deine Sache besser macht als du. Diese kombinierte Medienkraft schafft einen Celebrity-Benchmark für unser tägliches Leben. Einen Maßstab, den kaum jemand übertreffen kann. Und natürlich wird das alles beinahe live übertragen, von Twitter und Facebook und YouTube wird es zur nie endenden Show. Und die Leute schauen zu, folgen. Täglich. Zu Tausenden. Die neuen Gurus sind im Netz. Sie werden gesehen, verlinkt, geforwarded und wieder verlinkt. Es ist eine Massenbewegung, vielleicht eine Hysterie. Wenn ich ehrlich sein soll: Ich empfinde es als Massenflucht, sogar als populären Massenmasochismus. Wie lange halten Menschen das aus – sich immer kleiner und armseliger zu fühlen als ihr Maßstab im Netz?“
Читать дальше