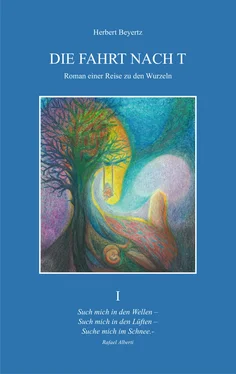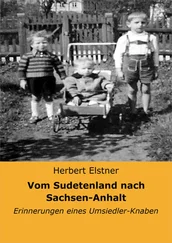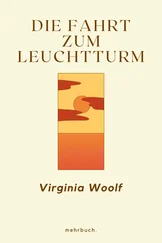Eine Single, Dolphi n Song , Soledad gewidmet, be- gleitete von nun an unseren gemeinsamen Weg.
verlor ihre Fackel nicht: über Nacht konnten Hundert-
tausend Händepaare sich zusammenschliessen. Jeder- zeit, aus der Tiefe der Zeit, „konnten Kräfte in Erscheinung treten, die alle Ordnung umgestalten, um uns von den knechtenden Mächten zu befreien.“
Aber die von Studentenschaften vieler Hochschulen ausgehende Provokation, ihr doktrinäres Gehabe, zog am Ende nur Gräben verschiedener Breite und Unver- söhnlichkeit durch ein ganzes Volk. Man wollte eine
„fleischfressende Pflanze“ in eine honigspendende Blume verwandeln? Stattdessen machte Protest aus Faule-Eier-Werfern Bombenbastler oder versandete in Resignation. Die Droge nahm ihren Siegeslauf.
Underground-Blätter gaben zuweilen die Parolen aus für sich fanatisierende Gruppen und verschwanden mit diesen. Was zunächst noch so frenetisch tönte: „Der Or- gasmus der Revolution ist antizipierbar!“, das lautete wenig später bei demselben Revoluzzer – klammheim- lich natürlich: „Füttere deinen Affen, aber lass mich in Ruh.“
zeugs mit Hilfe arabischer Freunde, in Mogadischu ge-
stellt.
Das ganze Land war über viele Monate in eine At- mosphäre getaucht, schneidender als Novembernebel. Aufgestanden war das Gespenst eines Volkes, dessen Geschichte wie kein anderes von Verrat und Selbstverrat gezeichnet ist. Und so wie Friedrich Hebbel 1848
„bis in den von Bären bevölkerten deutschen Urwald blickte (und ihn zu seinem Nibelungen-Drama inspirie- ren sollte), so blickte man in ein „Deutschland im Herbst“.-
Nach diesem Herbst, und nach einem Heimataufent- halt Soledads am Guadalquivir, machten wir uns auf die Suche nach den so rätselhaft im Vorjahr Verschollenen. Ich hatte ein Motorrad geleast, ein etwas geräumigeres Zelt mit Schlafsäcken auf einem Düsseldorfer Floh- markt erstanden. Unbehelmt (Helme waren damals noch nicht pflichtig) klapperten wir nun dasselbe Land zwischen Maas und Erft, wie zuvor ich allein, ab. Wir wechselten die Campingplätze wie später die unmöbi- lierten Zimmer. In keiner Amtsstube und in keiner Dorf- schenke erfuhren wir irgendetwas das Sinn machte über ihr Verschwinden. Ein pensionierter Postbeamter an einer Theke Kalterherbergs schüttelte nicht als letzter den Kopf:
„Wenn die nu mal keine Sympathisanten gewesen sind, wen kümmern die noch! Zwei Musiker aus Ka- nada, du lieber Gott.“-
Nebel und Graupelschauer tagegelang. An unserm letzten Zeltabend sagte Soledad – und bei ihrem vor- letzten Joint:
„Basta! Die zwei sind längst über den grossen Teich.“
„Meinst du? Wenn deine Delphine bloss keine Lem- minge gewesen sind! Lass doch den Joint, Soli, Liebes, pennen wir.“
„Bitte, erst noch mein kleiner Joint. Dann amor...“- Soledad verliess endgültig Deutschland, als ich, in
ihre Heimat ihr zu folgen, mich nicht entschliessen konnte. Stand aber wenig später im Hegau, im tiefsten Nebelland, vor einem Bildstock und las dem halb ver- witterten Stein einen uralten Wallfahrerspruch ab. Und kam mir endlich selber als so ein Pilger auf dem langen Weg nach Santiago de Compostela vor und zum Meer von Cabo de Finisterre.
Ich war etwas hinter den beiden zurückgeblieben,
hatte mich zum Pinkeln ans Gebüsch gestellt. Eine ei- gentümlich gespannte Ruhe herrschte – wie vor Gewit- tern, anstatt danach wie jetzt. Kein Vogellaut liess sich vernehmen, kein Windhauch regte einen Wipfel. Und da, wieder auf dem Pfad, aber noch einmal innehaltend, um einen Schuhriemen fester zu binden, sah ich aufbli- ckend ihn.
Er stand zwischen zwei Weissdornbüschen, ein deut- lich unter mittelgrosser, doch ausserordentlich kräftiger Mann, gekleidet in etwas wie Bärenfell. Das breite Ge- sicht schuppig ziegelrot, die Stirn mächtig mit selt- samen Höckern. Tieffschwarzes dichtes Haar sträubte sich nach allen Seiten wie dunkle Flammenzungen, seine Augen, klein und tiefliegend, rollten wild in einem tragischen Antlitz. Der Mann schien mit verzweifelten Blicken den Himmel über uns abzusuchen, nahm nur ganz flüchtig, wenn auch beharrlich wiederkehrend, Kenntnis von mir, der ich kaum fünf Meter vor ihm stand. Noch halb gebückt, stand ich gebannt – und den- noch furchtlos! Denn ich wusste (und erinnerte): eine solche Trauer, in welcher ich nur einmal, das war in T, einen Menschen angetroffen, lässt einen nicht um sich selber fürchten.
Plötzlich war er weggetaucht. Man rief mich, Bernd Kuzevow, unser Führer zum Kessler Loch, winkte: „Wir sind gleich da!“
Benommen, stolpernd, müde wie nach kilometerlan- gem Marsch, machte ich mich auf ihre Spur.-
Am Hohentwiel, wieder im Naturfreundehaus, er-
reichte mich die Nachricht von meines Vaters schwerer
Krankheit. Isgard, die mir schrieb:
„Schlafend fanden sie ihn, als Frank mit seiner Toch- ter ihn besuchen wollte. Schlafend brachte man ihn ins Krankenhaus. Ob er noch einmal aufwacht? Die Ärzte halten es für möglich...“
brote… Später Hubert und Karl, Isgard, deine Muhme
war auch dabei, weisst du…“
Die Dame tritt jetzt mit einem Kopfnicken näher, um auf dem Rundtisch vor Jacques unter allerlei Fläschchen und ärztlichem Besteck etwas Ordnung zu schaffen. Der junge Mann stellt nach einem ähnlichen Kopfnicken, das wie abgeschaut wirkt, ein Buch in den Schrank zu- rück und schiebt die Glastüre vor. Ich nicke wortlos ebenfalls, ein gewissermaßen von beiden übernomme- nes Kopfnicken.
Jacques in unsrer Mitte – er scheint halb erblindet, zu- mindest bleibt sein rechtes Auge wie von einer Läh- mung geschlossen. Wie peinvoll der heillose Zustand meines Vaters mich auch trifft, ich versuche es mir nicht anmerken zu lassen. An die Dame gewandt, die ich als
Ärztin ansehe, lege ich Lässigkeit in meine Frage:
„Ja was hat er denn, Frau Doktor?“
Frau Dokter schaut mich an, als hätte sie von mir eine so törichte Frage nicht erwartet. Ein dunkles Augenpaar, prüfend ein ernster Blick… Dann, nach einer wohl- dosierten Weile, die es erst auszukosten gilt, gestattet sie sich ebenfalls eine Frage. Warum, seit jener verbli- chen (sagte sie „verblichen“? Verwirrend ihre französi- sche Aussprache), hier nicht mehr gesäubert worden sei.
„Und fasset beide einmal an, ich möchte ihn doch lieber in der Küche versorgen.“
„Wassenberg... In mare veritas, weisst du... Heiliges
Lourdswasser!“ Der wirft ja alles durcheinander.
Nun aber überrascht, wie kinderleicht der Greis in un- sern Armen liegt – nur so ein Jüngelchen! Die Ärztin, Beruhigendes murmelnd, findet sogar Zeit (dabei fällt
mir Jacques listig zwinkerndes linkes Auge auf), ihm
zärtlich über die Glatze zu streichen.
Da poltert jemand auf eine Weise die Treppe hoch, die mir bekannt vorkommt. Und so ist es: Onkel Karl, Vaters jüngster Bruder, immerhin ein vertrautes Gesicht.
„Ha, ihr Leute – bin ich richtig zum grossen Schmau- sen? Fisch gibt’s, Scholle auf Schorle, was wünscht man mehr.“
Der alte Poltergeist! Sein Frauchen gluckst uns aus der Küche entgegen: Tante Kathrin ist also die Köchin dieses Nachtmahls, meinen Appetit regt das nicht unbe- dingt an. Was haben die beiden wohl ausgeheckt? Pass auf, Holger, die hauen dich in die Pfanne, als wärst du der Fisch.
Kathrin, kinderlos – nicht Karl –, so schmal wie er ge- wichtig, mit einer mädchenhaft hellen Stimme, die erst vom Tag ihrer Silbernen Hochzeit an etwas Krächzen- haftes hinzugewonnen haben muss. Von ihrer völlig un- auffälligen Brust hatte Vater Jacques einmal behauptet, es wäre ein Brett, in das man zwei Dachnägel geschla- gen hat.
„Lecker, lecker…“ Wo Onkel Karl sich niederläßt, da geht es stets zur Sache. Selbst unser Held strahlt und wirkt auf einmal fast seinem Gewicht entsprechend ver- jüngt. Zwischen ihm und seinem dicken Bruder finde ich am grossen Küchentisch eben noch ein Plätzchen. Die giftgrüne Kapsel nimmt Jacques mit Lust von Da- menhand zwischen seine dünnen Lippen, schluckt sie mit Schorle, die ich ihm reichen darf. Der Südfranzose entwickelt einen ähnlich bemerkenswerten Appetit wie
Читать дальше