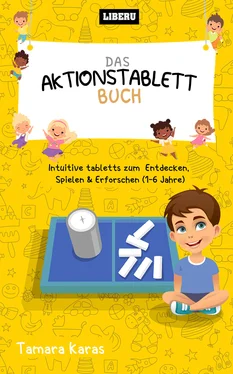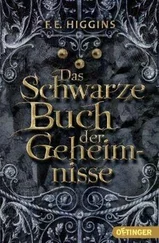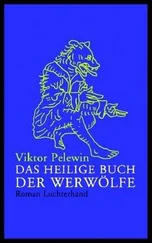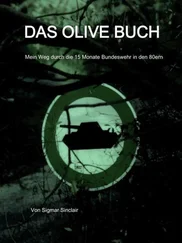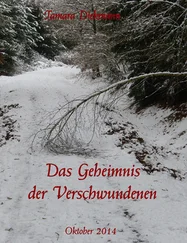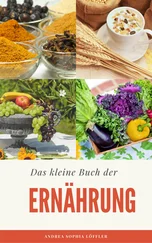1. Was ist ein Aktionstablett
Fühlen, tasten, sortieren, ordnen, auffüllen sind nur einige Dinge, die Kinder mit ihren Tabletts erleben werden. Sie können ihre Erfahrungen mit verschiedenen Materialien machen und dabei nicht nur den Umgang damit lernen, sondern vielmehr auch die damit zusammenhängende Aufgabe lösen.
Ein Aktionstablett unterstützt ein Kind dabei, viele seiner wichtigen Fähigkeiten zu erkunden, zu erlernen und nicht zuletzt zu erweitern. Diese sind vor allem:
• die Förderung der Motorik
• die Erweiterung der Sprachkompetenz
• das Verständnis für Mathematik, Physik, Farbenlehre
• die Entwicklung eines Selbstkonzeptes, was Kinder alleine können und auf was sie Einfluss ausüben
• die Entscheidungen können selbstständig getroffen werden
• das nötige Lernen, um Probleme selbst zu bewältigen
• die Förderung der Phantasie
• die Freude an Bewegung
• die spielerische Förderung der Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer
• das Lernen, sich gezielt mit Dingen zu beschäftigen
• das Lernen, wie Alltagsgegenstände gezielt richtig genutzt werden
• Übungen für das praktische Leben
• ein Verständnis für die Nachhaltigkeit von Materialien entwickeln
• den Erfolg der eigenen Arbeit erleben
Jedes Kind soll sich als eigenständiges Individuum erleben und seine Selbstwirksamkeit erfahren. Das und vieles mehr soll möglichst natürlich in den Alltag integriert werden, denn dort warten unaufhörlich neue Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Gerade deshalb benötigt jedes Kind ungestört Zeit und Raum, um sich mit den Gegebenheiten seiner Umwelt auseinanderzusetzen.
Kurz gesagt: Aktionstabletts sollen Kindern selbstbestimmtes Lernen ermöglichen und ihre Kenntnisse natürlich erweitern.
Dabei werden ganz gewöhnliche Alltagsgegenstände dazu verwendet, um den Kindern auf immer ungewöhnliche und interessante Art und Weise Neues beizubringen.
Ein Tablett beinhaltet immer mindestens eine besondere Aktivität mit den jeweils dazugehörigen Materialien.
Diese sind aus dem Alltag der Kinder herausgegriffen und sie haben nun die Möglichkeit, sich ganz intensiv mit ihnen auseinanderzusetzen. Das Essentielle dabei ist jedoch, dass die Aufgaben immer selbsterklärend sein müssen.
Die ganz natürliche Freude daran, ständig Neues zu entdecken, wird dabei gefördert. Dazu ist es wichtig, dass die Kinder alleine und selbstständig mit dem Material hantieren dürfen und es so auch erfahren können.
Damit ist gemeint, dass die Tabletts auf mehrere Sinne einwirken. Deshalb trainieren sie sowohl die Fähigkeiten als auch die verschiedenen Fertigkeiten im Umgang mit Materialien.
Um dies zu gewährleisten, ist jedoch eines ganz elementar: der Beobachter! Damit ein Aktionstablett auch die Konzentration steigern oder mathematische Grundkenntnisse vermitteln kann, ist eine wohl überlegte Vorarbeit nötig.
Eltern, Erzieher, Pädagogen müssen die Kinder zuvor genau beobachten. Was macht ihnen Spaß? Was weckt ihr Interesse? Welche Neigungen haben sie von sich aus entwickelt? Mit welchen Herausforderungen kann man sie konfrontieren und auch locken?
Erst wenn all diese Fragen geklärt sind, kann man sich Gedanken über das „Wie“ machen.
2. Der Ursprung der Montessori-Pädagogik
Maria Montessori wurde 1870 in Italien in eine sehr christliche Familie hineingeboren. Sie war schon seit ihrer frühesten Jungendzeit sehr engagiert und kämpfte für die Persönlichkeitsrechte eines jeden Einzelnen, vor allem für die Frauenrechte. Darüber hinaus hatte sie bereits in ihrer Schulzeit eine sehr kritische Meinung über das gängige Schulsystem und die Lehrmethodik, welche die Pädagogen anwandten.
Nach ihrem Abschluss war sie nicht nur eine der ersten Frauen, welche das Medizinstudium mit einer Promotion abschlossen, sondern die erste in Italien.
Ihre Passion für die Entwicklungspsychologie fand sie schließlich in einer Psychiatrie für Kinder. Dort arbeitete sie zunächst als Assistenzärztin.
Sie war in dieser Zeit vor allem für die Arbeit mit den geistig behinderten und den „zurückgebliebenen“ Kindern zuständig. Diese Kinder wurden weitestgehend nur mit dem Nötigsten versorgt, bekamen aber ansonsten keinerlei Aufmerksamkeit. Da auch Montessori zu Beginn heillos überfordert war, begann sie sich intensiv mit verschiedenen, vor allem neueren Erziehungstheorien zu beschäftigen.
Sie gelangte schließlich zu dem Schluss, dass die bisherigen bekannten Methoden absolut fehl am Platz waren und offensichtlich nicht funktionierten. Es müsste einfach eine eigene Fachrichtung zum Unterrichten der geistig und psychisch behinderten Kinder geben.
Sie entschloss sich kurzerhand eigene pädagogische Materialien und Lehrmethoden zu entwickeln.
Auf einem Fachkongress wies sie ihre 3000 Kollegen darauf hin, dass diese Gruppe von Kindern nicht zu dumm oder unfähig zum Lernen ist, sondern einfach besondere Bedürfnisse hat. Sie benötigen eigene, speziell auf sie zugeschnittene Methoden, damit auch sie die Möglichkeit haben, zu lernen und sich zu entwickeln.
Schließlich übernahm sie die Leitung der Nationalen Liga für Erziehung, wo sie ihre Ideen im Bereich der Arbeit mit behinderten Kindern umsetzte. Auf diese Weise konnte sie alles Erlernte direkt an den Kindern ausprobieren und auf ihren Nutzen hin prüfen.
Sie passte ihre Materialien unaufhörlich an. Anhand von vielen Stunden der Beobachtung und der Analyse ihrer Erkenntnisse fing sie irgendwann an intuitiv auf das jeweilige Verhalten, welches die Kinder zeigten, zu reagieren. Mit Hilfe der Mischung aus ihrer extremen Genauigkeit und der starken Empathie gegenüber den einzelnen Kindern gelang es ihr schließlich, ihr Arbeitsmaterial perfekt an deren Bedürfnisse anzupassen. Dies war die Geburtsstunde der Montessori-Pädagogik und ihres besonderen Lernmaterials.
Nach mittlerweile über hundert Jahren der Montessori-Pädagogik ist diese längst über die Behindertenpädagogik hinausgewachsen. So hat diese seit langem Einzug in die Kindergärten und Schulen gefunden, wo sie als eigene Fachrichtung gilt. Aktuelle Forschungen belegen zudem, dass es egal ist, ob ein Kind besondere Bedürfnisse hat oder nicht. Diese spezielle Art des Lernens fördert jedes Kind.
2.1 Die Montessori-Pädagogik
Das Arbeiten nach der Montessori-Methode wird oft auch als eine ganz eigene Philosophie verstanden. In ihrem Zentrum steht immer das Kind und seine Individualität. Kinder gelten dabei als Baumeister ihres eigenen Selbst. Das bedeutet, dass sie nicht durch direkte Anleitung sowie Erklärungen lernen und verstehen, sondern auf Grund ihrer ureigenen Neugierde dazu angetrieben werden. Die Lehre fußt dabei auf zwei elementaren Pfeilern:
Der erste ist das Material.
Der zweite ist der Beobachter.
Dieser wird oft auch als Lehrender bezeichnet, wirkt aber im Grunde nicht aktiv auf das spielende Kind ein. Seine Aufgabe besteht darin, im Vorfeld den Entwicklungsstand des Kindes einzuschätzen. Er muss wissen, welche Dinge, Materialien, Bereiche oder Fragen das Kind zurzeit am meisten beschäftigen. Anhand dessen muss er dann das geeignete Thema des Tabletts finden und entsprechendes Material auswählen. Unter Zuhilfenahme geeigneter sprachlicher Techniken kann er dann den Lernprozess sogar noch weiter fördern.
Der Grundgedanke, der aber hinter jeder Technik nach Montessori steht, ist:
„Hilf mir, es selbst zu tun.“
Die sprachliche Technik, von der Montessori spricht, hat ihre ganz eigenen Tücken. Das wichtigste Element bei der Begleitung des Lernens ist, dass der Erwachsene das Kind nicht beeinflussen darf. Er soll auf keinen Fall werten, belohnen, korrigieren oder sogar bestrafen. Dieser für uns eher natürliche Sprachgebrauch, wenn man seinem Kind etwas beibringen möchte, läuft also komplett konträr zur Philosophie nach Montessori. Sie geht davon aus, dass ein jedes Kind nicht nur aus eigener Motivation heraus lernt, sondern vor allem deshalb, weil es am Leben der Erwachsenen teilhaben möchte.
Читать дальше