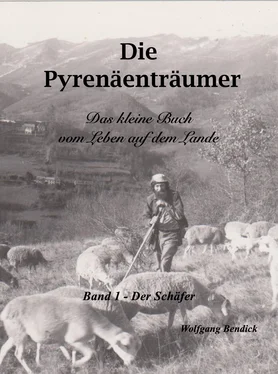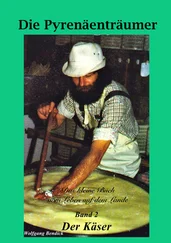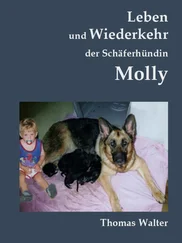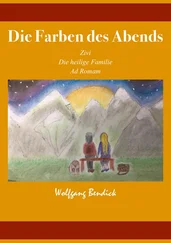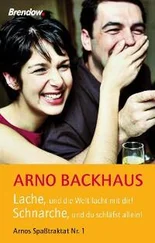Der Wirt kam wieder herein, in der Armbeuge ein paar Scheiter, und legte nach. Funken stoben hoch und verschwanden mit den züngelnden Flammen in der Esse. Vor dem Hinausgehen sammelte er noch die Teller ein. „Das wars wohl!“, meinte Rolf, ich bin jedenfalls gut satt!“ Wir waren seiner Meinung. Da kam der Wirt zurück und deckte flache, wie wir merkten, vorgewärmte Teller auf. „Das scheint noch weiter zu gehen!“, stellte einer von uns fest. Und so war es! Eine riesige Schüssel mit dampfenden Salzkartoffeln wurde mitten auf den Tisch gewuchtet und eine Terrine, randvoll mit einer dunklen Sauce, aus der Fleischbrocken herausragten, folgte. Sie verbreitete einen Duft, der uns sogleich wieder vergessen ließ, dass wir eigentlich schon satt waren. Und sogar ich als Vegetarier war bereit, eine weitere Ausnahme zu machen! Und als dann der Wirt uns mitteilte, dass dieses Ragout von einem erst vorgestern von ihm in den Bergen geschossenen Wildschwein stammte, da fühlten wir uns wie die unbeugsamen Gallier in ihrem Dorf beim Schlussbankett! Die Karaffe leerte sich, ebenso wie die Terrinen. Die Wirtin schaute des Öfteren rein. War sie wirklich so besorgt um unser Wohlergehen oder hatte sie Bedenken, dass wie all ihre Vorräte aufaßen? Als wir uns wohlig zurücklehnten und die Beine ausstreckten, kam noch eine Käseplatte, mit einem halben Laib etwas weichlichem, kleinlöchrigem Käse auf den Tisch. Als man uns feierlich erklärte, das sei Käse aus dem Dorf, der ‚Pic de la Calabasse‘, so benannt nach dem höchsten Berg der Gegend, überwanden wir unser Sattheitsgefühl und schnitten uns jeder eine dicke Scheibe davon herunter. Er hatte etwas die Konsistenz des ‚Räskäses‘ aus dem Bregenzer Wald, nur schmeckte er noch übler. Rudi fragte nach etwas Knoblauch, und wir belegten das Käsestück mit dünnen Scheiben davon und bestäubten das Ganze mit etwas Pfeffer und Salz. Das war ein Genuss! Rudi fragte nach einem guten Rotwein. Nach einer Weile kam der Wirt mit ein paar verstaubten Flaschen zurück und hielt sie uns unter die Nase. Was verstanden wir schon von Wein, außer vielleicht Rudi, der umständlich seine Brille raussuchte und die Etiketten studierte! Bei Käse und Rotwein gedachten wir all der Gegenden, wo wir schon zusammen beides genossen hatten: Girlan, das Sarntal, beim Hiesel, im Lecknertal… „All das sind ‚kosmische Schnittpunkte‘, auch St. Lary!“, klärte Rudi uns auf.
Nach einer Weile ersetzte die Wirtin die fast leere Käseplatte durch eine warme, nach Butter und Schnaps duftende Blätterteig-‚Croustade‘, der hiesigen Spezialität, gespickt mit Backpflaumen. Wer wollte, bekam dazu einen dicken Kaffee. Da tauchte der Wirt wieder auf, diesmal aber nur eine Flasche in der einen Hand und fünf Gläser in der anderen, und setzte sich zu uns. Er stellte vor jeden ein Glas und füllte es randvoll mit der klaren Flüssigkeit aus der Flasche. Wir prosteten uns zu und probierten. Wir bekamen rote Köpfe und Atemnot. Außer Rudi, dem Österreicher setzten wir alle die Gläser gleich wieder ab. Der zeigte dem Wirt, dass ein Vorarlberger einem Arièger in keinster Weise nachsteht! Der Wirt bot uns seinen Tabak an. ‚Bergerac‘ stand auf dem Paket, vielleicht war das der Tabak der ‚Bourgeoisie‘, der ‚Caporal‘ der Tabak der Schäfer. Doch waren auch seine Papiere nicht gummiert.
„Was macht ihr hier um diese Zeit?“, wollte er wissen, das ist doch wirklich kein Touristenwetter!“ „Wir haben einen Hof in der Nachbargemeinde gekauft und wollen uns hier niederlassen!“, erklärte ich.“ „Also eine Kommune“, folgerte er, „das hatten wir hier in der Gemeinde auch schon gehabt!“ Ich erkannte die Ursache des Missverständnisses und klärte ihn auf. „Nein, das sind alles Freunde, die beim Herrichten des Hauses helfen. Später wird meine Familie nachkommen!“ Natürlich hatte er schon von uns gehört. Alle schienen nur noch von uns zu reden. Vor allem Jean-Paul hatte auch im hiesigen Café seine Storys erzählt. „Il faut être fou pour venir ici!“, meinte er. Ich fasste es als Anerkennung auf. Jedenfalls kannte er Marinette, die frühere Besitzerin und auch unseren Hof. Er war schon öfter dort gewesen, zum Pilze sammeln. „Sehr steil und ziemlich verwildert!“, stellte er fest, „aber ein gutes Eck für Steinpilze und Lorchel!“ Doch irgendwann war die Flasche dann leer, was uns als Anlass diente, aufzubrechen. Doch das war gar nicht so einfach, denn plötzlich spürten wir die Folgen der französischen Mahlzeit! Rudi bezahlte und gab noch ein gutes Trinkgeld. Denn getrunken hatten wir wirklich mehr als gut und als gut tut!
Mit vereinten Mühen, Witzen und Hinweisen an den Fahrer schafften wir es, das Auto auf den Berg zu bringen. Der Schneefall hatte aufgehört und die glatten Reifen fanden auf dem schotterhaften Untergrund nun auch etwas zum Beißen. Am Ende der Straße angekommen, quälten wir uns aus den Sitzen. Die drei schliefen unten im Wohnwagen, ich kroch den Hang hinauf, denn mein Schlafsack lag in der Küche. Zum Glück hatte ich zusätzlich eine von Rudis Kamelhaardecken dabei, mit denen er neben seinen Garnen zusätzlich handelte (siehe Hippie Trail 2). Diese, mit kleinen Webfehlern versehen, waren nicht teuer und er hatte all seine Freunde damit ausgerüstet. Am nächsten Tag brach er wieder auf. Ohne Ludwig. Der lag schon daheim auf dem Kanapee. Doch hatte Rudi nicht bereut, hierhergekommen zu sein in das kleine gallische Dorf…
Alle Fußböden waren verlegt, die Treppen gesetzt, die alten Fenster rausgerissen und neue Rahmen eingesetzt, die zugleich die Fensterstürze, die etwas durchhingen, verstärken sollten. Reiner und Rolf waren abgereist. Ich war wieder allein. Außer Jean-Paul oder seiner Mutter. Die hüteten jetzt auf unserem Land ihre Schafe. Ich hatte es ihnen erlaubt. Im Tausch sollten sie unser Feld mit ihrem Kuhgespann umpflügen, denn mit ihrem Traktor, einem riesigen, roten und russischen AVTO, kam man hier nicht hoch. Sie hätten ihn umgeworfen. Rund dreihundert Meter vom Haus hatte ich eine starke Quelle entdeckt und überlegte, wie ich sie zum Haus leiten könnte. Denn die Idee von einer Turbine zum Stromerzeugen ging mir nicht aus dem Kopf.
An einem Abend, als ich hungrig mit Material aus der Stadt zurückkam, sah ich das Gasthaus erleuchtet und die Tische gedeckt. Ich hielt an und fragte, ob ich heute hier essen könnte. Die Wirtin druckste etwas herum, sprach von geschlossener Gesellschaft. Als ich wieder fahren wollte, kam einer von den Anwesenden und sagte, ich könne mit ihnen essen. Es sei das Jahresessen der Jäger und ich sei willkommen, da sie ja auch auf meinem Land jagten. „Vielleicht wirst du ja auch einmal Jäger!“, fügte er lachend hinzu. Da saß ich nun, zwischen rund 50 anderen, meist Unbekannten, an den U-förmig aufgestellten Tischen. Ich erkannte Yvon, den Bürgermeister, Jean-Louis, der ihn immer eingewiesen hatte, wenn er mit seinem LKW Sand hochfuhr, und manch anderen, den ich schon in der Kneipe getroffen hatte. Es ging hoch her, das Essen war sehr gut, natürlich Wildschwein in all seinen verschiedenen Zubereitungen. Später wurden die Tische dann übereinander an einer Wand aufgestapelt, die Stühle rundherum an die Wände gestellt für die älteren Leute, und wer von den Anwesenden noch konnte, drehte sich zu den Klängen eines Akkordeons, gespielt von einem älteren Mann. Diesen hatte ich schon des Öfteren gesehen. Es war der Postbote des oberen Teiles des Tales. Er kam bald mehr ins Schwitzen als die Tänzer und kühlte sich mit Bier ab. Jetzt verstand ich, warum er immer auf dem Hintersitz seines ‚Ami 6‘ eine Kiste Bier stehen hatte. Er litt an Schweißausbrüchen!
Am nächsten Tag ölte ich noch alle Fußböden mit einer Mischung aus 2/3 Leinöl und 1/3 Terpentin ein, denn tags darauf wollte ich heimfahren. Bis zu unser aller Ankunft wäre alles gut eingezogen! Ich hatte mit den Streifen einer Plastikplane eine Passage auf dem leicht angeschliffenen Boden gelegt, damit ich den Boden nicht beschmutzte und fing am entfernten Ende an, mit einem Malerquast alles dick einzustreichen. Da hörte ich eine Frauenstimme sprechen. Es war Jean-Pauls Mutter, sie sprach zu sich selbst. „Bou diu! Da ist ja schon eine Treppe, und die Fußböden sind drin!“ Ich hörte ihre Schritte die Treppen hochkommen. „Die fehlt mir gerade noch!“, dachte ich und strich weiter. Ihre Schritte näherten sich. „Ach da bist du! Ist das aber sauber hier. Alles neu! Heute ist Palmensonntag, da darf man nicht arbeiten!“, rief sie und stand schon hinter mir, um mich mit Küsschen zu begrüßen. Ich legte den Pinsel weg und stand auf. Ich traute meinen Augen nicht: Sie war mit ihren kackigen Holzschuhen über das saubere, weiße Parkett gelaufen! Ich stieß einen Schrei aus: „Ist sauber… War sauber, willst du wohl sagen! Ich habe extra die Plane ausgelegt, damit man darauf laufen soll!“ „Die hab‘ ich schon gesehen, aber ich wollte sie nicht schmutzig machen!“ Ich führte sie die Treppe hinunter vor die Tür uns sagte: „Ab jetzt: Betreten der Baustelle verboten! Außerdem ist die Farbe sehr giftig, 14 Tage darf man da nicht rein!“ Ich sagte das, um sicher zu gehen, dass sie nicht in meiner Abwesenheit hier rumschnüffeln würden. „Heute ist Palmensonntag, da darf man nicht arbeiten!“, fing sie wieder an. „Und was tust du?“, fragte ich sie. „Ich hüte nur die Schafe!“ Ich bereitete einen Putzlappen und Wasser, um den Dreck wegzuwischen. Sie nahm den Eimer, stellte ihre Holzschuhe auf die Seite und wollte wieder hochgehen. Sie war barfuß. Und ihre Füße sahen aus wie ihre Schuhe! „Das mach ich schon!“, sagte ich und nahm ihr den Eimer ab. „Wie gesagt, in der Farbe ist Gift, das ist zu gefährlich für dich, so barfuß!“
Читать дальше