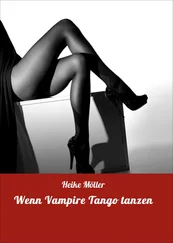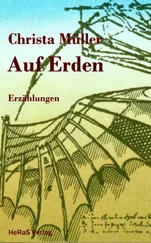1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 Elsas Pupillen verengten sich. Sie legte Messer und Gabel weg, beugte sich vor und griff mit ihrer kleinen, festen Hand an Luises Stirn. Elsa hatte diese Geste als Kind der Mutter abgesehen. Sie sagte auch den dazugehörenden Satz: Du bist wohl meschugge!
Elisabeth triumphierte stumm.
Elsa nahm ihre Hand zurück. Mach dir keine Hoffnung, sagte sie spöttisch. Wir ziehen unsere Kinder selber auf!
Nach dem Essen zeigte sie die Fotos von Ostern. Der Kuss, den Anette, auf ihrem Schoße kniend, in ihr Gesicht drückte, zeichnete sie aus.
Sie rissen sich die Bilder gegenseitig aus den Händen. Warum ist denn Maria nirgends drauf, fragte Luise.
Weil sie uns fotografiert. Elsa las auf den über die Bilder geneigten Stirnen den Verdacht, den sie selbst hegte: Maria wollte nicht, dass ihr schwangerer Leib von diesen Augen gemustert werde. Und in den Mienen ihrer Schwestern erkannte sie den Wunsch, Marias Schande zu sehen. Sich daran zu weiden. Selbstgerecht. Sich daran schadlos zu halten für alle Widerspenstigkeit, die ihr Kind ihnen entgegensetzt hatte, vom ersten bis zu diesem Augenblick.
Ihr könnt mir glauben: Sie sieht gut aus. Richtig schön ist sie, sagte Elsa in die unheilvolle Stille. Ihr passt zwar nur noch ein einziges Kleid, aber es steht ihr. Und alle dort sind zu ihr gut und rücksichtsvoll. Sie hat im Internat ein Zimmer für sich allein. Mit einem Kinderbett für Anette und einer Wiege für das, was kommt.
Gehn wir noch zum Friedhof? fragte Luise. Vorigen Sonntag war Muttertag!
Gehn wir doch morgen, schlug Elisabeth vor. Sie hatte Nachtdienst gehabt und wollte ruhen.
Die Schwestern verabredeten sich für den anderen Tag am Haupttor des Südfriedhofs.
Am anderen Morgen lag eine Karte von Maria unter dem Briefschlitz. Zehn Tage gehe ich schon über die Zeit, schrieb sie.
Das Kind schob sein Kommen hinaus, als sei es mit Elsa im Bunde. Noch hoffte sie, gesund geschrieben zu sein, wenn Maria mit ihm aus der Klinik entlassen würde.
Sie traute dieser Hoffnung nicht. Sie musste die Tochter darauf vorbereiten, nicht kommen zu können.
Elsa schob das Geschirr auf dem Küchentisch zusammen und legte einen Briefbogen auf die freigewordene Stelle.
Sie öffnete das Fenster. Der Apfelbaum aus Noas Garten rieb seine Zweige am Gerüst. Sie trugen flaumige, junge Blätter. Einzelne Blüten hatten sich wie Augen aufgetan. Sie hörte das Lachen der Arbeiter, die in der Sonne frühstückten. Es war Montag.
Sie setzte sich an den Tisch, das Fenster im Blick. Auf dem Fensterbrett hatte Maria früher Blumen versammelt, die sie von den Trümmern der Stadt pflückte. Unkraut war ihr gewesen, was für das Kind schön war.
Sie schrieb. Zwei Seiten, randvoll. Und sah, als sie den Brief überlas, dass sie das Wichtigste nicht gesagt hatte. Einen langen Anlauf hatte sie genommen und war nicht gesprungen.
Sie setzte noch einmal an. Die Feder sträubte sich, kratzte das Papier auf. Nun, wollte sie schreiben, muss ich dir etwas sagen…
Die Tinte im Füllfederhalter versiegte nach dem Nun. Sie suchte das Tintenfass, bis sie sich erinnerte, es leer in die Asche geworfen zu haben. Sie schrieb mit Kopierstift weiter, den sie mit der Zunge anfeuchtete, um das Nun in Von zu ändern.
Von Großmutter und deinen Tanten recht herzliche Grüße.
Und unter Aufbietung allen Mutes brachte sie in einem Wust von Anekdotischem den Satz unter: Ich werde Pfingsten wahrscheinlich nicht bei dir sein können. Und weil sie es nicht fertig brachte, zu schreiben: Kann sein, ich muss in die Klinik, setzte sie Maria an ihre Stelle: Du bist vielleicht in der Klinik.
Ich fragte mich damals nicht, was sie hätte hindern sollen, mich auf der Entbindungsstation zu besuchen.
Der Weg zur Einundzwanzig, die zum Südfriedhof fuhr, führte an der Schule vorbei. Die Schuluhr im Giebel zeigte Elsa an, dass sie sich wieder verspäten würde. Es war ihr egal. Sollten die Krähen doch warten.
In der Grünanlage neben der Schule blühten die Sträucher. Elsa hatte nicht vergessen, dass sie vor zwanzig Jahren hier von Marias erstem Schulgang ein Foto gemacht hatte. Maria stand auf dem Bild in einem hellen Kleid zwischen Frauen in Schwarz. Lass es sie anziehen, hatte die Großmutter gesagt. Unsere Trauerzeit ist nicht ihre.
Elsa zog dem Kind das Kleidchen über und steckte ihm eine rosa Schleife ins Haar. Als ihr eigener Vater gestorben war, hatte sie seinen Tod für bösen Zauber erklärt und Nacht für Nacht auf ihn gewartet, wie wenn er vom PHÖNIX kommen sollte.
Auf jenem Foto zauderte Maria mit ihrem Lächeln, eingeschüchtert von der blicklosen Fassungslosigkeit Elisabeths und dem unheilvollen Schwarz, das jene nun ebenso umhüllte wie Mutter und Großmutter. Die Schmerzausbrüche der beiden Frauen hatten das Kind durch Wochen in panischen Schrecken gejagt und es fuhr schreiend aus dem Schlaf, wenn Elsa das Licht löschte. An dem Tag, als das Foto gemacht wurde, fürchtete es, von den Armen Elisabeths umschlungen und an ein Herz gepresst zu werden, dessen Jammer es erdrücken musste.
Elsa hatte den unnatürlichen Glanz in den Augen des Mädchens gesehen, ehe es, Schaum vor dem Munde, in jenen Krampf fiel, der sich in Marias zweitem Jahr erstmals zeigte, jenem Jahr, als sie mit ihr in die Stadt zur Mutter gezogen war, um die Scheidung von Marias Vater durchzufechten. Dieser Glanz war auf dem Foto nicht zu sehen. Elsa konnte das Bild, wenn es ihr in die Hände fiel, nie ohne ein Gefühl von Schuld betrachten, obwohl sie nicht wusste, was das für Schuld sein sollte. Maria war gleich darauf wieder zu sich gekommen. Die Großmutter hatte die Schultüte geöffnet und eine Birne herausgelangt, in die das Kind gierig biss und deren Saft seinem Taftkleid den Rest gab. Die Schwarze hatte danach tatsächlich versucht, Maria zu umarmen, aber Elsa hatte es nicht zugelassen. Nicht, dass sie Marias Furcht begriffen hätte. Das Kind gehörte ihr. Basta!
Elisabeth war in jenen Tagen um Jahre gealtert. Max Pinkert, ihr gefallener Mann, hatte vor jedem Einsatz eine Karte geschrieben. Die letzte zeigte den Himmel durch das Plexiglas einer Pilotenkanzel, in diesem Himmel eine Wellblechkiste mit Flügeln, auf ihrem Rumpf ein Kreuz aus doppelten Balken. Am Rand stand: „Heinkel-Kampfflugzeug H 111". Und: „So sieht der rechte Kettenhund seine Führermaschine." Elisabeth trug die Karte in der Handtasche mit sich herum. Ich bin der linke Kettenhund, schrieb Max. Hoffentlich seid ihr alle gesund. Und ganz unten, noch unter den Grüßen und seiner Feldpostadresse, stand wie hingewischt: Bald ist`s vorbei!
Schwarze! Neckname aus Kinderzeit. Augen und Haares wegen. Elisabeths kindlicher Lockenschopf war mit nichts in seiner Fülle vergleichbar gewesen. Jede Haarschleife verlor sich in ihm wie ein Falter im Dunkel.
Die Mutter im Zorn schrie: Zigeuner du! Das Unheimliche, Heftige, Jähe benennend, das Elsa schreckte und gleichzeitig anzog. Sie ließ sich in Elisabeths Streiche hineinziehen, von ihrer Unbändigkeit anstecken. Fühlte die Verletzungen durch das Schmähwort, das der Schwester Tränen über die Wangen trieb. Sah Elisabeths Trotz in deren geballten Fäusten, in ihren aufstampfenden Füßen, geschnürt in knöchelhohe Stiefel. Hemmungslosigkeiten, die Luise entrüsteten, die der Mutter Wut zum Kochen brachten, die Kleinste, Elsa, aber furchtsam entzückten. Die stellte sich auf Zehenspitzen mit erhobenen Armen vor Elisabeth, sie vor Schlägen zu bewahren. Elsas aufgerissene, sirupfarbene Augen brachten die Mutter manchmal zur Besinnung. Ich schlag sie noch tot. Sie bringt mich dahin, murmelte sie und ließ die Hand sinken.
Die Beteiligten wussten auf geheimnisvolle Weise, dass nicht die Schwarze, der "Zigeuner", die Mutter "dahin" brachte. Dass etwas anderes es war. Etwas, das außer ihnen wirkte, in sie hinein, ohne dass sie es aufzuhalten vermochten.
Читать дальше