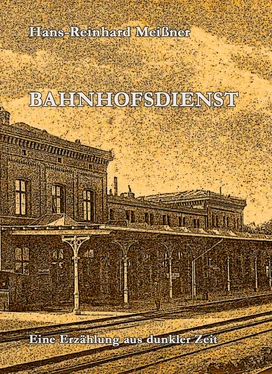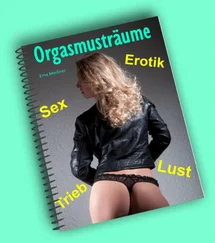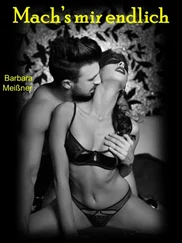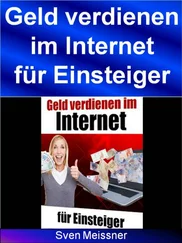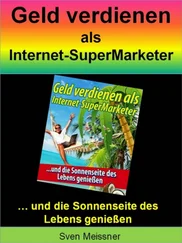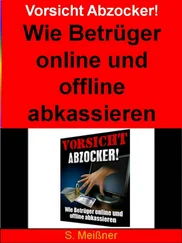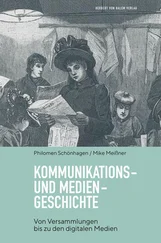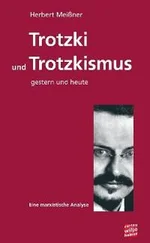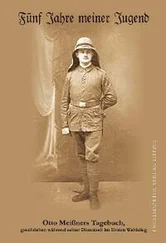Nachdem die Frau die Botschaft vom Einmarsch in Russland vernommen hatte, verfiel sie in einen hemmungslosen Weinkrampf.
Sie wankte wie betäubt zurück in die Schlafstube und warf sich aufs Bett. Gustav wagte nicht hineinzugehen. Nach einer Stunde erstarb das letzte Schluchzen. Sie war fest eingeschlafen.
Der kleine Mann mochte sie wegen ihres scheinbar mangelnden Vertrauens in die Zukunft nicht tadeln.
Ihm war ja, wie wir wissen, auch nicht wohl.
Da nun der Führer in seinem weisen Ratschluss dem deutschen Volk im Osten einen neuen Kriegsschauplatz eröffnet hatte, erweiterte sich der Kreis der Aufgaben der Partei. Deren Funktionären war aufgetragen, die erste Nachricht vom „Heldentod“ eines Angehörigen den im Bereich der Ortsgruppe wohnenden Familien zu überbringen. Der kleine Mann hasste das und tat es aus Pflichtgefühl trotzdem. Erschütternde Szenen musste er erleben. Manchen Fluch überhörte er. Er sei, so dachte er, Nationalsozialist und kein kleinlicher, schäbiger Anscheißer. Und ihm war nur zu bewusst, dass er im Glashaus saß. S e i n e Kinder waren auch da draußen. Vielleicht war das der Umstand, weswegen man ihn überhaupt noch akzeptierte und ihm seine Rolle abnahm.
Die Sorgen um die eigenen Kinder begannen schon, Gustav bisweilen müde zu machen.
Als man ihm hinterbrachte, dass die Volksgenossen dem abgesandten Amtswalter der Partei, also dem Überbringer der Hiobsbotschaft, flüsternd hinter vorgehaltener Hand das schauerliche Stigma des „Totenvogels“ anhefteten, lächelte er nur apathisch, winkte ab und vergaß es wieder.
Die Zeit ging derweil darüber hin.
In den ersten Septembertagen des Jahres 39 hatten die unsicheren Zeitläufte Gustav auf dem Bahnhof der Stadt eine neue Heimat geschenkt. Seine Söhne standen an den Fronten des Krieges. Nach Hause zog ihn wenig. Zwar kümmerte er sich hingebungsvoll um Hildegard, aber sie kränkelte nachhaltig, das heißt, sie wurde eigentlich nie wieder gesund. Allenfalls ging es der Guten zeitweise besser. Was Gustav an Lebensmitteln oder anderen Dingen nebenbei „organisieren“ konnte, gab er seiner Frau. Das ermunterte sie, hellte ihre trübe Grundstimmung bisweilen auf. Manchmal konnte er auch mit ihr noch reden, scherzen und blöde Witze reißen, ganz so wie in alten Zeiten. Jedoch, sie ermüdete schnell und tippelte dann ins Schlafzimmer, um zu ruhen.
Das Einvernehmen zwischen den Gatten bestand, war auch irgendwie tief, grundehrlich und vertraut, obwohl nichts mehr so wie früher war.
Aber dennoch schien Gustav froh, wenn er in seine ockerfarbene Parteiuniform schlüpfen, der im Bett liegenden Hildegard die Stirn küssen und leise sprechen konnte:
„Ich will Dich nicht stören, Mutti, aber ich muss zum Dienst.“
Ganz behutsam legte er dann immer die Tür ins Schloss, nur um ja keine Geräusche zu verursachen.
Jedes Mal, wenn er dann vor die Haustür trat, atmete er befreit durch, obwohl er dieses unwillkürlich aufkommende Wohlgefühl tief im Innern als verwerflich verurteilte.
Von der Katharinenstraße führte sein Weg zu dem bewussten Bahnübergang, an dem heute keine Sozis mehr rumlümmelten – die hatte man nämlich alle schon weggesperrt oder durch nachhaltige Erziehung geläutert. Ein überlegenes Lächeln huschte an diesem Ort über das Gesicht des kleinen Mannes. Sodann stürmte er den Fürstenweg entlang und erreichte schnurstracks und schnellen Schrittes sein Ziel. Die genagelten Eisen seiner Stiefel knallten hart auf`s Kopfsteinpflaster. Bei Trockenheit zündete ab und an ein Funke deswegen. Zu gewöhnlichen Zeiten fühlte er sich dann gut, wichtig, bestätigt, zufrieden.
Nach einer guten Viertelstunde Weg, den er bei klirrendem Frost, in der Zeit der Frühlingsblüte, bei brütender Hitze oder auch sturmgepeitschten Regengüssen zurücklegte, gelangte er auf s e i n e m Bahnhof an.
Mit verbundenen Augen hätte Gustav zu seinem Bestimmungsort finden können. Wie die Sterne den Seefahrer leiten, so führten die dröhnenden Rangiergeräusche, der penetrante Gestank von Schmierfetten und erstickenden Kohlegasen sowie die plärrenden Lautsprecheransagen, deren Töne der Wind zerhackte, den kleinen Mann mit schlafwandlerischer Sicherheit zu seinem Ziel.
Seit Kriegsbeginn schritt Gustav Brennicke diesen Weg mindestens vier -, fünf,- oder gar sechsmal in der Woche ab. In den ersten Jahren noch mit einer gewissen zeremoniellen Steifheit, die auf dem vermeintlichen Gefühl außerordentlicher Wichtigkeit beruhte, später voller Sorgen und Kummer.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.