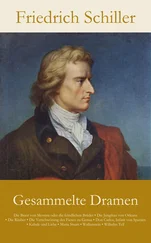1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Beim Verlassen von Fort Boyard hatten wir geglaubt, das Schlimmste sei nun vorüber, doch auf dem Schiff begruben wir diese Illusion. Der Lieblingssport des Kommandanten der 'Danae', des Kapitäns zur See Rion de Kerprigent, bestand darin, jeden Tag einige der schwächsten Gefangenen zu schwerster Schiffsarbeit zu kommandieren. Da nichts von Zwangsarbeit in unseren Urteilen stand, weigerten sich eines Tages die Kameraden Malzieux, Bauer und Cipriani, der Aufforderung des Kapitäns Folge zu leisten. Er ließ sie im untersten Schiffsraum in Eisen legen. Erst bei unserer Ankunft, nach vierundzwanzig Tagen, sahen sie das Sonnenlicht wieder. Sie hatten gelebt von brackigem Wasser und, Schiffszwieback, Malzieux war achtundsechzig Jahre alt.
Wir hatten den Dreien abgeraten, auf diese Art Widerstand zu üben, doch für sie stand die Menschenwürde höher als unsere pragmatischen Überlegungen, und da sie nun in der Backofenhitze des Schiffsbauchs schmachteten, litten wir mit ihnen. Es wurden Pläne geschmiedet, sie zu befreien. Wir hätten dazu das Schiff in unsere Gewalt bringen müssen. Keiner von uns scheute ein Risiko, wir wussten auch, dass es hundertprozentige Sicherheit für das Gelingen einer Überrumpelung nicht gibt. Mit der Sensibilität des grausamen Feiglings spürte de Kerprigent, was unter uns vorging. Er bemühte sich ins Zwischendeck und erklärte: Immer wenn die Insassen eines Käfigs an Deck seien, werde er die drei andern Käfige mit Wachsoldaten umstellen lassen. Falls auf Deck der Versuch einer Meuterei beginne, würde er Schnellfeuer auf die vollen Käfige befehlen.
Der Sadist hatte uns unsere Grenzen gezeigt, dementsprechend war die Stimmung. Aber mehr oder weniger hielt die Hoffnung auf 'das gelobte Land' alle aufrecht. Bei der Ankunft im Hafen von Nouméa gingen 689 Deportierte von Bord, 'nur' 11 waren an den Strapazen der 157tägigen Seereise gestorben. Allerdings hatten nur wenige die Fahrt heil überstanden. Fast alle litten an Asthma, Herz- und Magenkrankheiten, an Rheumatismus und Skorbut. Beim Wort Skorbut muss ich an jenes 'Dementi' der Thiers-Regierung denken, das lautete: "Die Nachrichten, welche von der englischen Presse über die Überfahrt der 'Orne' mitgeteilt wurden, sind in allen Punkten ungenau, denn weit entfernt davon, 400 Skorbutkranke zu haben, zählte dieses Schiff derer kaum 170."
Bei der Ankunft auf der Reede von Nouméa hatte ich das Glück, zu denen zu gehören, die sich eben auf Deck befanden. In langer Krümmung streckt sich die Halbinsel Ducos ins Meer und bildet so eine natürliche Hafenbucht für die Hauptstadt Nouméa. Eine schmale flache Landenge verbindet die Halbinsel Ducos mit Neukaledonien. Selbst ein Laie erkennt die militärstrategischen und schifffahrtstechnischen Vorteile dieses französischen Vorpostens in den australischen Gewässern. Jedem Experten des Strafvollzugs musste Ducos als Verbannungsort ideal vorkommen. Deutlich sah man den Unterschied in der Vegetation. Die Küste Neukaledoniens bis an Nouméa heran erinnerte in ihren vielen Grüntönen an einen botanischen Garten. Dagegen wirkte Ducos trist. Das Braungrau vulkanischen Gesteins war dominierender Farbton des etwa hundertfünfzig Meter hohen Höhenzugs. Quer dazu erhoben sich kleinere langgestreckte Hügel, getrennt durch Regenwassereinschnitte, weiter unten waren sie mit grüngelbem Gras bewachsen, und von dort fiel das Land sanft ab bis zum Meer. Die Regenwasserschluchten verbreiterten sich zum Strand hin und bildeten sumpfige Oasen, bestanden mit Schilf- und Binsengewächsen, wogegen am Rand Sumpfbäume wuchsen. Außer den kargen Baum- und Buschgruppen entlang des Strandes waren weiter hinauf kleine Gehölze und auch einzeln stehende Niaoulibäume zu erkennen, jene weißstämmige und wohl bekannteste Art Eukalyptusbäume.
Nachdem wir ausgeschifft waren, wurden wir ins Lager getrieben. Die Behausungen am Hang waren zur einen Hälfte ausrangierte Militärzelte für je zwölf Mann, zur andern Hälfte Bretterbaracken. Nach dem Gesetz durfte ein Deportierter sich die Wohnung selbst bauen. Da er aber weder Handwerkszeug noch Material bekam, brauchte es überdurchschnittlicher Geschicklichkeit und Erfindungsgabe, wollte er trotzdem nicht auf ein "eigenes Heim" verzichten. Ein Deportierter, durfte auch, entsprechend dem Gesetz, nach fünf Jahren Ducos verlassen und zur Hauptinsel übersiedeln, falls sein Antrag genehmigt wurde. Die Prozedur war umständlich, quälend langsam und völlig von der Laune des Gouverneurs abhängig, erfuhren wir später. Ich gedachte keine fünf Jahre zu warten und war gewillt, mich früher und ohne Erlaubnis zu verabschieden. Das hatte ich Manon und mir geschworen, und ich gedachte nicht, den Schwur zu brechen.
Die Nahrung wurde jeden Morgen ausgegeben: 250 Gramm ranziger Speck, 750 Gramm Zwieback, 100 Gramm gedörrte Bohnen und 16 Gramm Kaffee. Zur Abwechslung gab es manchmal für den ranzigen Speck intensiv riechendes Pökelfleisch, für den eisenharten Zwieback butterweiches schimmliges Brot. Die Bohnen besaßen auch nach drei Tagen des Weichens in Wasser noch ihre felsenfeste Konsistenz, wir kamen schließlich darauf, sie zwischen zwei Steinen zu zermahlen. Da wir nicht einen Span Holz geliefert bekamen, gab es bald rings um das Lager auch nicht die Spur von Brennmaterial. So befanden wir uns in zivilisatorischer Hinsicht auf dem Lebensniveau der Papuas, wir aßen das meiste Essbare roh.
Der Wassermangel gehörte zu den schlimmsten Übeln. Da war kein Bach, nicht die kleinste Quelle. Ohne das Meer ringsum und die Regenzeit wäre Ducos eine Wüstenei gewesen - es gab ohnehin noch zahlreiche Einöden, weiter oben, mit nacktem Fels und unfruchtbarem Sand. Das Trinkwasser brachte man in Fässern auf Booten von Nouméa, es war selbst für die Wachsoldaten und Verwaltungsbeamten teurer als französischer Landwein. Doch wer möchte sich, nicht ab und zu einmal waschen, von der Kleiderreinigung zu schweigen. Später, in der Regenzeit, legten wir primitive Auffangbecken an und lebten einige Tage in Saus und Braus, wuschen uns morgens und abends, doch in der darauffolgenden Hitze wurde das köstliche Himmelsnass schnell faulig.
In dem bald mehrere tausend Insassen zählenden Verbannungslager befanden sich Männer der nützlichsten Berufe. Es gab Maurer, Zimmerleute, Schmiede, Schreiner, Drechsler, Steinsetzer, Klempner, Schlosser, nicht zu vergessen Mechaniker, Buchdrucker, Goldschmiede und Graveure. In Ducos befand sich eine Auswahl französischer Arbeiterintelligenz, der Idealfall für eine Kolonie. Und wir waren von fast krankhafter Sehnsucht nach Arbeit geplagt. Darum nahmen alle außer den, Kranken und Invaliden die anfangs gebotene Arbeit an: Straßen- und Wegebau, Erdarbeit an Gräben und Wällen für einen Franc je Tag. Das war etwas mehr als die Hälfte dessen, was die eingeborenen Plantagenarbeiter auf der Insel bekamen. Wir hätten auch für fünf Centimes gearbeitet, denn dieser Hundelohn war die einzige Möglichkeit, sich einige Selbstverständlichkeiten des zivilisierten Europa zu verschaffen, wie Seife, Tabak, ein Fläschchen Wein oder Rum sowie zusätzliche Nahrungsmittel. Der Wohlstand währte nur einige Monate, dann wurden vom zuständigen Marineministerium die Zahlungen für sämtliche begonnenen Arbeiten gestrichen. Das graue Elend von Neukaledonien begann, an der Verurteilung zum Nichtstun litten die Deportierten mehr als unter dem Fortfall der Entlohnung.
Ein Lichtblick in dieser Misere waren die Frauen von Ducos. Achtzehn Kommunardinnen, von Boulevardgazetten und honorigen Zeitungen als "Petroleusen" diffamiert, waren wie wir verurteilt worden zur Deportation nach einem festen Platz. Meist waren sie als Samariterinnen in Lazaretten tätig gewesen. Das betrachtete man als Angriff auf die Regierung. Viele Monate verbrachten sie im Zentralgefängnis von Auberive, und schließlich erfuhren sie, dass man sie nach einer Niederlassung freigelassener Galeerensträflinge deportieren wollte. Sie drohten, sich zu töten, sollte dieser Gerichtsbeschluss nicht geändert werden. Der energische Protest hatte Erfolg, und so landeten sie auf Ducos. Seitdem wohnen sie in einer separaten Baracke. Wenn man weiß, dass zu ihnen Frauen gehören wie Louise Michel und Natalie Lemel, dann wird man glauben, dass es bei den achtzehn Kommunardinnen vorbildlich zugeht in Bezug auf Disziplin, Lauterkeit und Zuversicht. Stets haben sie ein ermutigendes Lächeln und gute Worte bereit, ihr Beispiel beeinflusst die Stimmung im Lager positiv, Seitdem die Frauen da sind, ist meine Sehnsucht nach Manon wahrlich nicht kleiner geworden. Wie würde es sein, wäre sie hier? Stände mir die Entscheidung darüber zu, sie herzuholen, was würde ich tun? Kann man einer verwöhnten Frau wie Manon dieses Leben zumuten? Fast alle Kameraden mit Ehefrauen oder Freundinnen in der Heimat verneinen das. Kaum einer, der nicht betont, eine Frau müsse unter derartigen Umständen krank werden, früh altern, und bei solchem Dasein verdorre langsam auch die Liebe. Ich musste den Männern recht geben, meine Hochachtung vor den achtzehn Tapferen wuchs, und wenn ich an eine kränkliche, zu früh gealterte Manon dachte, schämte ich mich meines Egoismus, der sie gern hier gehabt hätte. Es gab nur die Flucht, um bald wieder mit ihr vereint zu sein. Ich musste es als Trost nehmen, dass fast alle Deportierten der Meinung waren, sie könnten ihren Frauen dieses Leben nicht zumuten. Die Thiers-Regierung war nicht der Meinung. Ständig bemüht, dem französischen Volk zu beweisen, wie die Deportierten mit Wohltaten überschüttet wurden, hatte man noch Schäbigeres ausgeheckt als die Komödie mit den Gnadengesuchen. Obwohl sie es nicht beantragt hatten, erhielt eine Anzahl Deportierter die Mitteilung, ihre Familie sei auf dem Weg zu ihnen. Bestürzt und ratlos verlangten sie von der Gefangenenverwaltung, Genaueres zu erfahren, doch die schwieg sich aus.
Читать дальше