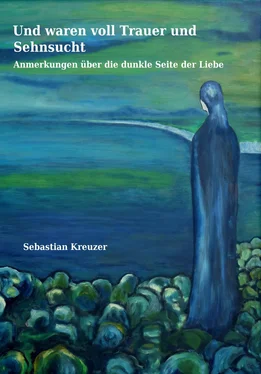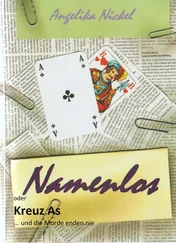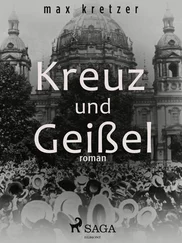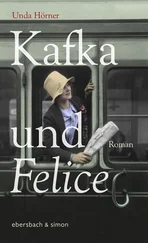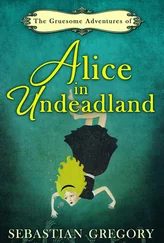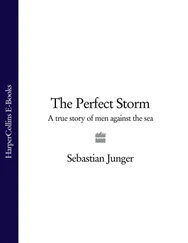Die Geschichte wirft für den unvoreingenommenen Leser, der sich nicht vorschnell von gelehrter theologischer Deutung überfahren lässt, drei Fragen auf.
1. Warum lassen sich Pharisäer mit nur einem einzigen Satz von ihrem Vorhaben der tatsächlich rechtmäßigen und nach ihrer Meinung sogar pflichtgemäßen Steinigung abbringen?
2. Warum kniet sich Jesus vor der entscheidenden Erwiderung hin, beschreibt den Boden und wiederholt die Prozedur nach dem entwaffnenden Satz?
3. Warum entlässt er die Frau, ohne auch nur die Andeutung einer Verurteilung auszusprechen oder den Hauch einer Sühneleistung einzufordern?
Die erste Frage lässt sich leicht aus dem Kontext der Ereignisse heraus beantworten. Besonders versessen auf die Steinigung sind die anwesenden Pharisäer offenbar nicht, sonst würden sie nicht so schnell von ihrem Vorhaben ablassen. Es geht ihnen, so verrät uns der Beginn der Erzählung, vorrangig um die Bloßstellung des unbequemen Predigers und weniger um die Verurteilung der untreuen Ehefrau. Die Konfrontation mit dem mosaischen Sexualrecht ist nicht die erste und letzte Falle, die dem charismatischen Jesus, bekanntermaßen kein Freund eines buchstabengetreuen Rechtsverständnisses, gestellt wird. Wann endlich wird er das Unbedachte aussprechen, den Bruch mit der jüdischen Tradition sichtbar machen oder gegen Pflichten des römischen Untertanen verstoßen? Doch Jesus lässt seine Widersacher erneut ins Leere laufen, indem er die direkte Antwort meidet und die Heuchelei der Fallensteller geschickt entlarvt. Mit keinem Wort lässt er sich auf die Frage ein, wie mit einer Ehebrecherin zu verfahren sei, und stellt stattdessen die moralische Qualifikation der Ankläger in Frage. Die derart Bloßgestellten geben sich geschlagen, wohl wissend, dass sie selbst in die aufgestellte Falle getappt sind. Sie ziehen von dannen und lassen von einer Hinrichtung ab, an der ihnen von Beginn an nicht viel gelegen war. Wie wir aus dem Fortgang der Geschichte Jesu wissen, sind sie nicht von ehrlicher Einsicht in die Unhaltbarkeit des eigenen Tuns geleitet. Sie werden auf eine neue, bessere Chance warten, den Störenfried zu packen. Jesus soll im Kontext von Recht und Gesetz überführt werden, aber nicht Opfer von Willkür und geschürtem Volkszorn werden. Es muss ein im Sinne jener Zeit rechtsstaatliches Verfahren werden.
Für die Pharisäer ist Jesus die zentrale Figur, für den Erzähler der Geschichte aber ebenso die Frau, die „in der Mitte“ steht, umgeben von lauter Männern.
Zunächst hat es den Anschein, als reagiere Jesus auf die Aufforderung, sich zum rechtlichen Umgang mit einer Ehebrecherin zu äußern, verlegen, als wolle er mit Niederknien und unbestimmter Schreibübung Zeit gewinnen. So wie Schüler mit ihrem Schreibgerät hantieren, wenn sie nicht weiter wissen. Doch er wiederholt das Ritual nach der Kurzansprache. Erst als die Pharisäer verschwunden sind, richtet sich Jesus erneut auf und wendet sich der Frau zu. Der Text der Schreibtätigkeit, wenn denn überhaupt einer entstanden ist, scheint nicht von Bedeutung zu sein. Der Berichterstatter hat keine Kenntnis von in den Boden geschriebenen Worten und enthält sich jeder Hinzufügung. Unzweifelhaft ist der Vorgang des Beschreibens der Erde entscheidend. Es ist übrigens das einzige Mal in allen Evangelien, das von einer Schreibtätigkeit Jesu berichtet wird. Schreibunterlage und Schreibwerkzeug könnten elementarer nicht sein: Erde und Finger.
Jesus ignoriert zunächst die an ihn gerichtete Frage und lenkt die Aufmerksamkeit dorthin, wo er das Problem verortet: auf die Erde, den Ursprung und das Fundament menschlichen Daseins. Nicht eine spezifische Sünde ist durch den vermeintlichen Ehebruch berührt, sondern die Grundlage menschlicher Existenz. Erde (adama) und Mensch (adam) gehören im Hebräischen etymologisch zusammen. In Jesu Ansprachen wird ständig Bezug genommen auf die alten Schriften, die uns als Altes Testament bekannt sind. Meist gemäß dem Muster von Ankündigung in der Überlieferung und Erfüllung in Gestalt von Jesu Leben und Wirken. Jetzt spricht er nicht (wie im Markus-Evangelium) vom Mythos des Anfangs, sondern verweist auf das Material, aus dem der Mensch geschaffen ist. Die Teilnehmer der Szenerie reagieren auf die Ansprache, aber sichtbar nicht auf die Schreibtätigkeit, der Berichterstatter enthält sich jeder Kommentierung. Die Worte Jesu zwischen den beiden gleichförmigen Ritualen („Wer von Euch ohne Schuld ist …“) sind für die die Beschreibung des Bodens nicht erhellend.
Das Wunder der Errettung, das der Frau zuteil wird, wird nur durch den Verweis auf den paradiesischen Mythos, das erdene Fundament von Leben und Liebe, verständlich. Die Umwandlung eines sicheren Todesurteils in einen Freispruch erster Klasse - nicht der Mangel an Beweisen oder die Nachsicht der Ankläger, sondern die Haltlosigkeit der Anklage im Angesicht der Erde! - führt zum Abbruch der Verhandlung.
Es lohnt sich deshalb, die Rolle der Frau im 5. Buch Mose, auf das sich die Pharisäer beziehen, mit dem Frauenbild im 1. Buche Mose, der Genesis, auf die Jesus – die Erde beschreibend – verweist, zu vergleichen. Wir sind beim Kernthema angelangt, der „Frau in der Mitte“, so wie das Evangelium es, anders als die „Ehebrecherin“-Überschrift in heutigen Bibelausgaben, bezeichnet.
In Mose 5, 22 ist tatsächlich – zur großen Erleichterung konservativer Theologie – die Steinigung sowohl für die Ehebrecherin als auch für ihren Liebhaber angeordnet. Zumindest hinsichtlich des Strafmaßes herrscht also Gleichberechtigung. Doch spricht der gesamte Kontext eindeutig für ein frauenfeindliches Recht. Muss doch der Vergewaltiger eines unschuldigen Mädchens selbiges ehelichen, weil sie – derart verdorben – nicht mehr für ordentliche Brautwerber in Frage kommt. Dem Vater des Mädchens müssen zudem 50 Silberstücke Schadensersatz entrichtet werden, 20 mehr als der Verrat an Jesus dem Judas eingebracht hat.
Dem männlichen Mittäter bei einem Ehebruch, dem Verkehr mit einer verheirateten Frau also, dagegen ist solche Sühneleistung nicht möglich, hat er sich doch am Eigentum eines anderen vergriffen und es durch den Beischlaf derart für den Eigentümer unbrauchbar gemacht, dass neben der endgültigen Zerstörung der Frau auch die des Verführers oder Verführten gefordert wird. Eine Wiedergutmachung ist ausgeschlossen. Ist ein verlobtes Mädchen in ein Sexualdelikt verstrickt, hängt die Bestrafung von der geleisteten Gegenwehr ab. Ein Mann, der seine Ehefrau fälschlicherweise beschuldigt, nicht unberührt in die Ehe eingetreten zu sein, wird ausgepeitscht, und er muss dem Brautvater 100 Silberstücke zahlen. „Rechtsschutz für eine verleumdete Frau“, so ist dieses Kapitel kurioserweise in vielen Bibelausgaben überschrieben. Hat der Mann aber mit seiner Anschuldigung recht gehabt – die Beweislast liegt übrigens nicht beim Ankläger, sondern bei den Brauteltern, die mit einem befleckten Laken aus der Hochzeitnacht die Intaktheit ihres Kindes zum Zeitpunkt der Verheiratung nachweisen müssen -, ist die Frau zur Steinigung freigegeben, vor dem Hause ihres Vaters durch die Männer der Stadt. Wie immer, wenn nicht eine einzelne Frau gebrochen werden soll, sondern die Freiheit und sexuelle Selbstbestimmung der Frau als Prinzip attackiert wird, ist ein ganzes Männeraufgebot vonnöten.
Liebe in der Zeitlosigkeit des Paradieses
Alle Männer gegen eine Frau – das ist auch die Konstellation, mit der Jesus konfrontiert ist.
Einen juristischen Disput über das mosaische Recht kann er nicht riskieren – die Pharisäer haben ohne Zweifel das Recht auf ihrer Seite. Ob sie seine Schreibsymbolik verstehen? Wohl kaum. Er verzichtet auch darauf, sie zu erläutern. Die Erde aber, in die sein Finger schreibt, verweist auf ein älteres, tieferes Prinzip, gegenüber dem das im Deuteronomium verkündete Sexualrecht schlichtweg falsch, verdreht und gegen göttliches Diktum gerichtet erscheint. Im 1. Buch Mose, das das paradiesische Vorspiel der Menschheitsgeschichte beschreibt, entdecken wir den Grund und Boden für den Freispruch der Frau.
Читать дальше