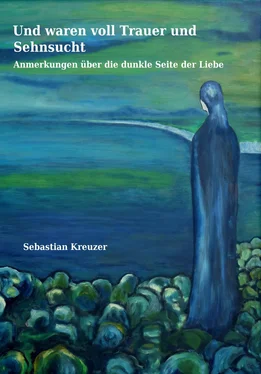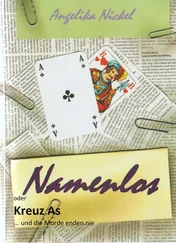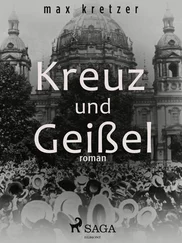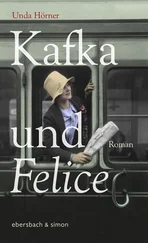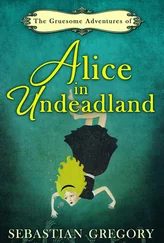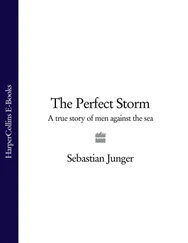Jahrhundertelang war den Menschen die eigene Lektüre der Bibel nicht möglich. Das brachte der Amtskirche den entscheidenden Vorsprung: Es erlaubte ihr nicht nur die alleinige Auswahl aus dem Schatz der Offenbarungsliteratur, sondern gab ihr zugleich die Deutungshoheit über das Verkündete. Heute, wo jedermann sich die eigene Lektüre leisten kann und unüberschaubar viele Kommentare zur Verfügung stehen, ist das Verstehen keineswegs einfacher geworden. Ja, gerade die wissenschaftliche Aufbereitung überfrachtet, macht uns ratlos, unschlüssig und zweifelnd und versperrt oft den Weg zum Kern der Geschichte. Auch wer als Mensch der Gegenwart nicht glauben mag, dass die biblische Literatur durch Gott gewirkt entstanden ist und als „Offenbarung“ gelten kann, wird die Zeitlosigkeit von Altem und Neuem Testament immer dann spüren, wenn ein Interesse an den dort erzählten Geschichten entsteht und man sich in seinem Menschsein wiederfindet.
Wer die Person Jesu und seine Lehre verstehen will, muss lernen, die großartigen von den eher dem Zeitgeist geschuldeten Wundern zu unterscheiden. Die „flachen“ Wunder wie der Gang auf dem Wasser oder die Verwandlung von Wasser in Wein hatten dereinst die Aufgabe, für die neue Religion zu werben und nach „Beweisen“ verlangende Gemüter von der Großartigkeit des Menschensohnes zu überzeugen. Oder einfach nur um zu zeigen, was der Glaube bewegen kann. Dem modernen Christen sagen sie nicht viel, deshalb muss bei Sonntagspredigten weit ausgeholt und viel theologischer und psychologisierender Aufwand betrieben werden, um es über die Jahrtausende in die Gegenwart zu retten.
Jesus wird mit einer Frage der Sexualmoral auf die Probe gestellt.
Eine zeitlose, da radikal gegen den Zeitgeist gerichtete, und überwältigend wundersame Geschichte findet sich im Johannes-Evangelium und erzählt von Jesu Begegnung mit einer Ehebrecherin. Vor diesem Zusammentreffen begegnen wir dem Protagonisten in einer schweren Krise. Anhänger zweifeln, Weggefährten verlassen ihn enttäuscht, seine Lehre provoziert Widerspruch und öffentlichen Aufruhr, ja sein Leben scheint in Gefahr. Zu Wundern, die Zweifel beseitigen könnten, ist Jesus nicht aufgelegt. Überhaupt zieht er sich bei schweren Prüfungen prinzipiell nicht durch Wunder aus der Affäre, koste es auch das Leben.
Seine Lehre bleibt schwer verständlich – damals wie heute. Zu den Menschen spricht er in Rätseln. Niemand versteht genau, was gemeint ist, wenn er über sein Verhältnis zu dem, der ihn gesandt hat, spricht. Die Situation ist angespannt, doch wagt keiner, Hand an ihn zu legen, selbst die Häscher der Pharisäer und Hohepriester kehren unverrichteter Dinge zurück.
Die Eskalation findet vorerst nicht statt. Jeder geht heim und Jesus verbringt die Nacht auf dem Ölberg, ein heiliger Ort in der Nähe von Jerusalem, von dem aus nach jüdischer Vorstellung dereinst der Messias zum Jüngsten Gericht ziehen wird. Was nun folgt, ist in den ältesten Fassungen des Johannes-Evangelium noch nicht enthalten. Es wurde nachträglich eingefügt. Aber anders als sonstige Nachträge spiegelt es weniger den Geist und die Intentionen der historischen Situation wider, in der sich die christliche Gemeinde zum Zeitpunkt der Korrektur oder Ergänzung befindet. Es zeigt Jesus in seiner ureigenen und einsamen Rolle als Freund der Frauen: „der erste und der letzte Freund der Frauen“ in der Geschichte des Christentums, wie die Theologin Uta Ranke-Heinemann einmal bemerkt hat.
Was aber erzählt das 8. Kapitel des Johannes-Evangeliums? Frühmorgens lehrt Jesus wie tags zuvor schon im Tempel. Diesmal aber stellen ihm seine Widersacher eine Falle, die uns zunächst an die Geschichte mit der kaiserlichen Steuer in den drei synoptischen Evangelien erinnert. Damals richteten die Pharisäer in der Hoffnung, Jesus werde sich zu einer politischen Inkorrektheit hinreißen lassen, an ihn die Frage, ob es dem Weg Gottes entspräche, dem Kaiser, einem heidnischen zumal, Steuern zu entrichten. Jesus zieht sich klug aus der Affäre mit dem Verweis auf das den Münzen aufgeprägte Bildnis des Kaisers: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Dass Theologie dereinst daraus die Lehre von der politischen Untertänigkeit eines Christenmenschen basteln würde, konnte Jesus zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Während Luther die Weltlichkeit der Ehe nicht entgangen ist, hat er den noch weltlicheren Ursprung politischer Herrschaft glatt geleugnet und ihr – anders als Jesus – einen göttlichen Ursprung verschafft.
Wie dem auch sei, mit feinsinniger Ironie einer Sowohl-als-auch-Lösung kann sich Jesus dieses Mal nicht gegen die Widersacher behaupten. Die Schriftgelehrten stellen ihn vor eine harte Entweder-Oder-Entscheidung und haben das Objekt der Entscheidung direkt mitgebracht: eine Frau, die „auf frischer Tat“ beim Ehebruch ergriffen worden ist.
Jesus verweist auf die Erde.
Jesus soll Stellung beziehen zum Gebot Mose, solche Frauen zu steinigen. Die Herausforderer wissen, dass die Bestätigung der Hinrichtung ihn in Widerspruch zu seiner auf Liebe und Toleranz gründenden Lehre, insbesondere gegenüber den Frauen, bringen werde, eine Zurückweisung sich aber gegen das mosaische Gesetz, gültiges jüdisches Recht also, richte. Jesus lässt sich auf keine rechtlich-theologische Diskussion ein, so wie manche späteren Kommentatoren, die mit Hinweis auf Kapitel 22 des 5. Buches Mose gerne darauf verweisen, dass auch dem männlichen Mittäter die Steinigung droht – offenbar in der Absicht, der Ehebrecher-Geschichte die spezifisch weibliche Komponente zu nehmen und Jesu Eintreten als geschlechtsneutralen Kampf gegen eine barbarische Strafpraxis darzustellen. Doch darum geht es in der Episode nicht, ein unzüchtiger Komplize der Ehebrecherin kommt nicht vor; eine einsame Frau steht einer großen Männerschar gegenüber - und dazwischen ein einsamer Jesus, der für die eine oder andere Seite Partei ergreifen muss.
Er bleibt zunächst eine Antwort schuldig, bückt sich und schreibt „mit dem Finger auf die Erde“. Was er notiert, erfährt man nicht. Die Fallensteller lassen nicht locker und bohren hartnäckig weiter. Jetzt richtet Jesus sich auf, und wieder ist es wie schon in der Steuergeschichte ein einziger Satz, der die Heuchler entwaffnet: „Wer unter Euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie“. Dann wendet er sich wieder der Erde und seiner Schreibarbeit zu, so als sei alles Wesentliche gesagt. Die Menge – derart entlarvend mit ihrer Selbstgerechtigkeit konfrontiert - löst sich auf, und die „Frau in der Mitte“, so heißt es wörtlich, und Jesus bleiben zurück. Eine Szene wie aus einem Western, in dem der aufgebrachte Mob – einer nach dem anderen – das Feld räumt und den Hauptdarstellern die Bühne überlässt. „Wo sind sie“, fragt Jesus die Frau, „hat Dich niemand verdammt?“ Sie bestätigt: „Niemand, Herr.“ Die zwei kurzen Sätze Jesu, die darauf folgen und die Episode beenden, bringen bis heute die Moraltheologen in höchste Verlegenheit und sind höchst irritierend. Die von der Meute unterlassene Verurteilung nimmt Jesus zum Anlass, seinerseits auf Verdammung und Strafe zu verzichten: „So verdamme ich Dich auch nicht.“ Kein Schuldspruch, keine Buße, keine Moralpredigt über eheliche Treue. Noch nicht einmal das Delikt, wegen dem die Frau kurz vor der Hinrichtung stand, wird beim Namen genannt. „Und sündige hinfort nicht mehr!“ Mit diesem sehr allgemein gehaltenen Schlusswort, das auch lauten könnte: Mach’ s gut, endet die Geschichte mit der „Ehebrecherin“.
Ein Freispruch erster Klasse!
Die Überschrift, die der Geschichte - vom Spätmittelalter - vorangestellt wurde, „Jesus und die Ehebrecherin“, suggeriert, dass es um die Milde Jesu gegenüber einer sündigen und von anderen bereits vorverurteilten Person geht. Doch es steckt weit dahinter mehr als Verzicht auf Strafe, als Güte, Nachsicht, Offenlegung von Heuchelei und Abkehr von Selbstgerechtigkeit und Doppelmoral.
Читать дальше