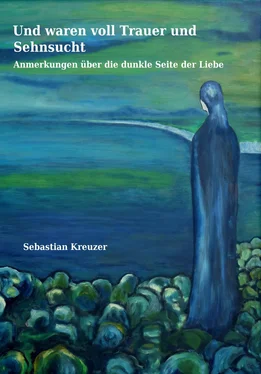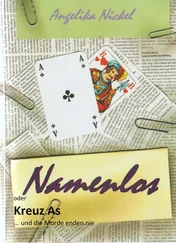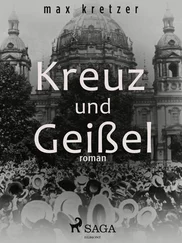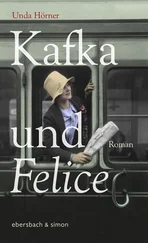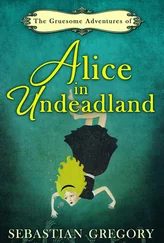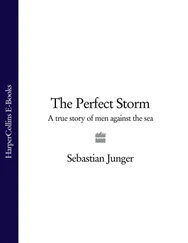Damit endet die Schöpfung. Es kommt nichts Neues mehr hinzu. Die folgenden Turbulenzen zerstören die Gartenidylle. Und zuletzt werden die beiden aus dem Paradies vertrieben und – als Paar – aufgefordert, fortan ihre eigene Geschichte zu schreiben und zu leben.
Schöpfungsbilanz
Es lohnt sich, eine Bilanz am Abschluss der Schöpfung zu ziehen. Es gibt Mann und Frau, das Gebot der Anhänglichkeit des Mannes an seine Frau, die Vorwegnahme eines Falles, der noch gar nicht eingetreten ist und für den die Figuren und Umstände erst noch entstehen müssten: die Abkehr des Mannes von den Eltern und die Hinwendung zur Frau.
Kurz gesagt: Die Liebe ist erfunden.
Erst der letzte Schöpfungsakt bringt das Höchste hervor. Angeregt durch die Einsamkeit des Menschen, geschaffen von der höchsten Macht, die hierbei ihr Meisterstück abliefert. Ein nicht materielles Schöpfungsprodukt, gewonnen aus einer Operation, die zu einer neuen Konstellation verhilft: der Begegnung und Erkennung zweier Menschen unterschiedlichen Geschlechts. Das ist Liebe und am Anfang und in ihrem Ursprung ist sie nicht mehr und nicht weniger als das im Schöpfungsbericht Geschilderte.
Liebe ist das Höchste, was der Mensch im Rahmen des durch die Schöpfung gegebenen Rahmens erreichen kann. Mehr geht nicht. Wenn einem realen Mann die Erkennung seiner Frau nicht durchgängig glückt, kehrt er gerne zu einer älteren Stufe der Schöpfungsfolge zurück: er legt sich einen Garten an, pflegt und schützt diesen wie damals, als das weibliche Gegenstück noch nicht geschaffen war, und genießt sogar die Einsamkeit, die seinem Urahn so nicht mehr zusagte, oder er geht – in Ermangelung von Wildtieren – mit dem Hund spazieren. Oder legt sich ein frauenfernes Hobby zu. Er bewegt sich dabei anders als der Untreue, Betrügende oder von seiner Mutter nicht Loslassende durchaus noch im Rahmen der Schöpfungsordnung, wenn auch im Rückwärtsgang.
Wohin stößt der Ellenbogen einer Frau, wenn sie ihren Mann auf ungebührliches Verhalten aufmerksam machen und zu einer edleren, höheren Form des Betragens anregen will? In die Rippe!
Was aus toten Männern wird, verrät das 1. Buch Mose unmissverständlich: Staub! Der Mann wird zu dem Material, aus dem er geschaffen ist. Die Unsterblichkeit bleibt ihm verwehrt. Gott hat ihn aus dem Paradies verwiesen, bevor er Gelegenheit hatte, vom Baum des ewigen Lebens zu essen. Was aber wird aus toten Frauen? Die Staubprognose richtet Gott bei der Vertreibung aus dem Paradies nur an den Mann, was gerne überlesen wird. Ob die Frau durch bloßes Mithören der Ansprache an ihren Gefährten dem gleichen Schicksal anheim fallen wird? Und noch etwas stimmt nachdenklich. Sie hat ihren Ursprung gar nicht in der Erde so wie der Mann. Sie stammt aus dem bereits Lebenden, einen ersten Lebenshauch zur Erweckung benötigt sie also gar nicht und kann diesen deshalb prinzipiell nicht aushauchen. Sie ist zweifelsfrei der Schlusspunkt der Schöpfung und über ihr Schicksal im Tode kann nur spekuliert werden, während das des Mannes unzweifelhaft ist. Adam stirbt nach biblischen Angaben im phantastischen Alter von 930 Jahren. Von Tode Evas berichtet das 1. Buch Mose nichts. Vielleicht lebt sie immer noch unerkannt unter uns.
Was nicht zur Schöpfung gehört
Nicht der Schöpfung angehörig sind gemäß dem zweiten Kapitel der Genesis viele für selbstverständlich gehaltene Dinge, Institutionen und Ideen, die gerne in den Mythos aller Mythen hineingeschummelt werden, doch erst der nachparadiesischen Menschheitsgeschichte entstammen: Ehe, Familie, Kinderkriegen, Ackerbau, Viehzucht, Religion, Hierachie, Eigennutz und und und. Auch die Sexualität fehlt vollständig ebenso wie der Verzicht auf selbige.
So verwundert es nicht, dass uns uralte mythologische oder märchenhafte Erzählungen der Liebe vertrauter und näher erscheinen als biblische und historische Berichte über Ehe, Familie und Recht. Schon manche Sozialformen des letzten Jahrhunderts muten heute antiquarisch an.
In Tausenden von Jahren werden Menschen andere Lebensformen entwickelt oder die heute bestehenden bis zur Unkenntlichkeit (aus unserer Sicht) verwandelt haben. Ihre Vorstellung von Gerechtigkeit, ihr Gottesbild wird ein anderes sein. Das bekannte Erleben der Liebe, in ihrer Entstehung und in ihrem Verlust, dagegen vergeht erst, wenn Menschen von der Erdoberfläche verschwunden sind oder aufgehört haben, Menschen zu sein. Was durchaus eintreten kann.
Wem das alles inakzeptabel oder zu frauenfreundlich erscheint, der halte sich besser ausschließlich an den sogenannten ersten Schöpfungsbericht, der der Paradiesgeschichte vorausgeht, aber eigentlich der jüngere ist und von einer feministischen Theologie – wohl in Unverständnis der Schöpfungsfolge der zweiten Schilderung – bevorzugt wird.
Im ersten Bericht wird der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen: sofort als Mann und Frau, stufen- und folgenlos. Und auch der Auftrag zur Vermehrung, zum Kinderkriegen also, und zur Beherrschung der Erde, selbstverständlich in verantwortlicher und gottgefälliger Weise, ist schon von Beginn an vorhanden. Sogar Vegetarier können sich im ersten Kapitel der Genesis bestätigt finden.
Für die Fragestellung dieses kleinen Büchleins taugt der erste Schöpfungsbericht aber weniger. Es fehlt darin der faszinierendste Teil: das Paradies. Und etwas Ewiges, das zwar der einzelne Mensch verlieren kann, aber nicht die Menschheit in ihrer Gesamtheit, vermissen wir ebenso: die Liebe. Wir halten uns deshalb, darin Jesus folgend, der gleich im nächsten Kapitel auftreten wird, an den zweiten Schöpfungsbericht; der handelt von der Liebe und dem Paradies. Der allein uns erklären kann, warum Umarmung und Küssen nirgends so schön sind wie in einem Garten. Im Chatroom kann ein Mann seine Frau nicht erkennen und ebenso wenig wiedererkennen. Sex gibt es deshalb im Internet zuhauf, aber Liebe nicht.
Das größte Geheimnis des zweiten Schöpfungsberichtes liegt in der Folge.
In der Entstehung folgt die Frau dem Mann, in der Liebe folgt der Mann der Frau. Einer Frau übrigens, die allen archaischen Zuschreibungen einer Mutter Erde widerspricht. In der Paradiesgeschichte ist der Mann das irdische Geschöpf, die menschliche Fortsetzung der Erde, die Frau aber das Fremde, Unbekannte, Neu-Hinzugekommene.
Urknall, Evolution und Schöpfung
Die griechische Philosophie hebt vor ca. 2600 Jahren mit der Frage an, woraus die Welt besteht und wie trotz der sichtbaren Vielfalt die Einheit all dessen, was ist, zu begreifen ist. Es ging also darum, hinter der unendlichen Vielheit der Dinge den einen Stoff, die Ursubstanz oder die wenigen Grundelemente beobachtend und denkend zu erfassen, aus denen die vielen konkreten Dinge beschaffen sind. Die erste Philosophie war konsequent materialistisch, auch die menschliche Seele stellte man sich als hauchzarte Materie vor, der Luft ähnlich.
Moderne Sinnfragen – Wer bin ich? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? - sucht man in der vorsokratischen Philosophie zunächst vergebens. Den Sinn des eigenen Daseins in Frage zu stellen, hatten die ersten Philosophen keine Veranlassung. Auch an der Realität zu zweifeln, im Sinne eines Trugbildes, das uns Sinne, menschliche Wahrnehmung und Gehirn vorgaukeln, lag ihnen noch weit fern.
An der Welt und ihrer Beschaffenheit sind die meisten Menschen der Gegenwart nur insofern interessiert, als dass sie ihre eigene Stellung darin verstehen möchten, sofern man überhaupt noch bestrebt ist, die eigene Person in einen größeren Zusammenhang zu stellen, ob religiös, mystisch, esoterisch oder physikalisch, historisch und evolutionär. Wobei die gesicherten wissenschaftlichen Anschauungen, Urknall in der Physik und Evolution in der Biologie, zur Sinngebung wenig taugen, weil sie zwar bei unvoreingenommener Auseinandersetzung den Verstand erreichen, aber weit, weit entfernt vom menschlichen Lebensgefühl bleiben. Das sagt man auf, es stimmt vermutlich sogar, aber es bewegt uns nicht, das Innerste erreicht es nicht.
Читать дальше