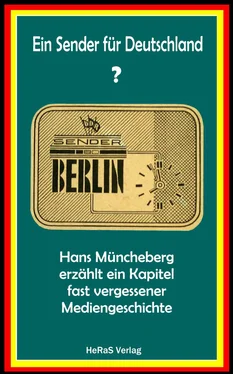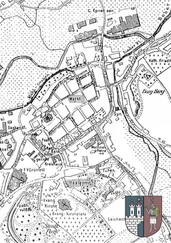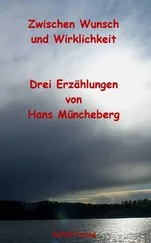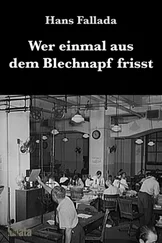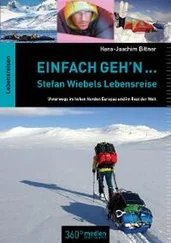"Ich habe erst mal gesagt, es geht nicht, denn in so einem Studio kann man gar nicht arbeiten", bekannte Hans-Erich Korbschmitt später seinen Schock nach Besichtigung des Studios . "Wir haben uns überlegt - Bühnenbildner war Horst Hennicke -, was man machen kann. Und da sind wir zu einer völlig (...) anachronistischen Bühnenbildauffassung gekommen. Wir haben nämlich, anstatt eine Barocktreppe zu bauen, eine Wendeltreppe gebaut - ein absoluter Formalismus, er gab uns aber die Möglichkeit, Auftritte von oben nach unten(...) zu machen. Der Einstieg und Ausstieg aus der Szene ging immer über diese Treppe. Es war natürlich optisch sehr interessant, man konnte Füße fotografieren und tolle Sachen machen." (1) Die Sendung lief sehr erfolgreich am 25. Juli 1954.
Als im Frühsommer 1954 das Rohdrehbuch für den Fernsehfilm Der verschenkte Leutnant vorlag, ging es um die Auswahl eines geeigneten Regisseurs. Ich schlug den mir aus meiner Arbeit im DEFA-Spielfilmstudio bekannten Wolfgang Luderer vor. Er war zur Filmarbeit für das Fernsehen bereit, wollte aber die optischen Wirkungsmöglichkeiten für den Bildschirm zuvor kennenlernen. Wir boten ihm die Inszenierung von Lessings Lustspiel Der junge Gelehrte an. Er griff zu. Im Herbst 1981 sagte er zu dem Versuch: "Ich habe als allererstes eine Probe mit der Kamera gemacht, zum Erstaunen und auch Erschrecken aller, weil ich sehen wollte, wie das funktioniert(...) Ich wollte feststellen, was ich mit dem Ding machen, und wie ich [so] arrangieren kann(...), daß es kontinuierlich geht und optisch ein bißchen interessant bleibt für den Betrachter, also nicht, daß er wie im Theater sitzt und nur ein Bild sieht, sondern für ihn (...) ein Kinoeindruck entsteht." (1)
Es muss insgesamt gelungen sein, denn als Wolfgang Luderer und ich nach der Sendung mit interessierten DEFA-Kollegen sprachen, sagten die: „Interessante intime Bilderzählung in der einen Dekoration, gut gemacht - wir haben die Schnitte gar nicht bemerkt."
Wir konnten darauf nur antworten: "Das war auch gar nicht möglich. Es gab keine Schnitte. Was ihr gesehen habt, war eine Choreographie für eine Live-Kamera."
Die Sendung lief am 5. September 1954. Einen Monat darauf war das 315 m² große Studio III mit zwei Ikonoskop-Kameras unterschiedlicher Brennweite einsatzbereit, einige Wochen später auch der Theatersaal, ausgerüstet sogar mit drei Kameras. Nun war die große Form nicht länger Wunsch oder Ausnahme, nun waren abendfüllende Fernsehspiele mit mehreren Schauplätzen und endlich auch mit filmischer Bildmontage, waren große Unterhaltungssendungen, waren Kindersendungen und Konzerte live möglich. Wichtig auch: Die Zuschauer konnten selbst ins FERNSEHZENTRUM kommen und endlich in die Sendungen mit einbezogen werden.
Auf dem Weg zur Professionalisierung
Wir verstanden uns nachdrücklich als ein Kommunikationsmittel und wollten unsere Arbeit in einem permanenten Dialog mit den Zuschauern zur Diskussion stellen. Wir sahen es als unsere Aufgabe an, den kulturellen Reichtum der Menschheit allen Zuschauern in Stadt und Land - bis in das kleinste Dorf - zu einem erwünschten und nachhaltigen Bildungserlebnis werden zu lassen.
Um unsere hochgesteckten Ziele erreichen zu können, mussten wir unter uns forcieren, was heute 'Professionalisierung' genannt wird. Günter Kaltofen und ich waren von unseren Kolleginnen und Kollegen in die Gewerkschaftsleitung des Programmbereichs gewählt worden. Wir erkannten, dass viele ehemalige Hörfunkmitarbeiter, aber auch künstlerisch-technisches Personal den neuen Gestaltungsmöglichkeiten noch unsicher gegenüberstanden. Also machten wir als Gewerkschaft den Vorschlag, eine innerbetriebliche Weiterbildung zu organisieren. Im noch nicht aktiven Studio II boten wir experimentell aufgelockerte Lektionen an. Günter Kaltofen sprach über die Grundgesetze der Dramaturgie, Hermann Rodigast über die Dramaturgie des Tons, der Musik, der Geräusche, ich über die Dramaturgie der Kameraführung und der Bildmontage im Mehrkamerasystem, Heinz Zeise, ein hochbegabter Künstler und Szenenbildner über die dramaturgisch möglichen Akzentuierungen durch Lichtführung und Szenenbildgestaltung.
Und weil wir nach den Lektionen unter Einbeziehung der Chefs auch über die jeweiligen Probleme der Praxis sprachen, gewann die Gewerkschaft in ihren Vertretern an Autorität.
Eine zweite ehrenamtliche Tätigkeit ergab sich für mich aus wiederholtem Eintreten für Kollegen bei internen Streitfällen. Ich wurde gebeten, den Programmbereich in einer für das ganze FERNSEHZENTRUM zuständigen innerbetrieblichen Schiedskommission zu vertreten. Von da an blieb ich einem Engagement für Recht und Gerechtigkeit dauerhaft verbunden. 1955 wurde ich gefragt, ob ich bereit sei, als Schöffe am Stadtbezirksgericht Berlin-Treptow mitzuarbeiten. Ich dachte, ehrlich gesagt, sofort an die Möglichkeit, dadurch zu echten und spannenden Geschichten für meine Fernsehspielarbeit zu kommen, und sagte zu. Auf einer Belegschaftsversammlung des FERNSEHZENTRUMS wurde ich bald darauf in dieses Amt gewählt und später von Legislaturperiode zu Legislaturperiode nach genauer Rechenschaftslegung für diese Tätigkeit bestätigt. Jedes Jahr fuhr ich also für zwei Wochen zum Gericht und wurde bald mit heiklen Gesetzesfragen konfrontiert. Es erwies sich, wie wichtig es auch bei Gericht war, mit Gleichgesinnten offen für eine gerechte Anwendung bestehender Gesetze einzutreten. Bald war ich dem Umstand dankbar, nur im Rahmen der untersten Instanz gefordert zu sein. Trotzdem kam es Jahre später zu prinzipiellen Auseinandersetzungen, die bis 1989 andauerten.
5. Kapitel: Das offizielle Versuchsprogramm will die Studioenge überwinden
Vom Herbst 1954 an, begannen die durch den neuen Intendanten gesetzten politischen Prämissen auch im künstlerisch-unterhaltenden Fernsehprogramm spürbar zu werden.
Zum 7. Oktober 1954, dem Staatsfeiertag der DDR, wurde eine Szenenfolge Rund um den Strausberger Platz ins Abendprogramm genommen. Sie konnte allerdings nicht von dort kommen, wo der Bau der repräsentativen Stalinallee sichtbar Konturen gewann, sondern lediglich aus den Adlershofer Studios. Noch immer war das Leben außerhalb der Studios nur mit der Filmkamera einzufangen.
Zwei Abende darauf hatte das erste Fernsehspiel mit West-Agenten-Thematik Premiere: Das Konto in Frankfurt. Die Handlung spielte zwischen Frankfurt/Main und einem Ort in der DDR. Am Main saß ein Unternehmer, der einen seiner früheren Mitarbeiter gern aus der DDR wegkaufen wollte. Es ging um einen Konstrukteur und seine hochwertige Neuentwicklung. Man setzte einen Agenten auf ihn an, der zuerst Erfolg zu haben schien. Im letzten Moment siegte dann aber das Pflichtgefühl.
Das erstrangige Instrument, von dem Intendant Adameck sprach, sollte sich auch durch den Start einer Sendereihe fernseheigenen politischen Kabaretts unter dem Titel Wo die Freiheitsglocke bimmelt als wirksam erweisen. Vier Autoren und drei Regisseure wirkten zusammen, um zu der >system-kritischen< Erkenntnis zu führen: "Wer gut schmiert...nie verliert".
Als das 2. Wartburg-Treffen deutscher Sänger Mitte Oktober stattfand, wäre das FERNSEHZENTRUM gern live dabei gewesen, so aber mussten die Gespräche über das neue Leben in unserer Republik und die Einheit Deutschlands im Adlershofer Studio geführt werden. Durch Live- Auftritte und Filmaufzeichnungen konnte wenigstens internationale Atmosphäre geboten werden. Das Chinesische Volkskunstensemble, der Chor der Lehrer aus Brno sowie der Chor der Pariser Gewerkschaften wurden neben deutschen Solisten und einem Volksmusikchor in der Sendung vorgestellt.
Читать дальше