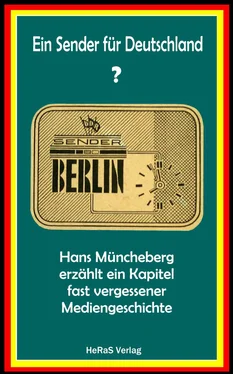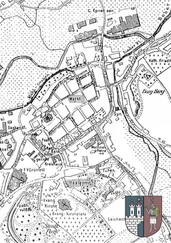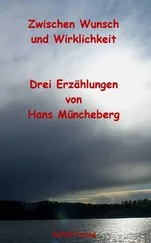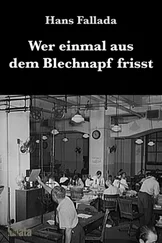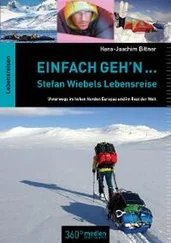Mitte März erlebte die Adaption der Erzählung Die schwarze Liste von Stefan Heym seine Fernsehpremiere. Sie konnte als erstes Fernsehspiel mit Gegenwartsthematik in den Annalen des Fernsehfunks verzeichnet werden. Das Spielbuch hatte Bodo von Schweykowski in gutem Kontakt mit Stefan Heym geschrieben. Unter der Regie Gottfried Herrmanns spielte Ursula Burg vom DEUTSCHEN THEATER die Hauptrolle. Eine amerikanische Schauspielerin. Betty Frazier, seit Jahren populäre Darstellerin in einer Rundfunkserie, wird wegen ihres Eintretens für das zum Tode verurteilte Ehepaar Rosenberg und die zehn ausgesperrten Schriftsteller Hollywoods fristlos entlassen - und keiner von ihren Kollegen wagt einen Einspruch dagegen.
Wie gern wären wir schon im Jahr 1954 mit einer mobilen Übertragungstechnik zum Deutschen Theater in das Zentrum Berlins gefahren, aber noch immer war es uns nicht möglich, Übertragungen aus den führenden Theatern des Landes auszustrahlen. Was blieb uns übrig, als den umgekehrten Weg zu versuchen und die Theater zu Gastspielen in unser kleines Studio einzuladen. So entstand eine Sendereihe von Studiogastspielen. Wir begannen mit Sartres Schauspiel Die ehrbare Dirne in der Inszenierung von Erich Alexander Winds an den Städtischen Theatern Leipzig. Vier weitere Gastspiele erlebten wir noch im selben Jahr, im folgenden waren es bereits sechszehn und später folgten auch Theater aus der Bundesrepublik unserer Einladung in die voll ausgebauten Adlershofer Studios.
Trotz einer noch möglichen relativen Staatsferne , ganz abgehoben von den politischen Großereignissen im Lande ließ sich selbst ein Fernsehprogramm für gerade einmal zweitausend in der DDR angemeldete Fernsehteilnehmer nicht gestalten. Viele rechneten nicht ohne Grund anders. Vor den meisten privaten Empfangsgeräten versammelten sich in der Regel Großfamilien oder gar Hausgemeinschaften. Und dann gab es öffentliche oder betriebliche Fernsehstuben. Man könnte also mit Zuschauerzahlen um mehrere Zehntausend rechnen, hieß es, ein Mehrfaches dessen, was selbst große Theater an Sitzplätzen aufwiesen.
Als am 29. März 1954 der IV. Parteitag der SED begann, stand das Hauptabendprogramm unter der Überschrift: Vom Kampf der deutschen Arbeiterklasse. Alles, was seit dem ersten Sendetag zu diesem Thema an Szenen und literarischen Programmen entwickelt worden war, wurde in Kombination mit neuen Szenen und weiteren Rezitationen ausgestrahlt. Auf dem Parteitag wurde die Losung ausgegeben: 'Deutsche an einen Tisch!' Wann und wie sie Eingang in unser Programm fand, wird noch berichtet werden.
Experimente auf neuen Wegen
Ostersonntag 1954! Der außergewöhnliche Sendetag ermöglichte ein ungewöhnliches Experiment: Die erste Sendung einer vollständigen Oper aus dem kleinen Studio I. Der Musikenthusiast Karl-Georg Braun und Fernsehregisseur Bodo von Schweykowski hatten eine knappe Fernsehfassung der Komischen Oper Der Barbier von Sevilla erarbeitet, die das ermöglichte. Vom Orchester des FERNSEHZENTRUMS unter Leitung von Otto Gerdes waren vorab mit Ursula Richter, Hans Löbel, Joseph Burgwinkel, Amelie Walter-Sachs, Werner Liebing und Herbert Rössler die Musikaufnahmen gemacht worden, sodass die Sendung schauspielerisch live , aber mit der vom Tonband zeitgleich in das Studio und über den Sender ( Play-back) eingespielten Musik ohne Pause über volle 86 Minuten laufen konnte.
Dieses Verfahren, Live-Play-back genannt, wurde noch viele Jahre erfolgreich angewandt. Später berühmt gewordene Darsteller wie Ruth Maria Kubitschek und Manfred Krug haben in entsprechend gesendeten Weihnachtsopern der folgenden Jahre ihren ersten großen Erfolg erlebt.
Am 1. Mai folgte ein weiterer Schritt zu größeren künstlerischen Gestaltungen. Mit den Autoren F.K. Kaul und Günter Cwojdrak habe ich als Dramaturg versucht, in filmisch-dramatischer Erzählweise das historische Geschehen zu umreißen, das zur Ausrufung des ersten Maitages als internationaler Kampf- und Feiertag aller Arbeiter führte. Es geschah in Chikago 1886. Zum Verständnis der historischen Zeit und Ausgangslage war es wichtig, in einigen Außenszenen das Auftreten der Arbeiterführer während des Generalstreiks in Chikago zu zeigen. Das wäre im Studio nicht überzeugend zu lösen gewesen, also verlangte Regisseur Gottfried Herrmann, Filmszenen zum Einblenden in ein Live- Spiel vorproduzieren zu können. Für die Live -Teile im Studio ermöglichten sie zugleich die notwendigen Umbauten der Dekoration.

Als Zeitzeuge notierte dazu der Regisseur Hans Joachim Hildebrandt Jahrzehnte später: "Das Fernsehspiel ist mir als erste Großproduktion in Erinnerung. Hier zeichnete sich eine Produktionsweise ab, die für die fünfziger und sechziger Jahre bestimmend werden sollte. Das Bilderlebnis war total. Im Studio I wurden mehrmals die Dekorationen gewechselt, während größere Filmszenen eingespielt wurden, außerdem war das Ansagestudio einbezogen worden.
Man muß sich die Gestaltung der Sendung vor Augen führen: Da wurde in Studio I eine Szene gespielt, dann folgte die Filmeinblendung - in der Zeit wurde umgebaut. Es mußte alles klappen, man konnte die Sendung nicht unterbrechen... Der Raum war eng. Wände wurden abgebaut, in den Gang hinausgetragen, neue Teile wurden aufgebaut, Scheinwerfer nachgerichtet, die Kamera in neue Position gebracht, und das alles in drei oder vier Minuten. Dann ging das Spiel nahtlos weiter." (1)
Im Frühjahr 1954 war eine außergewöhnliche Meldung durch die Weltpresse gegangen: Ein radioaktiv verstrahlter japanischer Fischer habe sich geweigert, in das amerikanische Strahlenhospital verlegt zu werden. Er hatte zur Mannschaft des Fischdampfers Fukurya Maru gehört, der nach dem Test der erste H-Bombe der USA im 1. November 1952 auf dem Eniwetok-Atoll noch weit außerhalb der angegebenen Sperrzone in einen radioaktiven Asche-Regen geraten war. Nun befürchtete er, dort nicht Patient, sondern Versuchsobjekt zu sein.
Die Meldung schockierte. Wissenschaft und Humanität waren in doppelter Weise infrage gestellt! Also schrieb ich unter dem Titel Die Todeswolke das erste aktuelle Fernsehspiel des FERNSEHZENTRUMS .
Im Mittelpunkt der Handlung stand ein Arzt aus den USA, der Patienten aus Hiroshima geholfen hatte. Er war in Japan zur Autorität geworden und geriet in einen tiefen Konflikt, als der Fischer ihn, der jetzt im Dienst der US-Atomenergie-Kommission stand, zum Arzt seines Vertrauens erklärte.
Um trotz der Raumnot im Studio beweglich zu sein, sollten die von den USA verbreiteten Dokumentarfilm-Passagen über den Test für das Spiel genutzt werden. Sie waren für uns die Außenaufnahmen , während im Gegenschnitt die Innenszenen mit Vertretern der US-Atomenergie-Kommission ablaufen konnten.
Hannes Fischer aus Dresden übernahm die Regie und gewann trotz der Ferienzeit gute Darsteller. Die Erstsendung am 7. Juli 1954 fand ein sehr positives Echo - wohl auch wegen der Kritik am Rüstungswettlauf, der den USA mit dem big stick der Nuklearwaffen die Vorherrschaft sichern sollte. Man befand sich im Kalten Krieg. Es wurde also entschieden, das Fernsehspiel zu wiederholen. Nun bedeutete damals jede Wiederholung eine komplette Wiederaufführung. Sie wurde dann während des Messe-Sonderprogramms 1954 auch erfolgreich gesendet.
Ein neuer Chef kommt selten allein
Das Interregnum unter Gerhard Probst dauerte nicht drei, es dauerte sieben Monate. Im Juni 1954 begann die Amtszeit Heinz Adamecks als Intendant, die später nahtlos in den Vorsitz des STAATLICHEN KOMITEES FÜR FERNSEHEN BEIM MINISTERRAT DER DDR mündete. Als langjähriger Kaderchef verstand er es, sich und alle Positionen so zu arrangieren, dass er jeden Machtwechsel innerhalb der SED-Führung und manche Krise im eigenen Amt überstand.
Читать дальше