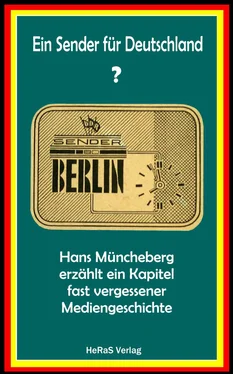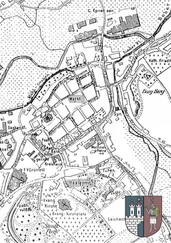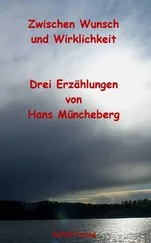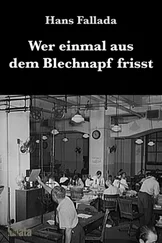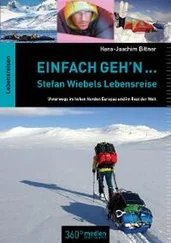Probst war ein fachlich anerkannter Techniker und ein besonnener, politisch weitsichtiger Leiter. Erfahrungen auf beiden Gebieten hatte er bereits seit 1928 im ARBEITER-RADIO-BUND gesammelt. Nach einer Lehre in einem feinmechanisch-optischen Betrieb Dresdens, der auch in der Elektrotechnik ausbildete, konnte sich der junge Gerhard Probst bald eigene Rundfunkempfänger bauen, vom Detektorgerät bis zu leistungsstarken Apparaten. Bei Zeiß-Ikon als Spezialist geschätzt, wurde er während des Krieges dienstverpflichtet. Nach 1945 begann er bald beim Landessender Dresden zu arbeiten. Unter seiner Leitung wurde erst eine Villa zum Funkhaus ausgebaut, später ein Teil des Hygiene-Museums, der zum Sitz des Senders wurde. Bald technischer Leiter und stellvertretender Intendant, erhielt er 1951 den Ruf nach Berlin. Dort sollte er funktechnisch alles Erforderliche für die III.Weltfestspiele der Jugend und Studenten vorbereiten. Es hieß, nur für wenige Tage in die Hauptstadt der DDR zu kommen, es wurden dann aber Jahrzehnte daraus, denn bald sah das RUNDFUNKKOMITEE die gesamte Technik unter seinem Direktorat bestens aufgehoben.
Als nun im Herbst 1953 bei der Nachfolge von Hermann Zilles guter Rat teuer war, erinnerte man sich daran, wie souverän Probst einst in Dresden unvermutet aufgetretene Führungslücken überbrückt hatte. Bereits im November 1953 griff Gerhard Probst in den bisher üblichen Sendebetrieb des FZ ein. In einem Tonbandgespräch hat er Jahre später dazu erklärt: " Wir haben festgestellt, daß sieben Tage in der Woche ein Versuchsprogramm zu gestalten, viele Probleme mit sich brachte(...) - und ich habe, mehr zur Entlastung, vorgeschlagen, daß wir am Montag Sendepause machen. Das hieß natürlich nicht, daß wir am Montag nicht gearbeitet haben, aber wir haben ihn genützt zur Pflege und Wartung der damals noch sehr bescheidenen Technik, wir haben ihn auch benutzt, um Gedanken zu sammeln und Gespräche zu führen, über die weitere Entwicklung des Fernsehens.“ (1)
So ist der sendefreie Montag entstanden. Beim sendefreien Montagabend blieb es bis zum 2. September 1957. Warum er dann aufgehoben und zu einem teils geliebten, teils verhassten Programmabend wurde, gehört in ein folgendes Kapitel.
Eine Grenze wird überschritten
Einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur großen Form konnten wir Mitte Dezember 1953 gehen. Zum ersten Mal wurde ein Schauspiel der Weltliteratur live aus dem Studio I gesendet: Don Juan oder Der Steinerne Gast von Alexander Puschkin. Die Spielzeit betrug fast eine Stunde, lag also jenseits der bisherigen Schmerzgrenze. In dem schlauchförmigen Studio I befand sich weiterhin nur eine unersetzliche Kamera. Eine Bildmontage war nicht möglich, dennoch mussten die Schauplätze wechseln. Regisseur Bodo von Schweykowski war sich der Schwierigkeiten bewusst: "Es ist ein Einakter mit drei verschiedenen Bildern, und alle drei (...) haben praktisch keinen Anlauf, es sind Kurzszenen in sich, also schwer zu spielen, weil die Schauspieler sich nicht in den Rollen entwickeln können. Dann die Besetzung - das erste Mal trat Ekkehard Schall [vor einer Live-Kamera H.M.] im Fernsehen auf (...) auch Inge Keller. Er spielte den Don Carlos, quasi einen Nachwuchs-Don-Juan, sie war die Donna Anna..." (1)
Da im Studio immer nur eine Dekoration aufgebaut werden konnte, mussten wir zwei Umbaupausen passend zur Inszenierung gestalten. Der vom Theater am Schiffbauerdamm und der Volksbühne bekannte Bühnenbildner Roman Weyl hatte extra Skizzen im Stil der Zeit geschaffen. Sie wurden als Diapositiv eingeblendet, während eine speziell für diese Sendung komponierte Zwischenaktmusik von Hans-Hendrik Wehding eingespielt wurde. Ihre Länge stellte zugleich das erlaubte Zeitmaß für die Umbauten dar.
Zwei Pausen hatte auch nur die Frau hinter der Kamera, Hanna Janowitz [später Hanna Christian - H.M.], die sich alle optischen Motive vorher auf einem langen Ablaufplan notieren musste. Es gab noch keine Assistenten. Sie saß auf der Rikscha - so nannten wir das Fahrgestell der Kamera mit dem etwas ausschwenkbaren Motorradsattel - und musste dem Bühnenarbeiter Zeichen geben, wohin er sie zu schieben hatte.
Eine über Jahre gültige Programmgestaltung für Weihnachten wurde am 1. Feiertag begründet. In einer verdichteten Fassung kamen die wichtigsten Szenen der Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck live zur Sendung. Die Zu-Stimmung der Opernfreunde unter den Zuschauern war derart groß, dass von da an zu jedem Weihnachtsfest ein großes musikdramatisches Werk in unserem Programm stand. Bald sprachen wir von der Weihnachts-Oper .
Am 2. Feiertag folgte dann der nächste Schritt zur großen Form: Die Livesendung des Schwanks Taillenweite 68 von Hans Lucke in einer Fernsehfassung von weit mehr als einer Stunde Länge. Einen Publikumserfolg erlebte der Schwank etwas später in dem gediegen gestalteten 'Theatersaal'. Dort konnten die Gäste zwar noch keine Fernsehtechnik in Aktion sehen, aber viele der bereits bekannt gewordenen Fernsehdarsteller in Person erleben. - Sendetüchtig ausgerüstet wurde der Saal erst ein Jahr später.
Die Weihnachts-Oper blieb für dreiundzwanzig Jahre Teil des Festprogramms, dann hatten sich offenbar die Maßstäbe so stark verändert, dass z. B. 1976 an den Abenden beider Weihnachtsfeiertage der DDR-Kundschafter Achim Detgen, brillant dargestellt von Arnim Mueller-Stahl, in Das unsichtbare Visier spannende Abenteuer erlebte.
1953 hieß das letzte Programmangebot die Silvesterschau . Drei unterhaltende Sendungen hatte es bereits gegeben, als gegen 22 Uhr eine weitgehend spontan ablaufende Live- Revue begann. Manches von dem zuvor Geplanten scheiterte an Belanglosigkeiten. So lag es in der Hand der Aufnahmeleiter Werner Schurbaum und Jupp Maigret, mit den jeweils eintreffenden Artisten, Musikanten, Schauspielern, Sängern, Tänzern ein temporeiches, wirkungsstarkes und bei allen Kontrasten harmonisches Nummernprogramm zu kombinieren.
Gottfried Herrmann hatte im Studio I die operative Regie übernommen, Günter Puppe saß im Regieraum und sorgte für alle erforderlichen Zugaben vom Tonband, durch Diapositive, per Filmgeber. Auch Regisseure anderer Sparten, Redakteure, Dramaturgen, Assistenten, keiner konnte passiv vor dem Bildschirm sitzen. Sie kamen in die Studios, auch das winzige Ansagestudio war einbezogen, halfen bei Umbauten, unterstützten die Garderobieren, sicherten die Wege zum Auftritt vor der Kamera, der jeweils einen und einzigen, brachten Erfrischungen ins Studio und waren, beteiligt an einer großen Aufgabe, eine große harmonische Familie.
Ausbau der Technik und des Programms
Im neuen Jahr setzte sich unser Interims-Intendant Gerhard Probst energisch für den Ausbau der Fernsehversorgung ein. Am 15. Januar 1954 ging ein größerer Sender auf den Berliner Müggelbergen in Betrieb. Vier Tage darauf begann der Sender Dresden unser Programm auszustrahlen. Auf dem Fernsehgelände in Adlershof wurde ein Heizhaus errichtet, wichtiger noch war für uns der Bau eines eigenen Film-Kopierwerkes. Alles was außerhalb der Studios geschah, konnte ja auf nicht absehbare Zeit nur durch Filmkameras einfangen werden.
Im Programm dominierten weiterhin kürzere Fernsehspiele. Wir versuchten, mit angedeuteten, auch mit nur gemalten Dekorationen zu arbeiten. Zugleich wurde eine sich ständig erweiternde Palette unterhaltender Sendungen geboten. Dabei verstärkten sich die satirischen Akzente. Am 24. Februar gab das Berliner Kabarett DIE DISTEL ihr erstes Studiogastspiel: Hurra! Humor ist eingeplant!
Читать дальше