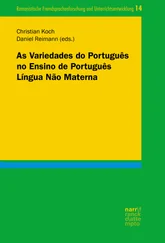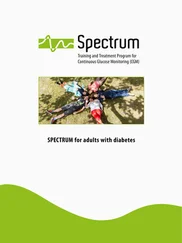31.1 Ziele der Versorgung mit Teilprothesen 31 Einführung in die Teilprothetik 31.1 Ziele der Versorgung mit Teilprothesen Teilbezahnte Kiefer sind Folge des Verlustes oder der Nichtanlage einzelner oder mehrere Zähne. Als Resultat kommt es entweder zu Unterbrechungen oder Verkürzungen der Zahnreihe in einem oder beiden Kiefern. Unterbrechungen können ein- oder mehrfach auftreten. Weiterhin kann die Zahnreihe ein- oder beidseitig verkürzt sein, ggf. auch in Kombination mit Unterbrechungen. Liegt als Folge der Teilbezahnung eine relevante Einbuße der orofazialen Funktionen (Mastikation, Sprache, Ästhetik, Okklusion) vor oder drohen diese gestört zu werden, ist der Ersatz fehlender Zähne zur Wiederherstellung indiziert. Dies ist auch unter Aspekten der Tertiärprophylaxe sinnvoll.
31.2 Zahnverlust und seine Folgen 31.2 Zahnverlust und seine Folgen ( Brunner und Kundert 1988, Fröhlich und Körber 1977)
31.2.1 Epidemiologie 31.2.1 Epidemiologie Die Mehrzahl zahnbegrenzter Lücken ist durch Zahnverluste infolge von Karies, Parodontalerkrankungen oder Traumata bedingt. Weitere Ursachen für zahnbegrenzte Lücken sind Nichtanlagen (Hypodontie). Im Durchschnitt fehlen jedem jungen Erwachsenen (35–44 Jahre) in Deutschland 2,1 Zähne. In der Alterskohorte der jungen Erwachsenen sind 1,9 % mit einer Teilprothese versorgt, bei 21 % liegt ein nicht versorgtes, teilbezahntes Lückengebiss vor. Bei Senioren (65–74 Jahre) fehlen im Mittel 11,1 Zähne und rund 28 % tragen eine herausnehmbare Teilprothese. Modellgussprothesen finden sich bei knapp 14 % der teilbezahnten Senioren. Nur noch 5,7 % der Senioren weisen unversorgte teilbezahnte Gebisse auf ( Jordan und Micheelis 2016).
31.2.2 Auswirkungen des teilweisen Zahnverlustes
31.3 Aufgaben von partiellem Zahnersatz
31.4 Die historische Entwicklung des partiellen Zahnersatzes
31.5 Einteilung der Lückengebisse
31.5.1 Einteilung nach Kennedy
31.5.2 Einteilung nach Eichner
Literatur
32 Gestaltung, Konstruktion und technische Aspekte von Teilprothesen
32.1 Einleitung
32.2 Einteilung der partiellen Prothesen
32.2.1 Topographische Einteilung
32.2.2 Einteilung nach Tragedauer
32.2.3 Einteilung nach dem Material oder der zugrunde liegenden zahntechnischen Konstruktion
32.2.4 Einteilung nach dem Funktionswert (funktionelle Einteilung)
32.2.5 Einteilung nach der Abstützungsmöglichkeit
32.3 Forderungen an eine dental-tegumental gelagerte Teilprothese
32.4 Aufbau und Bestandteile von partiellen Prothesen
32.4.1 Zahntragende Sattelteile
32.4.2 Großer Verbinder
32.4.3 Kleine Verbinder
32.4.4 Verankerungselemente
32.5 Konstruktions- und Gestaltungsprinzipien für Teilprothesen
32.5.1 Statische Grundlagen
32.5.2 Ästhetische Grundlagen für Teilprothesen
Literatur
33 Einführung in die Modellgussprothetik
33.1 Einleitung
33.2 Bestandteile einer Gussklammer
33.3 Aufgaben, Vor- und Nachteile von Gussklammern
33.4 Empfohlene Gussklammerformen
33.5 Werkstoffkundliche Aspekte
33.5.1 Elastizitätsmodul( Tab. 33-1)
33.5.2 Elastische Verformung
33.5.3 Die 0,2-%-Dehngrenze( Tab. 33-1)
33.5.4 Korrosionsfestigkeit und Biokompatibilität
33.5.5 Titan
33.6 Langzeitresultate
Literatur
34 Modellgussprothetik: Klinischer und labortechnischer Ablauf
34.1 Einleitung
34.2 Klinik: Vorbehandlung des Restgebisses
34.2.1 Füllungstherapie
34.2.2 Präprothetische Mukogingivalchirurgie
34.2.3 Ästhetische Überlegungen
34.3 Klinik/Labor: Planung der Modellgussprothese
34.4 Klinik: Präparation und Abformung
34.5 Labor: Herstellung der Arbeitsmodelle und, sofern nötig, Herstellung von Registrierschablonen
34.6 Klinik: Kieferrelationsbestimmung
34.7 Labor: Aufstellen der Prothesenzähne in Wachs
34.8 Klinik: Anprobe der Wachsaufstellung
34.9 Klinik: Komplettierung der Arbeitsunterlagen für das Labor
34.10 Labor: Vermessung, Design und Gerüstherstellung
34.10.1 Labor: Vermessung, Design und Gerüstherstellung im digitalen Workflow
34.11 Klinik: Gerüstanprobe
34.12 Labor/Klinik: Kompressionsabformung bei vorhandenen Freiendsätteln (Altered-Cast-Technik)
34.13 Klinik/Patient: Gesamteinprobe der Modellgussprothese
34.14 Labor: Fertigstellung der Modellgussprothese
34.15 Patienteninstruktion
34.16 Nachsorge
Literatur
35 Einführung in die Geschiebeprothetik (mit klinischem und labortechnischem Ablauf)
35.1 Einleitung
35.2 Teilhülsengeschiebe
35.3 Semipräzisions- und Präzisionsgeschiebe
35.4 Steggeschiebe und Steggelenke
35.5 Scharnier- und Resilienzgelenke
35.6 Adhäsivattachments (extrakoronale Adhäsivverankerungen)
35.6.1 Indikationen und Kontraindikationen von Adhäsivattachments
35.6.2 Prinzipien bei Adhäsivattachments
35.7 Langzeitergebnisse mit geschiebeverankerten Teilprothesen
35.8 Klinisches und labortechnisches Vorgehen bei konventionellen Geschieben
35.9 Klinisches und labortechnisches Vorgehen bei Adhäsivattachments
Literatur
36 Geschiebeprothetik: Doppelkronensysteme – Einführung
36.1 Einleitung
36.2 Vor- und Nachteile von Doppelkronen
36.3 Zylinderteleskope
36.4 Galvanoteleskope
36.5 Konuskronen
36.6 Doppelkronen mit zusätzlichen Retentionselementen
36.7 Verblendung von Doppelkronen
36.8 Gestaltung des Modellgussgerüsts bei Doppelkronen
36.9 Langzeitergebnisse mit Doppelkronen
Literatur
37 Geschiebeprothetik: Doppelkronensysteme – Klinischer und labortechnischer Ablauf
37.1 Einleitung
37.2 Planung
37.3 Klinik: Präparation und Abformung der Pfeilerzähne
37.4 Labor: Herstellung von Präparationsmodell (Sägemodell) und Innenkronen
37.4.1 Herstellung der Innenkronen mit CAD/CAM-Verfahren
37.5 Klinik: Anprobe der Innenkronen und Fixationsabformung
37.6 Labor: Herstellung von Konstruktionsmodell und Registrierschablone
37.7 Klinik: Gesichtsbogenübertragung, Kieferrelationsbestimmung und Modellmontage
37.8 Labor: Zahnaufstellung in Wachs
37.9 Klinik: Anprobe der Zahnaufstellung in Wachs
37.10 Labor: Herstellung der Außenkronen und des Modellgussgerüsts
37.10.1 Herstellung der Außenkronen und des Verbinders im CAD/CAM-Verfahren
37.11 Klinik: Anprobe des Modellgussgerüsts zusammen mit der definitiven Zahnaufstellung in Wachs
37.12 Labor: Fertigstellung der Doppelkronenkonstruktion
37.13 Klinik: Anprobe der fertigen Arbeit und Zementieren
37.14 Nachsorge
37.14.1 Haftkraft bei Doppelkronen nach Eingliederung korrigieren
Literatur
38 Einführung in die Hybridprothetik
38.1 Einleitung
38.2 Indikationsstellung und Voraussetzungen
38.3 Verankerungselemente
38.4 Gestaltung der Wurzelstiftkappe
38.5 Gerüstgestaltung
38.6 Okklusionskonzep t
38.7 Langzeitprognose
Literatur
39 Hybridprothetik: Klinisches und labortechnisches Vorgehen
39.1 Klinik: Präparation der Pfeilerzähne und Abformung der Wurzelkappen
39.2 Labor: Herstellung der Wurzelstiftkappen und eines individuellen Löffels
39.3 Klinik: Anprobe der Wurzelstiftkappen und Abformung
39.4 Labor: Herstellen der Meistermodelle und der Registrierschablonen
39.5 Klinik: Gesichtsbogenübertragung und intraorale Registrierung
39.6 Labor: Einartikulieren der Meistermodelle und Zahnaufstellung in Wachs
39.7 Klinik: Anprobe(n) der Zähne in Wachs/Labor: eventuelle Korrekturen
39.8 Labor: Verschlüsselung der Situation, Auswahl der Verankerungselemente, Erstellung eines Einbettmassenmodells, Anfertigung der Wachsmodellation des Gerüsts
Читать дальше
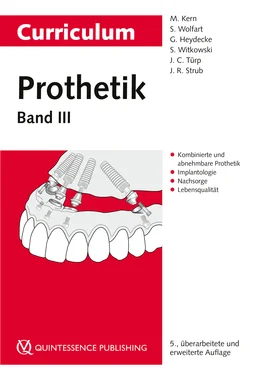

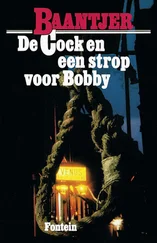
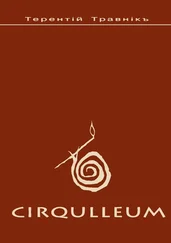
![Сергей Васильев - Curriculum vitae [СИ]](/books/430745/sergej-vasilev-curriculum-vitae-si-thumb.webp)