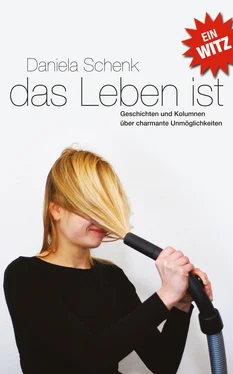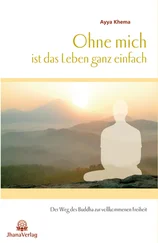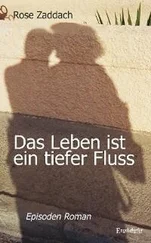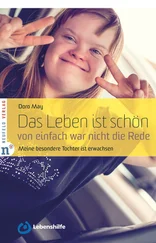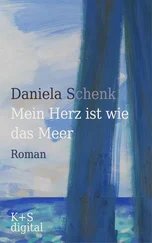Man hat bei manchen Menschen den Eindruck, dass sie eine große oder eine schlimme Zukunft vor sich haben. Und liegt daneben. Dazu zwei Beispiele: Ich arbeitete in einem anthroposophischen Heim für geistig Behinderte. Einmal musste ich einen Pensionär in die eurythmische Behandlung begleiten. Im Warteraum saß ein junger, stattlicher Mann, daneben seine Mutter, die mir unter Tränen erzählte, dass ihr Sohn kurz vor der Hochzeit einen Unfall hatte, der ihm das Gehirn zerstörte. In seinem Gesicht konnte man noch den gesunden Menschen ausmachen, der er gewesen war, aber er murmelte Unzusammenhängendes, war weggetreten. Dieser Mann hatte eine strahlende Zukunft vor sich: toller Beruf, baldige Hochzeit – ein paar Minuten ohne Sauerstoff, und die Zukunft änderte sich dramatisch.
Eine Freundin von mir hingegen hatte sich in den Achtzigern mit dem HIV-Virus angesteckt. Sie war schon immer ein kränklicher Mensch, so war klar, dass sie wohl sterben würde. Die Hellseherin meiner kalten Füße sagte ihr den baldigen Tod voraus, und man hätte meinen können, dass sie damit recht haben würde, in den Achtzigern starben ja fast alle, die sich infiziert hatten. Die Freundin lebt immer noch.
Wenn also Sieglinde sagt, dass Toves und meine Beziehung keine Zukunft hat, mag sie Recht haben. Oder nicht. Wir wissen es einfach nicht, wir können nicht wissen.
Ich arbeitete mit einer Engländerin zusammen, die seit zwanzig Jahren mit einem Schweizer verheiratet ist. Während der ersten drei Jahre lebte sie in England und er in der Schweiz – zu einer Zeit, als es weder Skype noch WhatsApp noch tiefe Telefonkosten gab. Sie sagte zu mir: „Denk dran, wenn eine Fernbeziehung zerbricht, zerbricht sie nicht an der Distanz, sondern weil es zwischen den beiden nicht gestimmt hat.“
Natürlich hat eine Fernbeziehung gewisse Nachteile: Ich liege oft allein im Bett; die Flüge gehen ins Geld; wenn ich Grippe habe, muss ich den Tee selber zubereiten; ich komme nur sporadisch zu Sex; kann nicht spontan mit Tove etwas unternehmen; muss die Wochenenden selber gestalten und alleine Ramsch entsorgen.
Es gibt aber auch Vorteile: Ich habe genug Platz beim Schlafen; kann viel reisen und Flugmeilen sammeln; der Sex ist immer noch aufregend; niemand stört mich, wenn ich krank im Bett liege; an den Wochenenden kann ich tun, was ich will, und so viel Ramsch muss ich nun auch nicht entsorgen.
Hat eine Fernbeziehung mehr Nachteile oder Vorteile? Sagen wir es so: je nachdem. Wenn ich mit Tove zusammen bin, sind die Nachteile verschwindend klein. Wenn ich mich von ihr verabschiede, schnellen sie in die Höhe. Wenn ich allein einen gemütlichen Abend verbringe, bin ich mit der Situation zufrieden. Wenn ich ohne Tove etwas Schönes erlebe, finde ich ihre Abwesenheit einfach nur Scheiße.
Was uns hilft, sind die modernen Kommunikationsmittel: Wir schreiben uns viele SMS und über Facebook Nachrichten, wir schicken uns Fotos zu oder skypen miteinander. Manchmal nerven sich meine Freunde, wenn ich Tove SMS schreibe. Da sage ich: „Du kannst deinen Schatz jederzeit sehen, ich nicht, also lass mich meinen Kontakt mit Tove halten.“
In einer Fernbeziehungen lebt man zwei Leben – eines mit sich und eines mit der Liebe, und am Schlimmsten ist die Schnittstelle, dann wenn es um den Abschied geht: Eine muss das Land wechseln und zu Hause wieder ihr Leben aufnehmen; die andere sich in der leeren Wohnung zurechtfinden. Wir schauen uns ein letztes Mal in die Augen, dann reißen wir uns voneinander los, und jedes Mal kommt mir die Liedstrophe von Cole Porter in den Sinn: Ev‘ry time we say goodbye I die a little .
Ich sterbe tatsächlich ein bisschen, aber ich muss den Zug erwischen, am Flughafen das Gepäck aufgeben, durch die Sicherheitskontrolle, ins Flugzeug, in Zürich aufs Gepäck und auf den Zug warten, umsteigen, zu Hause ankommen – das ist lästig, hilft jedoch, den Wechsel zu bewältigen. Nach jeder Trennung bin ich überzeugt: Ich werde Toves Nähe bis zum nächsten Wiedersehen auf meiner Haut spüren, aber in Bern rückt sie dann doch in die Ferne. Vielleicht ist das gut so, sie muss wohl wegrücken, damit ich da sein kann, wo ich eben bin.
Ich saß einmal mit meiner Freundin Hortense in der Launch eines Hotels. Das Paar, welches das Hotel leitete, kam zu uns und grüßte uns herzlich. Als es gegangen war, erzählte mir Hortense, was sie von dem Paar wusste: Die beiden waren verheiratet und hatten aus dieser Ehe Kinder. Sie lernten sich kennen, verliebten sich ineinander und trafen ein ungewöhnliches Abkommen: Bis die Kinder groß waren, führten sie ihre Ehen weiter und verbrachten pro Jahr zwei Wochen miteinander. In diesem Arrangement lebten sie sechszehn Jahre lang. Als die Kinder erwachsen waren, ließen sie sich scheiden und heirateten einander. Das Paar strahlte Glück und Innigkeit aus, man konnte die Liebe schier mit den Händen greifen. Irgendwie überstand es die langen Jahre des Getrenntseins, und offensichtlich hat es sich gelohnt. Machte gerade die Tatsache, dass die beiden ausharren mussten, ihre Liebe besonders stark?
Es ist also möglich. Vielleicht.
Ich warte geduldig, ich warte so ungeduldig darauf, dass sich der Nebel lichtet, und ein Weg sichtbar wird.
Es gibt Dinge, die mache ich nur am Anfang einer Beziehung. Wenn die Schmetterlinge in meinem Bauch eine Flugschau veranstalten, will ich unbedingt Dinge tun, die ich nicht gerne tue. Später nehme ich Vernunft an.
Ich will diese Dinge tun, weil sie wahnsinnig romantisch sind. Das weiß ich aus Spielfilmen; zum Beispiel duschen. In Filmen duschen Verliebte dauernd zusammen – heiße Körper machen dreckige Dinge zwischen Duschgel und Brause: Lustvolles Stöhnen klatscht an Kacheln, Sprühregen überall, und man kann es geradezu spüren: Nass ist es ü-ber-all!
Wenn Verliebtheit mein Hirn in Stroh verwandelt, will ich solche Duschszenen nachspielen: Es gibt nichts Schöneres, als nach ausgiebigem Liebesspiel gemeinsam unter die Dusche zu hüpfen, ausgiebig zu küssen, sich ausgiebig einzuseifen und ausgiebig was auch immer zu tun.
Solange Stroh in meinem Kopf ist, ignoriere ich, dass ich beim gemeinsamen Duschen voll eingeseift in der Kälte stehe, und es zwischen den Beinen zu jucken beginnt. Stehe ich wieder unter dem Wasserstrahl, tut es meine Geliebte nicht. Wir küssen tapfer, ab und zu stoße ich mit dem Hinterkopf an die Duschbrause, ab und zu fällt die Seife zu Boden und wenn ich mich danach bücke, stehen Körperteile im Weg. Und so weiter und so fort. Am Schluss trocknen wir uns gegenseitig, was ich nicht sexy finde, denn wenn jemand ein Badetuch um mich legt, fühle ich mich wie ein Kind, das von Mami trockengerieben wird.
Bekanntlich schleicht sich die Verliebtheit früher oder später aus der Affäre, das Stroh im Kopf wird wieder zu Gold vernünftiger Gedanken gesponnen, und es kommt unweigerlich der Moment, da eine von uns (beiläufig, vorsichtig) sagt: „Du, ich dusche kurz alleine, wir sind ja in Eile. Nur dieses eine Mal.“
Wir sind danach immer in Eile und duschen wieder einsam zwar, aber genau so, wie wir es am liebsten haben.
Das Gold meiner vernünftigen Gedanken verspricht mir: Nie mehr lassen wir uns auf ungemütliches Duschen zu zweit ein.
Das schwöre ich mir hoch und heilig. Bis zum nächsten Stroh im Kopf.
Ich habe eine Freundin mit einer langen Leitung: Erst in ihren späten Dreißigern erkannte sie, dass sie in einer Beziehung lieber zu zweit menstruiert als allein, und wurde lesbisch. Vor dieser Zeit hatte sie eine Tochter geboren, nennen wir sie Nina. Dieses Mädel ist jetzt dreizehn und hat nur eines im Kopf: Jungs.
Die Pubertät verwirrt bekanntlich so manchen Geist.
Einmal traf ich Nina an einem Sommernachmittag, als es dreißig Grad heiß war. Sie trug Hotpants, Sommerschuhe, T-Shirt und einen Schal. Da ich nicht groß darauf achte, was jemand trägt, habe ich mich nicht gefragt, warum Nina bei dieser Hitze einen Schal trägt. Es gehört zu den Aufgaben der Jugend, sich unmöglich zu kleiden – ich erinnere mich mit Vergnügen und Schamesröte an meine Teenagerkleidung: Pluderhose, Jesus-Sandalen, riesiges Bauernhemd, gestricktes Mützchen und Brottasche. Also warum nicht bei dreißig Grad ein Halstuch tragen?
Читать дальше