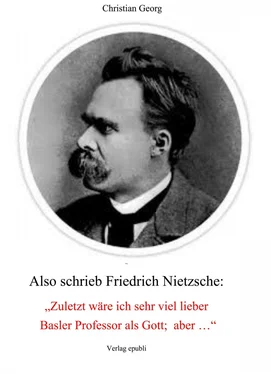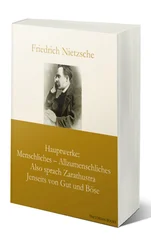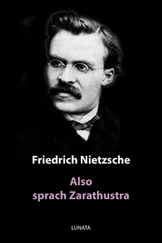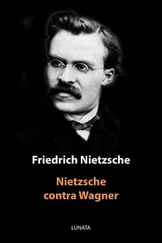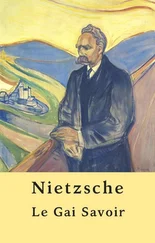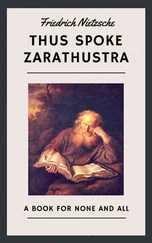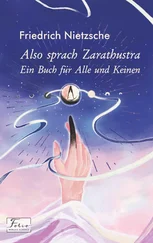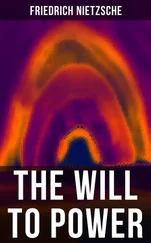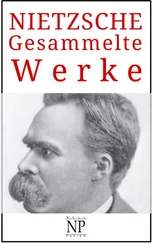29 Jahre später, im Juni-Juli 1885, erinnerte N sich noch einmal an diese sündhaften „Gedanken“ seiner Jugend und notierte sich:
Der ersten Spur philosophischen Nachdenkens [es war auch das aber nur ein hochspekulativer Effekt! - und N wird ihn gar für „ wissenschaftlich “ gehalten haben!], der ich, bei einem Überblick meines Lebens, habhaft werden kann [N nahm darauf bereits im Frühling-Sommer 1878 schon einmal Bezug!], begegne ich in einer kleinen Niederschrift aus meinem 13. Lebensjahre [was erstens heißt, dass N sich als 41-jähriger ernsthaft mit Schriften aus seiner Kindheit beschäftigte und gab zweitens einen Hinweis darauf, dass selbige ihm sehr wichtig waren und drittens, dass er sich in der Angabe der Jahreszahl irrte, zu der ihm sein umgewertetes Gottes-Teufelchen im Geiste erschienen war, was mit dieser Altersangabe erst dem 13-jährigen nach Mitte Oktober 1857 hätte geschehen können]: dieselbe enthält einen Einfall über den Ursprung des Bösen. Meine Voraussetzung war, dass für einen Gott Etwas denken und Etwas schaffen Eins und Dasselbe sei. Nun schloss ich so: Gott hat sich selbst gedacht, damals als er die zweite Person der Gottheit schuf: um aber sich selber denken zu können musste er erst seinen Gegensatz denken [weil für N selbst die Gegensätze, der Widerspruch, die Umwertung im oder als erlebtes „Denken“ immer so wichtig und von eigentlicher Substanz gewesen war?]. Der Teufel hatte also in meiner Vorstellung ein ebensolches Alter wie der Sohn Gottes, sogar einen klareren Ursprung - und dieselbe Herkunft . Über die Frage, ob es einem Gott möglich sei seinen Gegensatz zu denken, half ich mir damit hinweg, zu sagen: ihm ist aber Alles möglich [so eröffnete N sich alle Regionen des „Denkens“, indem er sich etwas ausdachte und ihm alles Ausgedachte auch möglich und richtig schien!]. Und zweitens: dass er es getan hat, ist eine Tatsache, falls die Existenz eines Gott-Wesens Tatsache ist, folglich war es ihm auch möglich“ 11.616, [nach den Gesetzen einer Art kriminologische Kinderphilosophie, über die N bis dahin - in zumindest diesem Punkt! - noch nicht hinausgekommen war].
Letztlich ging es N in dieser nachgelassenen „Erinnerung“ um die Festsetzung , dass aufgrund seines Erb-Priester-Herkommens nur Er einen „legitimen Anspruch“ auf eine aus dem Bauch heraus gewonnene „genaue“ oder sogar als „wissenschaftlich gelten könnende Kenntnis“ über die zeitgemäß völlig belanglose „Entstehung des Teufels“ erheben und damit sogar Recht haben könnte mit dem, was er sich dazu hatte einfallen lassen, beziehungsweise hatte einfallen lassen wollen und dies also für richtig und wichtig hielt! Es war ein momentaner Plan, wie so viele andere, die ihm - zumeist kurzfristig! - kamen. Er hat das heikle Thema dann ja auch, wie übrigens etliche andere, nicht weiter verfolgt, so dass im Rückschluss daraus nahe zu liegen scheint, dass der Beginn der Aufzeichnung, nämlich „Gott in seinem Glanze gesehen“ zu haben, ihm vor allem dazu dienen sollte, seine „Kompetenz“ für das so herrlich gewagt und aufsässig wirkende Thema herauszustreichen, denn außerhalb dieser Notiz ist in den unendlich vielen Nachlassschriften dazu kein weiterführender Hinweis auf diese Zusammenhänge zu finden; - auch wenn N sich im Laufe der Jahre viel damit herumschlug, „den Teufel zum Advokaten Gottes“ 10.55zu machen.
Sollte es dennoch ein echt zu nennendes „Erlebnis“ dieser Art gegeben haben - schließlich scheint N dem Freund Overbeck gegenüber einige Jahre bevor diese Notiz entstand davon erzählt zu haben! - dass er „als Kind Gott in seinem Glanze gesehen“ hätte, so weist das in die Richtung des bei ihm immer wieder vorkommenden Motivs der „Lichtfülle“, des „Glanzes“, der „Erleuchtung“, des „Von-Licht-umflossen“ und „Von-Licht-umgürtet“ und auch „Flamme“ zu sein - wobei es jedes Mal um die Beschreibung von „Erscheinungen“ ging, die ihm zugleich als Erkenntnisse und als Erlebnisse „vorgekommen“ waren! - weshalb bei ihm wohl auch Erlebnis und Philosophie , „philosophisches Leben“ und „gelebte Philosophie“, also Gedachtes und erlebbare, ja tatsächlich erlebte „Realität“ wie bei keinem sonstigen „Philosophen“ zusammenfielen und ein und dasselbe zu bedeuten hatten: Etwas Geheimnisvolles, nie wirklich klar Benanntes, aber abnorm zu Nennendes „geistert“ durch Ns Biografie und Schaffen, - und sollte sich „in Bälde“, ab 1861 schon, mit etlichen Aussprüchen von Ralph Waldo Emerson in klärenden Einklang bringen lassen! Das Gleiche gilt für die ungefähr in zwölf Jahren, Herbst 1868 bis Frühjahr 1869, auftauchende, halluzinierte „Gestalt hinter meinem Stuhle“. BAW5.205Es geht also um nichts Einmaliges, sondern um in verschiedenerlei Gestalt wiederkehrende Erlebnisse oder „Ereignisse“ recht eigenartigen Charakters. Der überwältigende Zusammenhang dieser „Absonderlichkeiten“ wird mit Emerson des Genaueren zu klären sein, wenn N diesem 1861 dann, als seinem „Erlöser“, auf einer Ferienreise begegnen wird.
Am 25. Mai 1856 schrieb Franziska N aus Naumburg, wieder unter anderem, ihrem Vater in Pobles:
Fritz ist ein großer blühender Knabe und geht mir ein Stück über die Schulter, macht auch in geistiger Beziehung recht gute Fortschritte, hat zwei liebe Jungen, die Söhne der Apellationsräte Pinder und Krug zu Busenfreunden und es ist viel geistiges Leben unter ihnen. Fritz bleibt noch seinem Vorsatz treu, geistlicher zu werden, setzt darum Psalmen in Musik, schreibt auch kleine Theaterstücke, wo diesen Winter zu aller Ergötzen bei Rat Pinders eines zur Aufführung kam, betitelt „die Götter auf dem Olymp“ und eben schießt er im Hof einen Vogel ab. -
Wie realistisch das Letztere gemeint sein mag bleibe dahingestellt. Aller Wahrscheinlich handelte es sich um eine Scheibe in Vogelgestalt beim Armbrustschießen, wie Paul Janz es als Spiel des Kandidaten Weber für das Jahr 1851 erwähnte.
Kurze Zeit später beeindruckte N eine Aufführung von Georg Friedrich Händels „Judas Maccabäus“ im Naumburger Dom ganz gewaltig. Er hörte auch andere Werke, beispielsweise Haydns „Schöpfung“, Mendelsohns Sommernachtstraum und anderes mehr.
Am 30. Juli 1856 schrieb Franziska wieder auch über N an ihren Vater und zwar anlässlich eines Besuches von einem Verwandten von der väterlichen Seite her:
Er [dieser Verwandte] ist wirklich ein ausgezeichneter Mann und durch seinen klaren Verstand, sein richtiges Urteil, sein großes Interesse für alles Religiöse, in seiner ruhigen würdigen Bewunderung der Größe Gottes, der Erhabenheit desselben als Schöpfer, Welt-Erhalter und so fort, des Herrn Christus und seiner Lehre eine wirklich erfreuliche und erbauliche Erscheinung unserer Zeit, besonders als Kaufmann. Dabei der liebenswürdigste und sorgsamste Vater seiner Kinder, [und nun kommt das Wichtige: er] hat auch große Freude an Fritz wo er meint: er sähe Luther ähnlich und würde am Ende in Luther [Martin Luther, 1483-1546, Urheber und Lehrer der „Reformation“ - ein Erneuerer der Kirche gewissermaßen! - was die dauerhafte, fundamentale „Abspaltung“ der evangelischen von der katholischen christlichen Kirche zur Folge hatte!]. Es wäre ihm eine wahre Freude diesen kräftigen und prächtigen Jungen zu sehen ….. “
Zu dem Zeitpunkt, wo dies geäußert wurde, war N knapp zwölf Jahre alt und somit eine Ähnlichkeit mit Luther gewagt! Solche Urteile von einem Mann mit angeblich „klarem Verstand“ und „richtigem Urteil“! Auf welchen Druck, auf welche Erwartungshaltung in Ns Umgebung ist daraus zu schließen? Es dürfte sicher sein, dass Jung-N derlei zu Ohren kam, wenn es ihm nicht gar angelegentlich direkt unter die Nase gerieben wurde, dass man dazu neigte, solche zwar „auszeichnenden“, dennoch aber unrealistischen Erwartungen an ihn zu stellen! Sollte N den Eindruck bekommen, dass man von ihm erwartete, ein neues Reformationszeitalter bewirken zu müssen? Und dass er dies bei seiner ohnehin gegebenen Neigung zum Maßlosen für den Erhalt seiner überhaupt etwas zu bedeuten haben könnenden Existenz als Richtschnur und Maß seines möglichen Anerkannt-werdens verinnerlicht hat?
Читать дальше