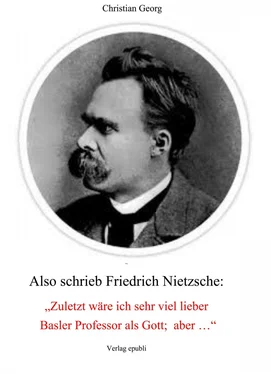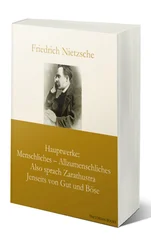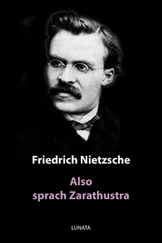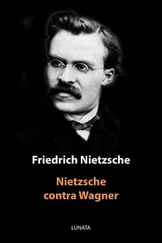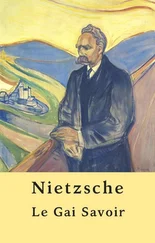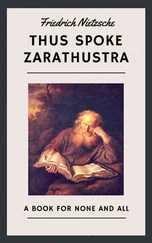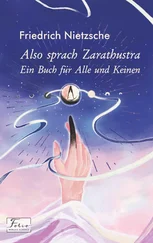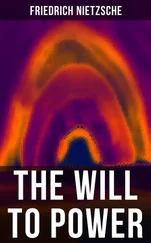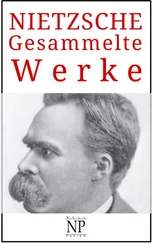Irgendwo wirkt das alles wenig auffällig und scheinbar „ganz normal“. Dennoch dürfte der Brief einen kleinen Einblick in den so etwa gepflegten „Umgangs-Stil“ geben und ist damals sicherlich Ausdruck der „üblichen Erwartungshaltung“ dem gerade mal sieben Jahre alt gewordenen Jungen gegenüber gewesen. Im Bewusstsein von Ns Lebensweg scheint diese Art von immer wiederkehrendem, mehr oder weniger „sanft“ gepflegtem Druck - mit Unterstellungen und Forderungen! - welche ihm vorgaben, etwas Besonderes sein zu müssen , um Anerkennung - auf die er seelisch so sehr angewiesen war! - finden zu können, üblich gewesen zu sein, so dass N viel von dieser „Treibhausatmosphäre“ viel verinnerlicht haben wird, weil er sich in dieser - auf Gedeih und Verderb gewissermaßen! - zu profilieren hatte, um als sittsam, gehorsam, tüchtig, nützlich, angenommen und „pflegeleicht“ zu gelten! - Hier kam das für ihn, der sonst nur unter Frauen lebte, zusätzlich von einer männlichen Respektsperson, die zu ihm auf gleiche Weise sprach. Das war sicher nichts Ungewöhnliches, aber es war auf etwa diese Weise s eine Form der „Alltäglichkeit“, der er ausgesetzt war.
Zum Geburtstag erhielt N in diesem Jahr ein Klavier und musikpädagogischen Unterricht von einem alten Kantor.
1852
Die amerikanische Schriftstellerin Harriet Beecher-Stowe, 1811-1896, veröffentlichte den Roman „Onkel Toms Hütte“ gegen die Sklaverei und erreichte ein Millionenpublikum. Von dem französischen Philosophen und Mitbegründer der Soziologie, Mathematiker und Religionskritiker Auguste François Xavier Comte, 1798-1857, erschien ein „Positivistischer Katechismus“, als Versuch einer positivistischen Religion mit der „Menschheit als großes Wesen“. Inzwischen erschienen umfangreiche Konversationslexika als geordnete, übersichtliche Wissenssammlungen. In Nürnberg wurde ein Germanisches Museum gegründet.
Am 13. Januar 1852 schrieb die Mutter an ihren Vater:
Überhaupt habe ich den lieben Gott bei allem Schweren doch recht herzlich zu danken für die körperliche und geistige Entwicklung meiner lieben Kinder, welche uns eine wahre Freude sind. Fritz ist fleißig kommt in der Schule immer weiter herauf und erwirbt sich durch seinen buchstäblichen Gehorsam die Liebe seiner Lehrer und ist dabei mein zärtlich liebender Sohn, natürlich nicht frei von Mängeln aber Gott sei Dank, samt Lieschen - vergnügt und munter KGBI/4.269
Am 1. November 1852 schrieb die Mutter:
Fritz ist gottlob auch fleißig und beide sehr zärtlich gegen ihre alte Mutter [sie war da erst knapp 27 Jahre alt!]. Fritz ist noch vom Keuchhusten verschont und sitzt mir, denkt Euch, aller Augenblicke einmal auf dem Schoß oder steht hinter mir auf dem Stuhl um mich abzudrücken und abzuküssen, wo Lieschen nicht nachstehen will und deshalb oft ein edler Streit entsteht. KGBI/4.271
Ende des Jahres erkrankte N an der Streptokokken-Infektion Scharlach, was früher, unbehandelt durch die noch nicht bekannten Antibiotika, mit gefürchteten Spätkomplikationen verbunden sein konnte. Die Mutter schrieb darüber:
Im ganzen müssen wir mit dem Verlauf der Krankheit recht zufrieden sein, er wird jetzt alle Abende mit überschlagenem Wasser abgewaschen und sieht ganz munter aus, wenigstens äußerlich, innerlich übrigens unverändert das gute, tiefe Gemüt, wodurch er uns durch seine Folgsamkeit die Krankenpflege sehr erleichtert hat; welche Sorge ich aber ausgestanden habe, als es hieß es wäre Scharlach ….. denn diese Krankheit fordert hier [bei einem gegenüber heute unvergleichlichen Stand der Medizin] so viele Opfer, in den verschiedensten Kindesaltern.
Das waren Einblicke, zu denen es nicht viel zu sagen gibt. Die Jahre der Kindheit sind für jeden auf mehr oder weniger gleiche Weise angefüllt mit derlei und auch anderen Sorgen und Freuden. Die Pflegeleichtigkeit wurde immer wieder hervorgekehrt, erwähnt und bestätigt. Sein Leben lang übrigens galt N im praktischen Leben allen Menschen gegenüber als ungewöhnlich freundlich, zurückhaltend, liebens-, ja bewundernswert, dabei bescheiden und verständnisvoll: So völlig anders, als er sich in der stets Superlative anstrebenden Parallelwelt seiner „Theorien“, Aphorismen und Sprüche gebärdete - in dem also, was als seine so originelle „Philosophie“ gelten sollte! - Diese Andersartigkeit des einen zum andern wird seine ergründbaren Ursachen haben: Sie gehören zu Ns - in diese beiden Seiten gespaltenen! - Wesen, wie im Lauf seiner Entwicklung nach und nach klarer hervortretend zu erkennen ist.
1853
Es begann der fast 4 Jahre währende russische Krimkrieg. Richard Wagner war mit dem Text zu den Ring-Opern vom Rheingold bis zur Götterdämmerung beschäftigt. Der weit außerhalb von Ns Wahrnehmung gelegen habende niederländische expressionistische Maler Vincent van Gogh wurde geboren. Das bis dahin als Laufrad aufgekommene Fahrrad erhielt einen Tretkurbelantrieb. Krupp stellte nahtlose Eisenbahnräder her und es mehrten sich internationale Abkommen.
In dieses Jahr gehört eine aus den Familiengeschichten stammende Aussage der Schwester Elisabeth:
Dass mein Bruder sich selbst als meinen Erzieher betrachtete, hat er so oft hervorgehoben, dass ich es wohl erwähnen muss. Er gab mir die Bücher, die ich lesen durfte, überwachte meine Schularbeiten und war für die Bildung meines Geistes und Charakters sehr bedacht. Niemals habe ich es gewagt, mich gegen seine Autorität aufzulehnen, im Gegenteil - Alles was er sagte war mir Evangelium und über jeden Zweifel erhaben. BmN.9
Diese „Autorität“ war N insofern angetragen, als niemand - vor allem Elisabeth selber! – diesem Anspruch widersprach . Insofern wurde er N, seinem Willen entsprechend, unterstellt. Es gab nichts, wogegen N sich hätte durchsetzen müssen. Diese „Autorität“ war ihm in den Schoß gefallen. Ohne eine eigentliche Leistung dafür erbracht zu haben, genoss er dabei den Umstand, der Bestimmende, der geistig Überlegene, der Führende zu sein, doch war er durch nichts weiter legitimiert als dass er knapp 2 Jahre älter war als die sich ihm unterwerfende Schwester. Er übte unbewusst und einfach der Gegebenheiten wegen seine Vormachtstellung aus und definierte sich auch selbst über diese erlebte Bestimmen-Können - und über die Tatsache, dass ihm ohne bemerkenswerten Widerstand Folge geleistet wurde! Auf diese Weise trainierte er „Herrscheramtsgefühle“, nicht widerwillig, sondern weil es ihm ins Blut gelegt war, zu dominieren. Genaueres dazu wird sich in wiederkehrenden Erscheinungen dieses Verhaltens erweisen. Er hat diese „Autorität“ als selbstverständlich gelebt , genossen und - weil es sich so ergeben hatte! - es auch gebraucht , über jemanden nach seinem Dafürhalten verfügen zu können! Das Verhalten des „Verfügens“ sollte zu einem wesentlichen Faktor seines „Philosophierens“ werden, wohingegen aber er sich im täglichen Leben, „den Anderen“ gegenüber, entfernt nicht mit gleicher Selbstverständlichkeit durchzusetzen vermochte und das Gefühl der Überlegenheit nur in seltenen Fällen erlebt, insgesamt alles andere als zur Gewohnheit wurde und ihn in scheinbare Harmonie ausweichen ließ!
Wie weit diese „Herrschaft“ Ns über die Schwester ging beschrieb sie auf unbeabsichtigt eindrückliche Weise selber:
Leider durfte ich auch zu Hause fast nie mitspielen, wenn seine Freunde zugegen waren. Mein Bruder empfand, wie alle Jungens, die Gegenwart des weiblichen Elements [so drückte man geschlechtsspezifisch unterschiedliches Verhalten „tugendhaft“ aus - zu einer Zeit, in der noch das offen ausgesprochene Wort „Schenkel“ Ohnmachtsanfälle hervorrufen konnte. Sie galt also] bei richtigen Knabenspielen als hinderlich und überflüssig. So erinnere ich mich noch eines Sonntag Nachmittags, an dem Fritzens Freunde, dazu noch einige seiner Bekannten, zu uns eingeladen waren, darunter ein kleiner Knabe Ernst, Sohn eines russischen Staatsrates, der mit Großmütterchen von ihrer ersten Heirat her verwandt war. Dieser kleine Deutsch-Russe fand nun einiges Wohlgefallen an mir und als ich aus der Ferne mit den sehnsüchtigsten Blicken nach den Festungs- und Soldatenspielen schaute [im nachgestellten, parallel aber auch echt ausgetragenen Krimkrieg zwischen Russland und dem Osmanische Reich, Frankreich, Großbritannien von 1853 und ab 1855 bis 1856 auch noch dem Königreich Sardinien als „wirklichkeitsnahem Anlass zu diesem Spiel], machte er den überraschenden Vorschlag: „Lasst doch das kleine [7-jährige] Mädchen mitspielen ….. Alle Jungens starrten mich an, als ob sie mich noch nie gesehen hätten; den Grund, welchen der kleine Russe ….. angab, fanden sie einfach unverständlich oder kläglich. Schließlich ermannte sich der älteste der Freunde, den mein Bruder beunruhigt fragend ansah, zu einem mürrischen: „Meinetwegen“.
Читать дальше