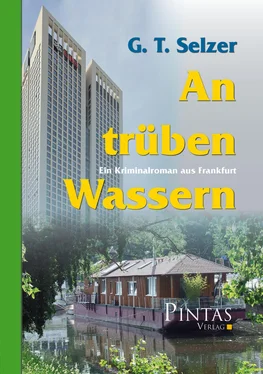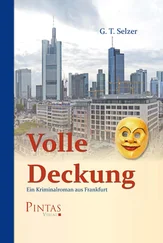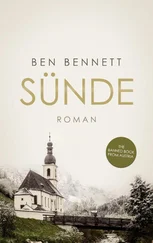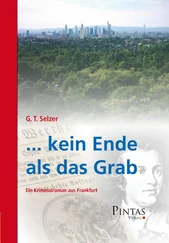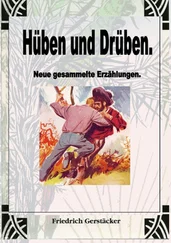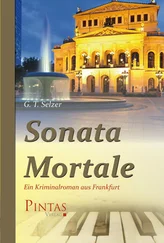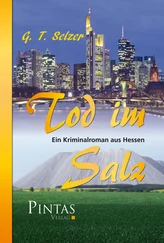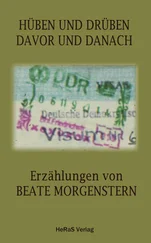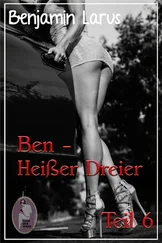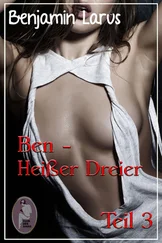Dann stieg er langsam aus.
Als Polizei und Rettungswagen sich mehr als eine Viertelstunde später endlich mühevoll eine Rettungsgasse durch das Chaos der Blechlawine hinter dem Unfall gebahnt hatten, fanden sie ihn immer noch zitternd an seinen Kotflügel gelehnt. Außer einem tiefen Schock hatte er keinerlei Verletzungen davongetragen.
Der riesige 24-Zoll-Bildschirm warf sein flackerndes Licht auf einen mit einer starken Schreibtischlampe beleuchteten Arbeitsplatz. Der Rest des stylischen Großraumbüros lag im Halbdunkel; nur durch die Glastüren, die zum Flur hinausgingen, drang gedimmtes Licht. Auf dem Monitor prangte eine CAAD-Darstellung, die dreidimensionale Innenansicht eines modernen Bürokomplexes; sein etwas kleinerer 19-Zoll-Kollege neben ihm zeigte eine Aufriss-Skizze desselben Gebäudes.
Daniel Skipanski ließ die Maus los, bog aufatmend die Arme hinter den Kopf, streckte seine langen Beine aus und ließ seinen Blick noch einmal über die beiden Bildschirme wandern. Er nickte zufrieden vor sich hin. Das Projekt gedieh und würde, wie fast alles in den letzten Jahren, ein Erfolg werden – ein Erfolg, der ihm manchmal Angst machte, weil er so schnell gekommen war. Skipanski hatte die Vierzig bereits überschritten, als er seine Stellung in einem Frankfurter Architekturbüro gekündigt hatte, um sich selbständig zu machen. Jetzt, knapp acht Jahre später hatte er es geschafft; dieses Büro im 39. Stock des Opernturms war nicht nur in geografischer Hinsicht der Höhepunkt seines beruflichen Aufstiegs.
Er wandte den Kopf den großen Fenstern zu, die eine grandiose Sicht auf Teile der nächtlich erleuchteten Frankfurter Skyline freigaben: Wunderwerke der Architektur, konzentriert auf minimalem Raum in einer dafür eigentlich zu kleinen Stadt, die sich stolz und legitim mit dem hektischen Nimbus einer Weltmetropole umgab, während außerhalb der lauten, doch recht überschaubaren City in den vielen Stadtteilen das gemütliche, kleinstädtische Flair vorherrschte.
Direkt gegenüber dem Bürofensters ragten die glitzernden Zwillingstürme der Deutschen Bank mächtig, fast bedrohlich in den Abendhimmel; vom anderen Fenster fiel der Blick, wenn man davor stand, tief nach unten auf das grüne Dach der Alten Oper.
Skipanski sah auf seine Armbanduhr. Gleich sieben. Feierabend. Marion und Kathrin waren sicher schon längst wieder zu Hause, und sie wollten heute Abend alle zusammen essen gehen. Er hatte versprochen, pünktlich zu sein. Er speicherte seine Arbeit ab, sicherte sie nochmals auf einer separaten Festplatte und stand auf
Während er seinen Mantel anzog, begann draußen im Halbdunkel des Empfangs das Telefon zu klingeln. Frau Klose, glückliche Teilnehmerin an der Aktion geregelte Arbeitszeit, war bereits vor über einer Stunde gegangen; von den beiden anderen festangestellten Architekten hatte einer Urlaub, der andere praktizierte irgendwo auf der A66 stop and go auf dem Rückweg von einem Kundengespräch.
Innerlich fluchend, den einen Arm bereits im Mantel, den anderen suchend nach dem zweiten Ärmel hinter sich gestreckt, beugte sich Daniel vor und nahm das Gespräch an seinem Apparat an.
„ Architekturbüro Skipanski, guten Abend.“
„ Guten Abend. Ich möchte Herrn Daniel Skipanski sprechen.“
„ Am Apparat. Wer spricht denn da?“, fragte er gereizt. Ungeduldig fuchtelte er mit dem linken Arm nach hinten, der Mantel hatte sich irgendwie verheddert. Doch etwas in der Stimme des Anrufers ließ ihn den Hörer nicht gleich wieder auf die Gabel zurückwerfen, wie er es mit ungebetenen Telefonaten immer zu tun pflegte.
Zehn Minuten später fand ihn Bernhard Müller – sein Mitarbeiter, der, endlich dem Stau entkommen, eigentlich nur kurz die Unterlagen ins Büro bringen wollte – am Schreibtisch sitzend, mit kalkweißem Gesicht blicklos vor sich hin starrend. Die linke Mantelhälfte lag zerknüllt mit noch immer losem Ärmel neben ihm auf dem Bürosessel.
Der junge Architekt rüttelte ihn, erst sachte, dann fester am Arm. „Herr Skipanski! – Hören Sie mich? Daniel!“
Aus leeren Augen starrte Daniel ihn an. „Ich muss nach Hause; die Pizza ...“
Bernhard Müller kramte in den Resten seiner Erinnerungen an die Sofortmaßnahmen am Unfallort, die schon einige Jahre zurücklagen, und erkannte den schweren Schock, unter dem sein Chef stand. Er telefonierte nach dem Notarzt, verfrachtete Daniel vorsichtig auf den Teppichboden, während er ihm den Mantel endlich vollends anzog und legte ihm seinen eigenen Mantel darüber. Dann ging er in die Küche, um einen besonders süßen Tee zuzubereiten, vom dem er zwar wusste, dass Skipanski ihn verabscheute, über den er andererseits in solchen Situationen aber nur Gutes gehört hatte. Schließlich rief er seine Frau an und sagte ihr, dass es später werden würde.
Der Prozess gegen Rolf Suttner, den Fahrer des Audi, der Daniel Skipanskis Frau und Tochter getötet hatte, war für sechs Monate später angesetzt worden. Die Anklage lautete auf fahrlässige Tötung in zwei Fällen. Daniel Skipanski saß als Nebenkläger vorne neben seinem Anwalt Klaus Breuer; der Staatsanwalt hatte ihn kühl und sachlich begrüßt, ihn dann jedoch nicht weiter beachtet; Suttners Verteidiger von der Bank gegenüber ignorierte ihn völlig. Die vorsitzende Richterin, bekannt für ihre raschen und kühl begründeten Urteile, schaute sich prüfend in dem kleinen Verhandlungssaal um.
Es war ein drückend-schwüler Julitag, die Fenster des alten Gerichtsgebäudes waren weit offen, ohne dass dies in irgendeiner Weise für Abhilfe gesorgt hätte. Der Raum war nur mäßig besetzt. Ben Skipanski war einer der Zuschauer in der letzten Reihe.
Wer fehlte, war der Angeklagte.
Rolf Suttner, teilte sein Verteidiger dem Gericht beflissen und mit großer Geste mit, sei auf einer Geschäftsreise in den USA und habe diesen äußerst wichtigen Termin in Übersee nicht verschieben können. Er, der Anwalt, habe versucht, seinen Mandaten per E-Mail zu überzeugen, dass diese Verhandlung für Suttner wichtiger sei, doch keine Antwort erhalten. Ebenso wenig sei er auf seinem Handy zu erreichen gewesen. Natürlich – der Anwalt hob beschwörend die Hände, die Seidenrobe fiel wie ein Messgewand an ihm herab – selbstverständlich hieße das nicht, dass der Angeklagte die Sache nicht ernst nähme; im Gegenteil, sie tue ihm unendlich leid.
Sein kurzer Seitenblick zum Staatsanwalt auf der anderen Seite des Verhandlungsraums entging der Richterin nicht: Anklage und Verteidigung hatten sich im Vorfeld abgesprochen, der Staatsanwalt würde aus dem Nichterscheinen des Angeklagten keine große Sache machen. Prompt erhob sich der Ankläger und beantragte ein Strafbefehlsverfahren, bei dem man auf die Anwesenheit des Beschuldigten verzichten könne. Der positive Nebeneffekt dieser Strategie für die Verteidigung lag in der Tatsache, dass damit das Strafmaß in jedem Fall auf Bewährung auszusetzen war.
Mit ausdruckslosem Gesicht lauschte die Richterin den Ausführungen der beiden Anwälte, schwieg danach ein paar Augenblicke, während sie ihren Blick zwischen Verteidiger und Staatsanwalt schweifen ließ – entschied gegen den Strafbefehl und beraumte die Hauptverhandlung an.
„ Wie jetzt?!“ Irritiert wandte sich Daniel an Klaus Breuer, der wie seine Kollegen begann, seine Sachen zusammenzupacken, nachdem das Gericht den Saal verlassen hatte. „Was heißt das denn nun?“
„ Glück gehabt, alter Freund“, antwortete Breuer grimmig. „Und eine Richterin mit gesundem Menschenverstand.“ Er beugte sich näher zu Daniel hin und raunte ihm zu, während seine Augen zwischen Strafverteidiger und Staatsanwalt hin und her gingen. „Das gefällt mir nämlich gar nicht, was die beiden sich da zusammenmauscheln ...“
Читать дальше