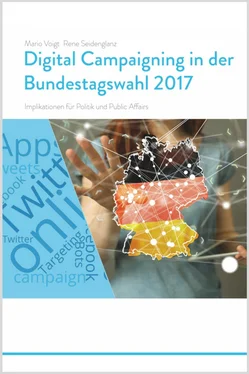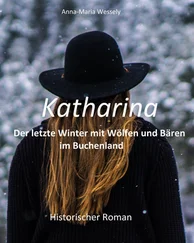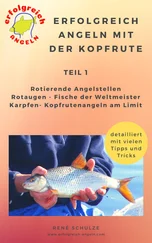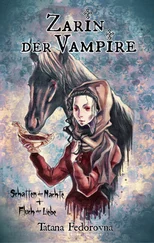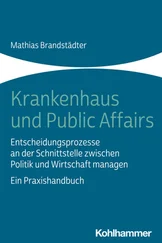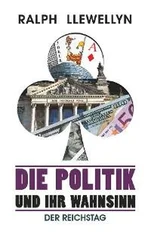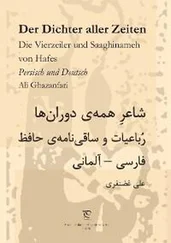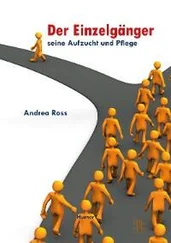1 Transparenz auf dem digitalen Marktplatz nimmt zu: Public Affairs wird stärker in Öffentlichkeiten und strategischen Allianzen denken.
Die Wendung der politischen Kommunikation und deren Akteure hin zur Echtzeitkommunikation auf unterschiedlichen Plattformen führt zu einer wachsenden Sichtbarkeit von politischen Debatten und Inhalten. Transparenz und Scheu gehen dabei Hand in Hand. Public Affairs Arbeit wird diesen digitalen Marktplatz nicht mehr verlassen können.
1 Digitale Hinterzimmer wachsen: Individualisierte Kommunikation sichert notwendigen Austausch.
Kein Licht ohne Schatten: Wenn auf dem digitalen Marktplatz der politische Diskurs tobt, braucht Public Affairs Arbeit auch weiterhin die Ruhe individualisierter Kommunikation und direkter Ansprache. Der Instrumentenkasten der Interessenvertretung erweitert sich, da die digitalen Touchpoints mehr werden.
1 Insourcing: Mit wachsenden Erfordernissen von Plattformen und Tools nimmt personeller Sachverstand und digitale Fanbase zu.
Die Zeiten sind vorbei, wo der Praktikant den Twitterkanal bedient hat. Bei den umfassenden Erfordernissen der digitalen Kommunikation ändert sich das Anforderungsprofil der Public Affairs Akteure. Sie müssen text- und tonsicher auf der digitalen Klaviatur spielen können. Dies wird in vielen Organisationen nur mit zusätzlicher personeller Professionalität und mehr finanziellen Ressourcen funktionieren.
1 Legislatur der digitalen Disruption: Das Anschwellen der digitalen Kommunikation führt zu einem Diskurs über den Umgang mit Daten und den sozialen Plattformen.
Der Parlamentarismus gewinnt mit der digitalen Kommunikation an Beteiligungsmöglichkeiten und dem dialogischen Bürgerkontakt. Das Digitale ist Teil des Politischen geworden. Es entstehen neue Fragen über den Umgang mit Daten und Plattformen.
Die Bundestagswahlen 2017 war der erste digitale Wahlkampf in Deutschland. Die Parteien und Kampagnen planten, segmentierten, kommunizierten und experimentierten im Internet mit neuen digitalen Formaten und Anspracheformen.
Bereits in den beiden vergangenen Bundestagswahlkämpfen 2009 und 2013 nutzten alle Parteien die neuen technologischen Möglichkeiten des Internets und griffen eher behutsam auf digitale Kampagnenelemente zurück. Die ersten wesentlichen Einsatzmöglichkeiten erkundeten die Parteien im Bundestagswahlkampf 2009, wo es zu mehr direkten und interaktiven Anwendungen kam (Albers 2009, Schmitt-Beck und Wolsing 2010, Rußmann 2016). Überaschenderweise zeigten sich anfangs die größeren Parteien als wesentlich experimentierfreudiger in den digitalen Kommunikationsangeboten als die kleineren Mitbewerber (Schweitzer 2010, 2011).
Schon frühzeitig prognostizierten Beobachter, dass der Bundestagswahlkampf 2017 einen deutlichen Fortschritt für die digitale Kampagnenkommunikation bedeuteten würde (Fuchs 2017). Dies verwundert nicht, wächst doch die Nutzung des Internets in Deutschland beständig. Über 80 Prozent der Bevölkerung verfügen über einen Internetzugang, die tägliche durchschnittliche Nutzungsdauer beträgt über zwei Stunden am Tag (ARD/ZDF-Onlinestudie 2016). Eine Mehrheit der Deutschen informiert sich im Internet über Politik, wobei bei einem Fünftel der Deutschen die sozialen Medien wesentliche Nachrichtenquelle sind (Yougov 2017). Während das Engagement der Bürger im Internet steigt und die Mediennutzung sich verändert, sinken die Mitgliederzahlen der Parteien kontinuierlich (Niedermayer 2017). Das politische Engagement wird situativer und bewegungshafter. Parteien und Kampagnen folgen dem gesellschaftlichen Wandel und dem veränderten Medienverhalten der Wähler und intensivieren ihre digitalen Kampagnenanstrengungen.
Die digitale Transformation wirkt auf die politische Kommunikation und Public Affairs. Fünf wesentliche Charakteristika des Internets belegen die transformative Kraft für die Demokratie und Gesellschaft (Norris 2000). Es ist ein interaktives Medium, das von der einseitigen Kommunikation bestehender Massenmedien abweicht. Vielmehr noch ermöglicht es die direkte, zielgruppen- und personengenaue Ansprache. Als aktiver und kreativer Kommunikationskanal erhöht es die Teilhabe, indem Nutzer von passiven Zuschauern zu aktiven Teilnehmer werden. Auf den digitalen Plattformen ist grundsätzlich jeder gleichberechtigt und wird nach seinem Können und Kreativität bewertet. Dadurch befördert es die Kollaboration, wo vernetzt kollektive Ideen, Produkte und Initiativen erzeugt (van Dijk 2017) und Bürger zu Engagement mobilisiert werden. In dem agilen Bereich ändern sich Trends und Netzwerke beständig. Wissenschaftliche Studien verfügen nur über eine mittlere Halbwertzeit, da morgen schon Out sein kann, was heute In ist. Gleichzeitig erweist sich der Wahlkampf als ein Innovationsfenster für die digitale politische Kommunikation. Daher sind Trendstudien wichtig, um die Veränderungen über die Zeit zu begutachten.
Vorliegende Trendstudie beschäftigt sich mit dem digitalen Campaigning im Bundestagswahlkampf 2017 und analysiert die parteilichen Aktivitäten auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und per E-Mail in der engeren Wahlkampfphase vom 1.August 2017 bis zum Wahltag am 24.September 2017. Die Entwicklung der Parteien wird auf den wesentlichen Plattformen betrachtet und anhand der vier digitalen Kampagnenfunktionen Information, Vernetzung, Teilhabe und Mobilisierung systematisch analysiert. Dadurch werden Prioritätensetzung der Parteien offengelegt. Die Erfassung der Daten erfolgt mithilfe einer API (Schnittstelle) zu den wesentlichen Plattformen. Schließlich findet die empirische Analyse ihre Ergänzung in Experteninterviews. Damit will die Studie einen Brückenschlag leisten zwischen dem vergleichenden Blick auf das digitale Campaigning 2017 und möglichen Entwicklungspotentialen für die Digital Public Affairs Arbeit der nächsten Legislatur.
1. Digital Campaigning und Wahlkampf
Wahlen sind das Kernelement einer funktionierenden Demokratie. In Wahlkämpfen komprimieren Parteien und Kandidaten ihr Politikangebot an den Wähler, in dem sie eigene Stärken, inhaltliche Initiative und personelle Alternativen überbetonen. In Zeiten eines volatilen, kurzfristigen und teils unberechenbaren Wählerverhaltens, indem langfristige parteiliche Orientierungen und Engagement absinken, gewinnt die kampagnenmäßige Ansprache zentrale Bedeutung (Foot und Schneider 2006, Neu 2010). Wer in der Wahlarena bestehen will, muss den Konkurrenzkampf in der Kampagne suchen.
Digitales Campaigning erweitert den Spielraum politischer Kommunikation. In weniger als einem Jahrzehnt transformierten neue Technologien die Art und Weise wie Kampagnen geführt, von Journalisten darüber berichtet und von Wählern erlebt werden. Wähler nutzen das Internet als eine primäre Informationsquelle und beteiligen sich aktiv an Kampagnen über digitale Plattformen. Digitale Instrumente veränderten die Organisation und die Ansprachestrategien von Parteien und Kandidaten (Bimber und Davis 2003, Kreiss 2016). Sie kommunizieren digital, um die Wähler zu informieren, zu kontaktieren und zu mobilisieren: Auf Webseiten informieren sich die Bürger über die Inhalte und die Kandidaten, soziale Plattformen binden mit täglichen Botschaften, regelmäßige E-Mail-Nachrichten richten sich an die Unterstützer, Wähler beziehen ihre Informationen von kurzen 140 Zeichen Reaktionen über ausgeprägtes digitales Storytelling bis zu Livestreams über Kampagnenevents. Es ändert sich die Erreichbarkeit der Bürger und der Kampagnen. Zwar wählt man noch am Ort, an dem man wohnt, aber die Kommunikation erfolgt geographisch grenzenlos. Kampagnen versuchen, die Bürger in ihren jeweiligen sozialen Kontexten zu erreichen. Push und Pull Strategien wechseln sich bei den Parteien ab, je nach Finanzstärke, institutionellem Kontext und Interessenlagen der Wähler (Nielsen und Vaccari 2013).
Читать дальше