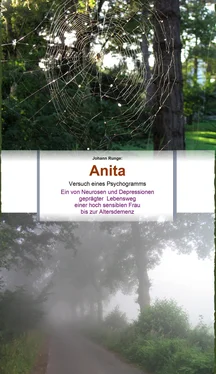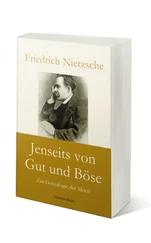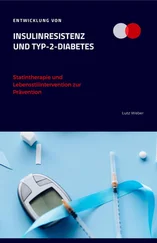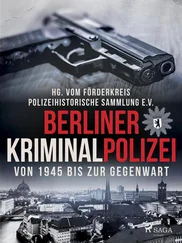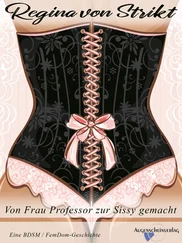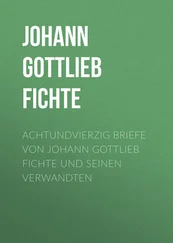Gleich danach spült sie in viel kaltem Wasser, wringt zwischendurch wieder jedes Teil aus, spült erneut und wringt wieder gut aus, bis das Spülwasser klar bleibt. Sie legt alle Wäschestücke in einen aus Weidenzweigen geflochtenen Korb, trägt ihn die kleine Kellertreppe zur Hofseite hinauf, stellt den Korb ab, spannt sogleich die Leine straff von Pfahl zu Pfahl. Berta bückt sich zum vollen Waschkorb hinunter, sie greift zuerst nach den dickeren Handtüchern, schlägt sie tüchtig aus und klammert sie gut an der Leine fest. Danach sind die großen Betttücher und die Taschentücher an der Reihe. Dann folgt die Unterwäsche. Zuletzt hängt sie die vielen Windeln und Wickeltücher, die Babyhemdchen und Jäckchen und Spucktücher auf. Es ist heiß und ein wenig schwül geworden. Gewiss kann sie schon bald die ersten trockenen Tücher abnehmen. Den leeren Korb lässt sie auf dem Hof stehen. Berta ist hungrig. Sie steigt nicht mehr ganz so schwungvoll die vielen Treppenstufen zum vierten Stock hinauf. Sie schließt die Wohnungstür auf, schnuppert gleich den herrlichen, ihr bekannten Duft des Apfelkuchens, den ihre Mutter so vorzüglich zu backen versteht. Schnell holt sie noch ein frisches Tischtuch aus dem Schrank und legt es über den rohen Holztisch. Köstlich schmeckt der frische Kuchen, und sie unterhalten sich angeregt. Dabei merken die beiden Frauen gar nicht, dass es draußen sehr schnell immer dunkler wird. Der erste Donner rollt, da erst werden die beiden jäh aus ihrer Gemütlichkeit herausgerissen. Beide laufen, so schnell sie können, die Treppen hinunter bis in den Hof, reißen die schon trockenen Wäschestücke zuerst von der Leine und werfen sie in den Korb. Das in einem Tempo, dass sie beide außer Atem kommen. Als der plötzliche Wind den Staub des Hofes aufwirbelt und die ersten dicken Regentropfen herunterklatschen, laufen sie beide mit dem vollen Waschkorb in das Haus. Die wieder nass gewordene restliche Wäsche holt Berta dann in einer Wanne herein.
Heute wird das Wetter wohl nicht mehr besser. So muss sie die nasse Wäsche bis auf den Trockenboden schleppen, um sie dort zum Nachtrocknen aufzuhängen. Dann geht‘s wieder eine Treppe abwärts bis in die Wohnung. Ihre Mutter legt schon die Handtücher schön glatt. Zusammen recken sie dann die großen Bett- und Tischtücher und legen sie in den Korb. Erforderlichenfalls sprengen sie noch etwas Wasser auf die zu trocken gewordenen Teile; denn für morgen hat Berta sich schon zur Rolle eingetragen, in der die großen Teile geglättet werden. Die beiden Frauen verbringen noch einen sehr gemütlichen und erholsamen Abend bei Radiomusik. Berta umstickt mit rosa Garn die Wickeltücher für ihr Töchterlein, während die Großmutter emsig an einem Überhandtuch in blauer Kreuzchenstickerei arbeitet.
Am nächsten Tag tragen sie gemeinsam den vollen Korb zur Rolle. Sie rollen jedes Teil einzeln durch. Gegen Mittag tragen sie den Korb mit der glatten Wäsche nach Hause. Gleich räumen sie die frisch gerollte Wäsche in die Schränke, jedes Teil an seinen Platz. Die Bügelwäsche hebt Berta sich für den nächsten Tag auf. Am Nachmittag bringt sie dann noch ihre Mutter zum Bahnhof. Auf dem Wege dorthin sagt ihre Mutter: „Berta, du bist doch eine sehr tüchtige Frau, wie glänzend du mal wieder alles geschafft hast.“ – „Ja, Mutter, ich muss doch meinem Namen Ehre machen; denn Du weißt ja, dass Berta aus dem Althochdeutschen stammt und ‚glänzend’ bedeutet. Sie bedankt sich ganz herzlich bei ihrer Mutter und winkt noch lange mit ihrem ausgebreiteten Taschentuch hinterher, als der Zug sich, in Dampfwolken und Qualm gehüllt, in Fahrt setzt.

Ich erinnere mich noch so genau daran, als wenn ich diese Ereignisse erst vor ein paar Tagen erlebt hätte: 1944 war es im Dezember bitterkalt, und es lag auch Schnee in meiner Heimatstadt Köslin in Hinterpommern. Von dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg war ich als kleines sechseinhalb Jahre altes fröhliches Mädchen, das noch nicht wusste, was ein Krieg in seinem vernichtenden Ausmaß bedeutet, bisher vor allem dadurch beeinträchtigt, dass mein Vater nicht mehr bei uns war. Mit der Hilfe meines großen Bruders schrieb ich ihm kleine „Liebeszettel“, die meine schreibfreudige Mutter mit in ihre vielen Briefe legte. Ich hüpfte fröhlich durch die Wohnung, obwohl es immer öfter auch Fliegeralarm gab. Im Herbst 1944 war ich eingeschult worden.
Immer wieder wurde unser Schulunterricht durch den Fliegeralarm gestört und musste für diesen Tag beendet werden. Weil mein Zuhause nicht weit von der Schule entfernt war, lief ich angsterfüllt schnellstens zum Luftschutzkeller, der unter unserem Mietshaus lag. Auch unser Nachtschlaf wurde manchmal durch solchen bedrohlichen Fliegeralarm zerschnitten. Das unverkennbare Geheul der Sirenen werde ich niemals vergessen. Im Luftschutzkeller war es schrecklich kalt. Da saß die gesamte Hausgemeinschaft auf harten Holzstühlen in ihre Wintermäntel gehüllt dicht beieinander, bis endlich die Sirene die ersehnte „Melodie“ der Entwarnung spielte. Erst dann durften wir den eiskalten Keller verlassen. Trunken vor Müdigkeit taumelten wir in unsere inzwischen ausgekühlten Federbetten.
Meine emsige Mutter backte wie jedes Jahr braune Pfefferkuchen für das schönste Fest im Jahr. Und ich durfte mit dem Pinsel Zuckerguss auf die runden Kuchen streichen. Dieser verführerische Duft von süßem Backwerk erfüllte unsere schöne Wohnung. Oftmals saß die Mutter auch an der Nähmaschine, und sie verriet mir nicht, was sie aus den dunkelblauen Stoffresten einer aufgetragenen Trainingshose nähte. So entstanden die Überraschungen für uns Kinder. Sie wollte uns trotz des tobenden Krieges ein möglichst schönes Weihnachtsfest bereiten.
Am Heiligabend stand wie jedes Jahr ein frischer Tannenbaum im Wohnzimmer auf einem kleinen Tisch. Dieser grüne Baum verströmte einen wunderbaren Duft in unserem schönsten und größten Zimmer. Wie eine silberne Krone thronte die glitzernde Spitze auf der höchsten Erhebung des Christbaumes. Bunte Kugeln und Lametta schmückten den Baum aus dem nahen Wald. Ich weiß aber auch, dass ein kleiner silberner Schneemann und ein Glöckchen die schöne Tanne zierten. Das niedliche Glöckchen, das vorne in der Nähe der Türe hing, hatte mich immer wieder dazu verführt, ihm einen lieblichen Klang zu entlocken.
In unserer Familie wurden an solchen hohen Feiertagen offenbar einige Rituale eingehalten. Der Gabentisch wurde stets mit einer großen weißen Tischdecke verhüllt. So waren die Geschenke bis zur Bescherung für unsere Augen unsichtbar. Weil meine Mutter eine Ausbildung in Gesang genossen hatte, war es für uns alle normal, dass wir sehr viele Weihnachtslieder im Laufe der Jahre auswendig singen konnten. Und die wurden auch schön laut gesungen. Wir sangen: „Alle Jahre wieder“, „Der Christbaum ist der schönste Baum“, „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ ‚ „Oh, du fröhliche, o, du selige“, aber auch das Lied von Hans Baumann „Hohe Nacht der klaren Sterne“, welches von der nationalsozialistischen Weltanschauung eingefärbt war. Die Nazis wollten das „jüdische“ Jesuskind totschweigen. Die Mütter jedoch brauchten sie noch, und die wurden sehr in diesem Lied geehrt: „Mütter, euch sind alle Feuer, alle Sterne aufgestellt, Mütter tief in euren Herzen schlägt das Herz der weiten Welt.“ So lautet eine Strophe des Liedes. Frauen, die vier Kinder hatten, wurden mit dem Mutterkreuz ausgezeichnet. Natürlich sollten diese möglichst Söhne gebären, die kaum zum Manne reifen durften, um schon als nicht ausgebildete Soldaten an den Fronten verheizt zu werden. Aber davon verstand das kleine Mädchen noch nichts. Wenn ich mir heute jedoch als Mutter von drei erwachsenen Kindern und zwei Enkelkindern Dokumentarfilme aus Kriegszeiten anschaue, bricht es mir fast das Herz, wenn ich die Knaben sehe, denen man damals noch zum Schluss des schrecklichen Zweiten Weltkriegs einen Stahlhelm über dem weichen Kindergesicht auf den Kopf setzte, die man in Uniformen steckte und ihnen eine Waffe in die zarten Hände drückte.
Читать дальше