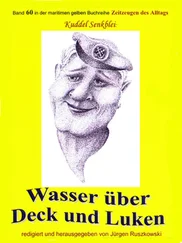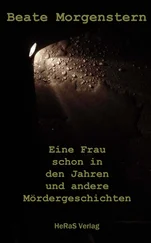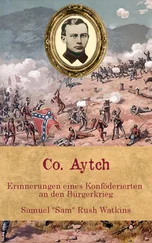Als Konfirmand zwischen meinen Eltern
Am 11. April 1954 wurde ich konfirmiert. Meine Mutter hatte mir einen graublauen Anzug schneidern lassen. Der Stoff bestand wohl aus Holzfasern und war fürchterlich kratzig. Ich konnte die Hose nur mit langen Unterhosen tragen, weil ich sonst vor Kratzen verrückt geworden wäre. Im Westen in Neuß bin ich mit dem Anzug noch zur Tanzstunde gegangen, auch mit langen Unterhosen drunter.
Fünfzig Jahre später habe ich die Sylvestri-Kirche zur Goldenen Konfirmation wieder besucht. Leider war mein Jahrgang schon ein Jahr vorher dran gewesen, aber sie konnten mir die Einladung wegen fehlender Adresse nicht schicken. Es waren keine Bekannten mehr bei dem Treffen. Trotzdem war es ein nettes Erlebnis. Ich wurde von einer Frau angesprochen, die damals von meiner Schwester unterrichtet worden war, und die nun an derselben Schule selbst Lehrerin war.
Kurz nach der Konfirmation ging mein Vater über die Grenze in den Westen. Ich beendete am 4. Juli 1954 die Schule und folgte ihm wenig später nach. Damit war ein wichtiges Kapitel meines Lebens abgeschlossen. Rückblickend kann ich sagen, dass es für mich eine schöne, prägende Zeit war, trotz der ärmlichen Umstände, in denen wir lebten. Ich empfand es nicht so. Wernigerode war meine Heimat geworden.

Hamburg, Neuß, Wevelinghoven
Mein Vater hatte die DDR aus wirtschaftlichen, aber auch aus sicherheitsmäßigen Gründen gerade noch rechtzeitig verlassen. Bei der Verschärfung der Überwachung und Bespitzelung der Bürger in den folgenden Jahren vor und nach dem Mauerbau wäre er wegen seiner nationalistischen Gesinnung bestimmt in Schwierigkeiten geraten. Meine Mutter und meine Schwester blieben noch so lange in Wernigerode, bis sich die ganze Lage geklärt hatte. Ich hätte die Oberschule in Wernigerode besuchen dürfen, wollte meine Schulausbildung aber lieber im Westen fortsetzen.
An einem Tag im Juli 1954 setzte ich mich also auf mein Fahrrad und machte mich auf den Weg in den Westen. Als Gepäck hatte ich einen alten Rucksack mit ein paar Sachen und Proviant auf den Gepäckträger geschnallt. Mein erspartes Geld, vielleicht 50 Ostmark, hatte ich an einem Faden hängend im Fahrradrahmen unter dem Sattel versteckt. Der Umtauschsatz im Westen war 1:4. Die Grenze passierte ich unbehelligt an der Grenzübergangsstelle Helmstedt. Mein Ziel war an dem Tag das kleine Dörfchen Örrel bei Hankensbüttel in der Lüneburger Heide, in dem mein Onkel Ernst, ein Bruder meiner Mutter, nach seiner Flucht aus Ilsenburg eine Anstellung als Lehrer an einer winzigen Einklassenschule gefunden hatte. Ich hatte Mühe, das kleine Dorf in der Heide zu finden und war heilfroh, als ich spätabends kaputt und müde ankam.
Ich wurde von Onkel und seiner Frau liebevoll versorgt. Nach etwa einer Woche setzte ich meine Reise nach Hamburg fort. Es war ein stürmischer und regnerischer Tag. Deshalb fuhr ich nur bis zum Bahnhof Uelzen und löste mir dort für die fünf Westmark, die ich als Notgroschen vom Onkel bekommen hatte, eine Fahrkarte nach Hamburg.
Die große Hamburger Bahnhofshalle imponierte mir bei meiner Ankunft gewaltig. Das Lager, in dem mein Vater lebte, lag im Stadtteil Wandsbek, und es war noch ein weiter Weg dorthin durch die noch sehr zerstörte Stadt.
Das Auffanglager für die DDR-Flüchtlinge befand sich in der Lettow-Vorbeck-Kaserne. Ich wurde als achter Bewohner im selben Zimmer untergebracht, in dem mein Vater zusammen mit anderen Männern unter menschenunwürdigen Umständen hauste. Eine Privatsphäre oder irgendeine Rückzugsmöglichkeit bestand nicht. Man bekam von allen Mitbewohnern alles mit. Und das war ein zusammengewürfelter Haufen Strandgut aus Krieg und Vertreibung! Gemeinschaftswaschräume und Küchen lagen auf dem Flur. Jeder musste für seine Verpflegung selbst sorgen. Den Familien ging es auch nicht besser. Zwei oder drei Familien hausten in einem Zimmer, nur durch aufgehängte Decken voneinander getrennt.
Mein Vater hatte keine Arbeit und musste mit dem wenigen Überbrückungsgeld sehr haushalten. Oft gab es Heringe, die damals noch sehr billig waren – Hering gebraten, Hering gekocht, Hering in Gelee und Hering in Sauer. Seitdem esse ich Hering immer noch gerne. Seltsamerweise konnte ich abends in meinem oberen Bett trotz Lärm, Zigarettenrauch und Bierdunst sofort einschlafen. Das habe ich später nie mehr geschafft.
Ich brauchte nicht zur Schule gehen und lungerte tagsüber auf dem Kasernengelände herum oder fuhr mit meinem Vater mit der Straßenbahn nach Hamburg. Erinnern kann ich mich an die Gartenbauausstellung in den Wallanlagen, an das Bismarck- Denkmal und an die Elbe.
Damit die Jugendlichen im Lager nicht total verlotterten, kümmerte sich die evangelische Kirche vorbildlich um sie. Ein Diakon Dietrich führte mit den Kindern 14tägige Ausflugsfahrten durch. Ich konnte an drei Freizeiten in die Görde, in den Harz nach Lautental und an die Ostsee nach Heiligenhafen teilnehmen.
Schülerheim in Neuß
Mein Vater hatte über die Kirche erreicht, dass ich zukünftig weiter zur Oberschule gehen sollte. Ende Oktober 1954 wurde ich in ein evangelisches Schülerheim in Neuß am Rhein geschickt. Das Heim befand sich in einem großen umgebauten Einfamilienhaus und beherbergte etwa 25 Jungen aus der sowjetischen Besatzungszone, die am Neußer Gymnasium auf das Abitur vorbereitet werden sollten. Wir waren zu fünft in einem Zimmer untergebracht. Es war beengt, aber viel angenehmer als im Lager. Mein Zimmer war an der einen Längswand mit Spanholzplatten in vier Boxen ohne Türen aufgeteilt, in der je ein Bett und ein schmaler Schrank standen. An der anderen Längswand stand noch ein freistehendes Bett in der Ecke am Fenster, das von allen Seiten eingesehen werden konnte. Das war in den ersten Wochen meine Schlafstatt. Später konnte ich in eine Box umziehen. Schularbeiten wurden gemeinsam an einem Tisch gemacht. Es war schon sehr beengt, und man fiel sich manchmal gegenseitig auf den Wecker.
Da wir in der DDR außer Russisch keine anderen Fremdsprachen gelernt hatten, mussten wir Heimkinder erst einmal vom 3.11.1954 bis zum 22.09.1956 in einem SBZ-Sonderkurs auf den Wissenstand unserer westlichen Altersgenossen gebracht werden. In der Zeit hatten wir mit den normalen Schülern wenig Kontakt. In knapp zwei Jahren holten wir den sechsjährigen Vorsprung unserer Altersgenossen in Latein und Englisch auf. Dabei blieben etwa 20 Mitschüler auf der Strecke, die das große Lernpensum nicht schafften.
Die Schule ließ uns nicht viel Zeit für Vergnügungen. Manchmal durften wir abends bis 22:00 Uhr in ein nahe gelegenes Lehrlingsheim gehen, um dort eine Fernsehsendung anzusehen. Im Hause hatten wir eine Tischtennisplatte.
1956 absolvierte ich mit noch einigen Mitbewohnern einen Tanzkursus. Das gehörte mit zur Erziehung. In der ersten Stunde saßen sich Jungen und Mädchen gegenüber. Auf ein Signal des Tanzlehrers sollten wir Jungen uns in Bewegung setzen und uns unsere Tanzpartnerin aussuchen. Leider schnappte mir ein anderer das Mädchen weg, das ich mir ausgeguckt hatte. In meiner Not nahm ich die nächstbeste andere. Es war eine Bauerntochter aus Wevelinghoven, die in Neuß Goldschmiedin lernte. Sie war ganz nett, aber es entwickelte sich nichts weiter. Tanzen lernte ich auch nicht gut. Bei unserem Tanzlehrer hatten schon die Mütter unserer Tanzdamen dieselben Schritte gelernt wie wir.
Da wir in einer streng katholischen Gegend lebten, mussten wir als Evangelische auch Flagge zeigen. Das bedeutete, dass wir jeden Sonntag zur Kirche gehen mussten. Später, wenn wir wussten, dass unser Heimleiter nicht in der Kirche war, umgingen wir diese Pflicht. Wir zogen uns unsere Badehosen an, banden uns ein Handtuch unters Hemd und gingen statt in die Kirche in das Hallenbad.
Читать дальше