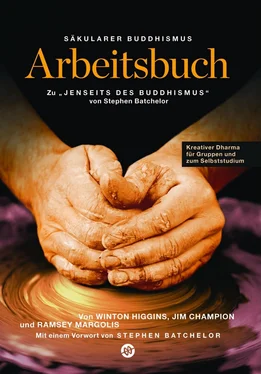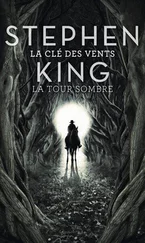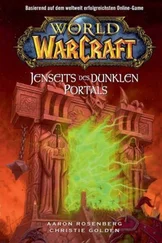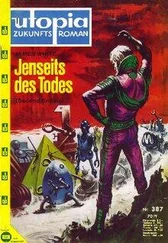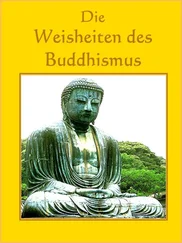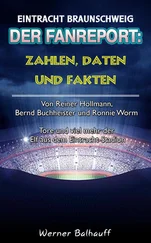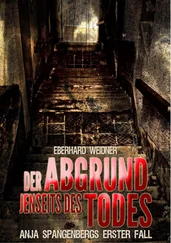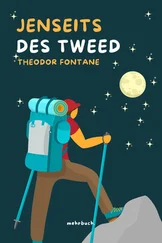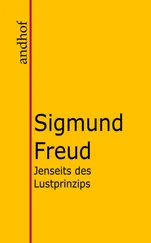Ein wesentlicher Bestandteil der säkular-buddhistischen Agenda muss es sein, zu Buddhas Vorbild einer Sangha zurückzukehren, welches auch den Anforderungen heutiger fortschrittlicher Grundsätze dessen entspricht, wie wir als Dharma-Praktizierende miteinander Umgang pflegen sollten.
Fragen zur Vertiefung
1 Werfen Sie einen Blick auf die Liste der verschiedenen widersprüchlichen Überzeugungen und Meinungen, die von den Priestern, Wanderern und Asketen, die zu Buddhas Zeit in der Nähe des Jetahains lebten, gelehrt werden, wie es auf S. 11-12 von Jenseits des Buddhismus dargelegt ist: Die Welt ist ewig / nicht ewig; die Welt ist endlich / nicht endlich; Körper und Geist sind identisch / verschieden; ein Erleuchteter existiert nach dem Tod / existiert nicht nach dem Tod; ein Erleuchteter existiert und existiert nicht nach dem Tod; ein Erleuchteter existiert weder nach dem Tod noch existiert er nicht nach dem Tod. Was würden Sie sagen, was davon, wenn überhaupt, halten Sie für wahr, und wie begründen Sie Ihre Überzeugung (falls es eine gibt)? Gibt es eine, die Sie früher für wahr gehalten haben, zu der Sie aber jetzt Ihre Meinung geändert haben? Falls ja, was hat Sie dazu veranlasst, Ihre Meinung zu ändern?
2 Am Ende des 2. Abschnitts schreibt Stephen, dass er nicht leugnen kann, dass seine Art, den Dharma neu zu formulieren, von der Kultur, in der er aufgewachsen ist, stark beeinflusst ist. Inwieweit entsprechen seine Lebensumstände Ihren eigenen? Wie beeinflussen möglicherweise Ähnlichkeiten und / oder Unterschiede Ihre eigene Einschätzung dessen, wie Stephen den Dharma neu formuliert?
3 In der Mitte des 3. Abschnitts beschreibt Stephen Leerheit als die Würde einer Person offenbarend, die erkannt hat, was es wirklich bedeutet, ein Mensch zu sein. Woran würden Sie jemanden erkennen, der erkannt hat, was es wirklich bedeutet, ein Mensch zu sein, jemanden, der „in der Leerheit weilt“?
4 Inwieweit stimmen Sie der Art und Weise zu, wie Stephen die Begriffe „religiös“ und „säkular“ verwendet?. Auf welche Probleme, wenn überhaupt, sind Sie in Ihrem Leben in Bezug auf diese beiden Begriffe gestoßen?
5 Was ist das?
Mahānāma: der Konvertit
Kapitel 2 von Stephens Buch, „Mahānāma: der Konvertit“, führt einige zentrale Themen zusammen, die mit der vorrangingen Hinwendung zum Dharma in Zusammenhang stehen, und was Praxis und Gemeinschaft in dieser Tradition beinhalten. Diese Fragestellungen ergeben sich aus der Geschichte von Mahānāma, dem Cousin Buddhas und auserkorenen Oberhaupt der Sakiyer, ihrer gemeinsamen politischen Gemeinschaft.
Nach hergebrachter buddhistischer Sichtweise ist Mahānāma eine widersprüchliche Persönlichkeit, was durchaus erklären könnte, warum traditionelle Kommentarliteratur ihn ignoriert – trotz mehrerer bedeutsamer Hinweise auf ihn im Pali-Kanon. Er ist kein Entsagender. Vielmehr ist er beschäftigt mit den weltlichen Angelegenheiten seiner Gemeinschaft und den unkontrollierbaren fleischlichen Begierden, gleichzeitig geplagt von Existenz- und Todesangst. Und dennoch genießt er die Anerkennung des Buddhas als ein „in den Strom Eingetretener“ – einer Person, die den Dharma ganz und gar verkörpert.
Demgemäß hat er „klares Vertrauen“ (kein blindes Vertrauen, wie Sie feststellen werden) in Buddha, Dharma und Sangha und er „besitzt die Tugenden, die edlen Menschen teuer sind“, und all das verleiht ihm geistige Würde. Auf diese Weise erfüllt er die vier Kriterien des Buddha für den Stromeintritt (Sotāpatti).
Und nicht nur das. Die Verwirklichung dieser vier Attribute bedeutet, dass er „sich zu Nirvana neigt, gleitet und sich lehnt“, d.h. in Richtung eines Geisteszustands, der Reaktivität überwindet. Diese Eigenschaft beschert ihm eine weitere Anerkennung durch den Buddha: Er ist „ein Seher des Todlosen“, wobei der Tod selbst eine Metapher für ein Leben im Strudel unreflektierter und gewohnheitsmäßiger Reaktivität ist.
Nach traditioneller Sichtweise könnte ein „Weltkind“ wie er niemals den Eintritt in den Strom erreichen. Und doch, hier ist er, der von Buddha selbst bescheinigte Stromeintritt. Auf diese Weise wird er zu einer Person von besonderem Interesse, wenn wir uns mit einigen grundlegenden Fragestellungen beschäftigen, worum es bei der Dharma-Praxis wirklich geht.
Konkrete Menschenleben in konkreten Lebenslagen
Eine der Unzulänglichkeiten traditioneller Darstellungen von Buddhas Leben ist, dass sie dessen spezifischen Kontext zugunsten einer Mythologisierung ausblenden, etwa, indem er als Prinz von königlichem Geblüt in einer gefestigten Gesellschaft dargestellt wird. Aber im hier beschriebenen Kapitel erhalten wir einen Eindruck über die Turbulenzen, in die die Sakiyer (einschließlich des Buddha und seines Cousins) während der Agrarrevolution in der Gangesebene verwickelt waren.
Mahānāma würde sich die Gelassenheit des Mendikantenlebens als Mönch liebend gern zu eigen machen, aber er fühlt sich als Staatsbürger verpflichtet, seine Landsleute durch sehr unruhige Zeiten zu führen, wobei er durchaus Gefahr läuft, im Verlauf dessen ermordet zu werden. Er beklagt die leibliche Gefahr, in der ihn seine Situation gefangen hält, in Worten, die uns an Shakespeares berühmte Zeile in Heinrich IV., Teil 2 erinnern könnten: „Unbehaglich liegt das Haupt, das eine Krone trägt“. Auch dann, wenn die „Krone“ in diesem Fall eine republikanische ist. Für einen Menschen in seiner Lage, wäre das Leben eines Wandermendikanten mit einer Almosenschale und ohne weltliche Sorgen bei weitem angenehmer. Aber am Ende stirbt er in Erfüllung seiner Aufgaben als ein Held, der versucht, einen völkermordartigen Angriff der Streitkräfte von Kosala auf sein Volk abzuwenden.
Die moderne Wissenschaft hat einen weiteren interessanten Punkt zutage gefördert: Die Sakiyer waren animistische Sonnenanbeter. Sie standen nicht unter der Knechtschaft des Brahmanismus mit seinem Glaubenssystem und starren sozialen Spaltungen, auch nicht zwischen Frauen und Männern. Brahmanische Gemeinschaften und Wanderer waren ihnen bekannt und vorherrschend in den benachbarten Gebieten, aber das ist auch schon alles.
Der Buddha-Dharma grenzte sich von Zeit zu Zeit gegen den Brahmanismus ab, aber da er aus Sakiya kam, stellte das keine Rebellion gegen ihn dar. Diese Tatsache erklärt die Sonnen-Symbolik im Pali-Kanon: Wie die Sonne, so erleuchtet und belebt auch der Dharma ein Leben, das sich sonst in Dunkelheit und Erstarrung entfalten würde. Dies ist etwas, das zum Kern dessen führt, was Wandel und Stromeintritt bedeuten.
Konversion und Stromeintritt
Im traditionellen (insbesondere Theravāda) Buddhismus bezieht sich Stromeintritt auf eine fortgeschrittene meditative Erfahrung, die einem (fast ausnahmslos) klösterlichen Praktizierenden einen hierarchischen Status verleiht. Es ist ein Rang, den man erreicht: der niedrigste von vier Rängen in der „edlen Gemeinschaft“ (Ariyasangha), ein Rang, von dem man zum Einmal-Wiederkehrer, zum Nicht-Wiederkehrer und schließlich zum vollständig erwachten Arahant voranschreitet. Die Ariyasangha bezieht sich traditionell auf alle, die die erste ernsthafte meditative Erweckungserfahrung gemacht haben.
Diese Laufbahn ist ähnlich wie in der Armee, vom Brigadier zum Generalmajor, zum Generalleutnant, zum höchsten Rang - dem Feldmarschall. Basierend auf seinen Erfahrungen als Mönch schildert Jason Siff in seinem satirischen Roman, Seeking nibbana in Sri Lanka, die Obsession, mit der dort in klösterlichen Kreisen das Erreichen des Stromeintritts angestrebt wird.
Aber in der Lebenswelt des Buddha und der Art und Weise, wie er sie gebrauchte, hatten diese Begriffe völlig andere Bedeutungen. Die „Strom“-Metapher bezieht sich auf eine frei fließende, hindernisfreie Seinsweise in der Welt. Ein Strom fließt frei, weil er auf beiden Seiten von Ufern gestützt wird, die ihn leiten und zurückhalten. Die Ufer beziehen sich auf die Dharma-Praxis und insbesondere auf ihre ethischen Grundlagen. Wie „tritt man in den Strom ein“? Wie bei jedem natürlichen Fließgewässer tut man dies, indem man sich zwischen diesen Ufern verortet.
Читать дальше