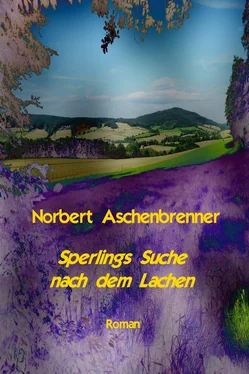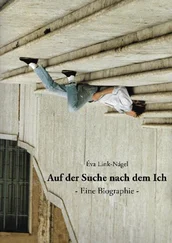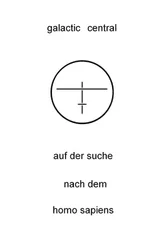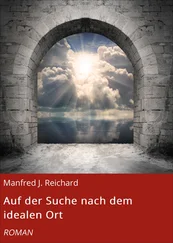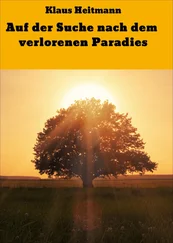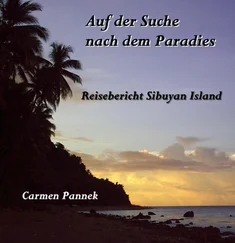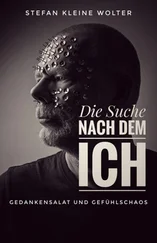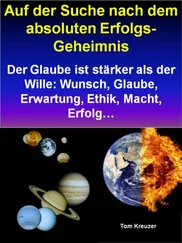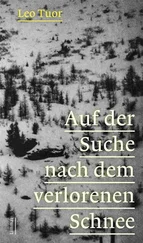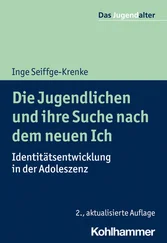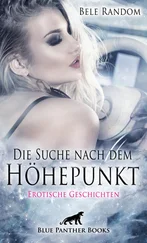Die angegilbten Fotos von Schulausflügen zeigen Knaben auf der Saalburg und vor dem Hermannsdenkmal, die schlacksig posierend Selbstbewusstsein, Aufmüpfigkeit - Erwachsensein? - zur Schau stellen.
Die Konfirmation: Gesichter, die sich nirgends einordnen lassen wollen, umrahmen einen dürren Burschen, dessen Ähnlichkeit mit den Aufnahmen anlässlich meiner Einschulung, die mich mit Zuckertüte und Schildmütze zeigen, nicht zu leugnen ist.
Ein Zeltlager an der Ostsee: Schnappschüsse beim Kartoffelschälen und bei der Frühgymnastik.
Die Bilder sind zwar ausgebleicht, beweisen aber unbestechlich meine Identität. Da hilft keine Ausflucht ins Lächerliche, ins Nicht-wahrhaben-wollen: dieser unscheinbare, überall nach Halt suchende, verkniffen in die Kamera blinzelnde junge Mensch bin ich! Aber um mich geht es nicht, meine eigenen Geschichten - besser gesagt, diejenigen, von denen meine Erinnerung ein verschwommenes Signal des Erkennens sendet - bezeugen außer verlorengegangenen Träumen keine bemerkenswerte Heldenhaftigkeit, was Natty Bumppo mitleidig nickend bestätigt. Nein, um mich geht es nicht. Ich war immer nur ein Mitläufer, ein Zuschauer und jeder weitere Satz über meine Person wäre Verschwendung. Aber ich bemühe mich, der Chronist einer Geschichte zu werden, von der meine eigene vor langer Zeit maßgeblich beeinflusst wurde.
Noch kann ich nichts Geheimnisvolles in Arnos Aufzeichnungen entdecken. Zu sehr geht alles durcheinander. Als hätte er in allen zwölf Heften gleichzeitig geschrieben. Vieles, was mir bereits aus unseren Gesprächen bekannt ist, findet sich darin wieder.
Ich glucke über dem Karton als gelte es, die britischen Kronjuwelen zu bewachen, halte mein Arbeitszimmer verschlossen und trage den Schlüssel bei mir, was Lauras Misstrauen geweckt hat. Sie findet es ungehörig, dass ich ihr die Einsicht in Arnos Papiere verweigere und außerdem würde sie gerne mal wieder mit dem Staubsauger gegen die imaginären Schmutzberge vorgehen. Wahrscheinlich hat sie Recht, denn, wie gesagt, bei meiner bisherigen Durchsicht bin ich auf nichts gestoßen, was einen Bruch meines Ehefriedens oder den Vermerk »Streng vertraulich« rechtfertigen würde.
Zugegeben, Arnos Besuche fehlen mir. Unsere Gespräche über das Bilderbuch, aus denen sich unbeabsichtigt ein wechselseitiger Austausch von abgelebter Vergangenheit entwickelt hatte, der mich insoweit verwirrte, als er den Status quo meiner Gegenwart zumindest fragwürdig erscheinen ließ. Die Erkenntnis, dass ich vermutlich noch immer der gleiche Streber bin, der ich mit dreizehn war, ist schwer verdaulich. Verglichen mit Arno scheine ich nur biologisch gereift zu sein. Ein Heimchen, das sich bis zum Ausfallen des letzten Haares an irgendeinen Rockzipfel klammert, um sich nur ja geborgen fühlen zu können. Bin ich am Ende aus lauter Mutlosigkeit Lehrer geworden, Beamter auf Lebenszeit?
Wir waren zehn Jahre alt, als wir in dieselbe Klasse des Robert-Schumann-Gymnasiums aufgenommen wurden. Vom ersten Tag an schlüpfte Arno Sperling wie selbstverständlich in die Rolle des Chefs. Durch den selbstbewussten, oft flapsigen Ton, den er im Umgang mit Autoritäten wie Hausmeistern, Sekretariatsdamen und unantastbaren Gottheiten im Range von Oberstudienräten anschlug, gewann er rasch unser Vertrauen. Es soll unter den Mädchen unserer Klasse einige gegeben haben, die sich bereits in dieser Anfangszeit unsterblich in ihn verliebt haben.
Während er also geradewegs zum unangefochtenen Sprecher aufstieg, brauchte ich mehrere Monate, um mich in der neuen Umgebung einzuleben. Ich gehörte zu den Unauffälligen, die nie ihre Hausarbeiten vergaßen. Selbst während des Biologie- und Geographieunterrichts bei Hubertus Kratschmer, einem ebenso schrulligen wie strengen Kauz mit buschiger Einsteinmähne, war ich bis zum Ende der Stunden aufmerksam und hatte stets die richtigen Antworten parat.
Ich erinnere mich nicht, jemals von Kratschmer abgeurteilt worden zu sein. Für Arno und seine wackersten Mitstreiter aber gehörten dessen Strafexerzitien zum Ritual jeder Stunde. Je nach Schwere ihrer Entgleisung mussten sie fünf oder zehn Minuten mit gesenkten Häuptern in einer Ecke des Klassenzimmers stehen.
Arno Sperling kam aus Thalbach, einem damals neunhundert Seelen zählenden Ort, der neun Kilometer südöstlich von der Kreisstadt Schönfeld entfernt liegt. Er war einer der zahlreichen Pendler, die mit der inzwischen stillgelegten Schönfelder Kleinbahn zum Schulbesuch anreisten.
Im Gegensatz zu den meisten Gleichaltrigen aus den umliegenden Dörfern, die uns stolzen Städtern am Beginn ihrer Oberschulzeit mit Zurückhaltung und misstrauischer Vorsicht begegneten, zeigte Arno nicht das geringste Anzeichen von Minderwertigkeit oder Respekt.
»Nur weil wir vom Dorf kommen und nicht ganz so geschwollen daherreden wie ihr, sind wir noch lange nicht eure Trottel«, sagte er herausfordernd. »Falls ihr glaubt, dass wir in unserem Nest den Mond noch immer mit einer Stange weiterschieben, dann seid ihr schief gewickelt. Wir machen’s inzwischen mit Elektrizität.«
Arno war der unumstrittene Mittelpunkt der Klasse. Nur widerwillig akzeptierte er Typen wie mich. »Aufgepasst! Mamas Liebling kriecht unterm Rock hervor«, raunte er ins Klassenzimmer, wenn mich Kratschmer nach vorn zur Tafel rief.
In den Pausen berichtete er oft mit verschlagenem Stolz, welches »neue Ding« er gerade allein oder mit einigen Thalbacher Komplizen ausheckte. Dann scharte sich alles um ihn und hing gebannt an seinen Lippen. Der besondere Reiz der Geschichten lag darin, dass sie sich fast ausnahmslos mit seinem »Kampf gegen den Sheriff« befassten. Der »Sheriff«, das wussten wir inzwischen, war sein Vater, der als Hauptwachtmeister die Dorfpolizeistelle leitete und sich nach Feierabend zum Bürgermeister aufschwang; ehrenamtlich, wie es damals in den Dörfern noch üblich war.
Die Tatsache, dass Arno wegen der Nähe zu seinem Vater und dessen Beruf ständig mit dem Gesetz konfrontiert war und von diesem regelmäßig »etwas zwischen die Hörner bekam« (Originalton Sperling), qualifizierte ihn in unseren Augen erst recht. Mich dagegen hielten alle für ein Unschuldslamm. Manchmal spielte ich diese Rolle so überzeugend, dass ich selbst daran glaubte, obwohl ich mir alle Mühe gab, zum engsten Kreis vorzustoßen. Von Arno einen anerkennenden Blick zu ernten, bedeutete mir bald mehr, als ein »Sehr gut« in Mathematik.
Schuld an meinem Naturell war gewiss mein Vater. Rückblickend erscheint er mir wie ein Chamäleon. Seine größte Begabung bestand darin, sich widerspruchslos jedem herrschenden Zeitgeist anpassen zu können. Vermutlich ist er im Bewusstsein dieser Fähigkeit Finanzbeamter geworden.
»Es ist gleichgültig, wer die Macht ausübt und unter welchem politischen Deckmantel das geschieht - jeder Staat existiert von den Steuern seiner Untertanen«, predigte er mir, wann immer er glaubte, mir den richtigen Weg weisen zu müssen. Doch die gedankenlose Überzeugung, mit der er von Untertanen und der Unentbehrlichkeit seines Berufsstandes sprach, wird mir erst heute bewusst. »Und damit er diese Steuern auf Heller und Pfennig bekommt«, fuhr er fort, »braucht er Leute wie mich. Wir sind die eigentlichen Künstler im Lande, unverzichtbar. Eine Straßenwalze zu fahren ist dagegen ein Klacks. Denk darüber nach, mein Junge.«
Mit diesem abfälligen Nachsatz zerstörte er meinen Kindertraum von einem Leben als Dampfwalzenfahrer.
Sein Opportunismus verhalf ihm zwar zu keiner besonderen Karriere, was zeigt, dass er im Vergleich mit erfolgreicheren Vertretern dieser Gattung wohl doch nicht immer künstlerisch genug gewesen ist, aber immerhin gelang es ihm, sein kleinbürgerliches Dasein schadlos durch die tausendjährigen Irrungen und Wirrungen und danach durch die Hungerjahre bis ins fette Wirtschaftswunder zu lavieren.
Читать дальше