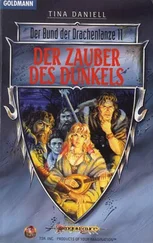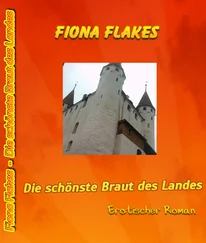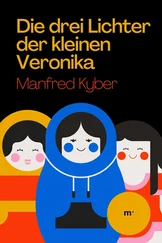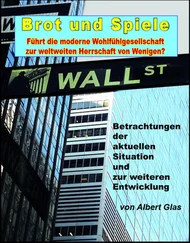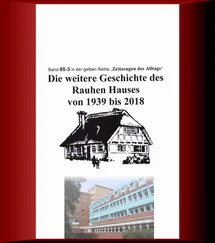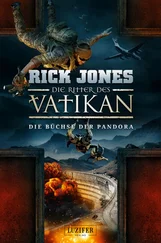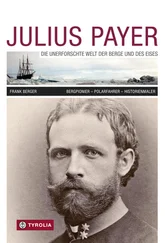Dem entspricht auch, dass die Bereitstellung von Integrationshilfen und auch von bibliothekarischen Inhalten von Ausgangskulturen der Migranten, außerhalb von NRW eine sehr wesentliche Aufgabe der öffentlichen Bibliotheken ist. Die Bereitstellung von Literatur und Medien in Bengali bindet die erste und zweite Migrantengeneration an die öffentlichen Bibliotheken Londons; das dadurch hergestellte Basisvertrauen ermöglicht der zweiten Migrantengeneration dann auch, sich wesentlich stärker mit der Kultur des Landes zu beschäftigen, als dies durch andere Angebote zu erreichen wäre.
Hier ist ein Trend erkennbar, der unstreitig auch auf die öffentlichen Bibliotheken in NRW ausstrahlt, aber nicht annähernd so konsequent umgesetzt wird, wie dies in anderen Ländern stattfindet: Einerseits der Focus auf die Bibliothek als Civic Centre – vor allem bei unseren britischen und skandinavischen Gesprächspartnern hervorgehoben – und andererseits die Rolle der Bibliothek als allgemeineres Kulturzentrum, das über die klassische wissensvermittelnde Rolle hinausgeht, aber eben keine besonders engen Verbindungen zu den klassischen Ausbildungsstätten unterhält.
Wir gehen daher prinzipiell davon aus, dass die jetzigen Aufgaben der öffentlichen Bibliotheken sich in zwei unterschiedliche Richtungen entwickeln werden: Einerseits werden Teile davon in die Realisierung des landesweit einheitlichen, lebenszyklisch unterschiedlich umfangreichen Angebots an fachlicher Information eingehen, das wir am Anfang dieses Abschnittes beschrieben haben. Andererseits ist die Aufgabenteilung bei der Bereitstellung von Informationszugängen im Bereich der sozialen Absicherung und der Integrationspolitik u.E. nach in NRW derzeit noch völlig außerhalb ernsthafter und weithin wahrgenommener politischer Diskussion, so dass wir in diesem Fall von jeder Projektion oder Empfehlung absehen.
2.4.2. NRW 2025: Ein integriertes Hochschulbibliothekssystem
Da dies aus unserer Sicht ein zentrales Erfordernis für die weitere Entwicklung eines an den Bedürfnissen der Hochschulen des Landes insgesamt ist, stellen wir die Eckpunkte unseres Verständnisses der Entwicklung zu einem integrierten, landesweiten Informationssystem hier nochmals zusammen.
1. Die Hochschulen des Landes sollten nicht als eine Ansammlung zufällig in NRW ansässiger Einrichtungen, sondern als ein vom Land bewusst finanziertes System zur wissenschaftlichen Ausbildung und Forschung verstanden werden.
2. Im Vordergrund der Planung des diese Hochschulen bedienenden Gesamtsystems sollte daher die Infrastruktur als Ganzes stehen, nicht die einzelne Hochschule. Dies setzt den Abbau aller Redundanzen zwischen den Leistungen einzelner Hochschulbibliotheken, gleichzeitig aber auch den Aufbau der technischen Fähigkeit zur Herbeiführung der Hochverfügbarkeit des Gesamtsystems voraus.
3. Deshalb ist mittelfristig vorzusehen, den bestehenden Verbundkatalog durch ein landeseinheitliches, dublettenbereinigtes Katalogsystem zu ersetzen.
4. Dies erlaubt gleichzeitig die Abschaffung aller Lokalsysteme und deren Ersatz durch Sichten auf den landeseinheitlichen Katalog. Wie bereits erwähnt, nicht als kurzfristige Maßnahme aber als Teil des grundsätzlich notwendigen Ersatzes der Verbundsoftware.
5. Wird ein bereist anderswo katalogisiertes Werk nochmals katalogisiert, wird ein Werk innerhalb von NRW mehr als einmal katalogisiert, wird das Geld des Steuerzahlers direkt vernichtet. Die lokale Katalogisierung ist daher einzustellen.
Kurzfristig empfehlen wir dabei die Untersuchung der Möglichkeiten, die jetzt in der Verbunddatenbank enthaltenen Titelsätze um Dubletten zu bereinigen und den möglichst raschen Beginn dieser Dublettenbereinigung, wobei die Überlegungen des folgenden Abschnitts 2.4.3. einzubeziehen sind.
Mittelfristig wird der Ersatz der Lokalsysteme durch die Sichten auf einen landeseinheitlichen Katalog nur durch eine Förderung des Lands möglich sein, die allerdings danach erhebliche Einsparungen erwarten lässt.
2.4.3. NRW 2025: Position innerhalb der Bibliothekslandschaft der Bundesrepublik
Eine Reform der Metadatenhaltung ist innerhalb der weltweiten Bibliothekssysteme dringend erforderlich. Dabei ist hier festzuhalten, dass die klassische Form der Metadatenstandards – bisher bekannt als Katalogisierungsregeln – unter der Prämisse entwickelt wurde, dass der Zugriff auf ein katalogisiertes Werk wesentlich zeit- und ressourcenintensiver ist, als der Zugriff auf ein Katalogisat. Dies trifft bei digitalen Bibliotheksinhalten nicht mehr zu. Es ist daher zu überprüfen, inwieweit die unter der mittlerweile obsoleten Prämisse entwickelten Katalogisierungsregeln wirklich noch relevant sind.
Als wichtigstes Kriterium ist dabei die „Umkehrung der Beweispflicht“ anzusehen. Bei der Umsetzung klassischer Katalogisierungsvorstellungen in Metadatenstandards ist nicht nachzuweisen, wie eine bisherige Unterscheidung in den neuen Metadatenstandard übernommen werden kann, sondern es ist nachzuweisen, ob sie unter den geänderten technischen Bedingungen überhaupt noch sinnvoll ist. 22
Wir thematisieren dies hier, weil wir bei Betrachtung aktueller internationaler Entwicklungen, etwa bei den Versuchen die datentechnisch sehr eleganten FRBR Empfehlungen in ein konkretes Format umzusetzen, glauben, erhebliche Verletzungen des oben angeführten Prinzips ausmachen zu können. Hier scheint eher der Versuch unternommen worden zu sein, an sich längst irrelevante Details nach wie vor abzubilden, weil es sie schon immer gab.
Unstreitig sprechen wir hier von Entwicklungen, die vom Lande NRW nicht direkt zu beeinflussen sind, da sie globale Entwicklungen betreffen. Realiter ist allerdings zu beobachten, dass auch so genannte internationale Standards letztendlich von einer sehr kleinen Anzahl von Einrichtungen festgeschrieben werden. Um die Interessen des Landes gebührend zu sichern, empfehlen wir hier zwei Maßnahmen:
1. Innerhalb des Landes sollte zum frühestmöglichen Zeitpunkt ein Benutzungsmonitoring eingerichtet werden, dass durch die unmittelbare Analyse der Benutzung von OPACs und ähnliche Nachweissysteme belegt, wieweit die erhobenen Erschließungskategorien tatsächlich benutzt werden.
2. Wir empfehlen dringend, sei es im Rahmen einer Umorganisation des HBZ, oder durch die Ergänzung der informationswissenschaftlichen Kompetenz an den Hochschulen des Landes, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass das Gewicht des Landes innerhalb des bibliothekarischen Gesamtsystems der Bundesrepublik deutlich aufgewertet wird, sodass das Land die realistische Chance bekommt, seine Interessen hier offensiv zu vertreten.
2.4.4. NRW 2025: eLearning als Selbstverständlichkeit
Die Beurteilung der zukünftigen Möglichkeiten von eLearning innerhalb der Lehre der Hochschulen und daraus folgend, der Notwendigkeit der Unterstützung von eLearning durch spezielle Einrichtungen der hier zu diskutierenden Infrastrukturen, wird dadurch etwas schwierig, als derzeit mindestens vier Konzepte von eLearning gebräuchlich sind.
1. Einerseits wird die prinzipielle Bereitstellung digitaler Ressourcen, die der Lehre dienen – seien es digitale Lehrbuchsammlungen, seien es Beamer, die den Overheadprojektor im Seminarraum ersetzen – als Unterstützung des eLearning verstanden.
2. Andererseits wird eLearning als Label für die Organisation der Kommunikation innerhalb der Lehre verstanden: Koordination des Mailaustausches zwischen Lehrenden und Studierenden, Bereitstellung von Seminarunterlagen, Seminarpapieren und entstehenden Arbeiten im Internet, Diskussionen über die Themen zwischen den Studierenden einer-, den Studierenden mit den Lehrenden andererseits, ergänzt durch die Möglichkeit gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten.
3. Die Verwendung von automatischen Systemen zur Unterstützung der Studierenden einerseits, der Lehrenden andererseits: Hier denken wir an Vokabeltrainer, Lückenergänzungssysteme in Texten und Ähnliches auf Seite der Studierenden, Systeme bei der automatischen Korrektur etwa von Multiple Choice Klausuren auf Seite der Lehrenden.
Читать дальше