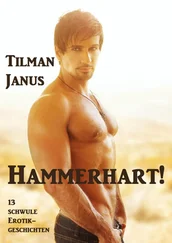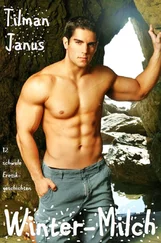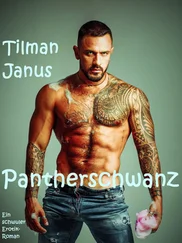Nach ihrem Tod wurde ich von der Familie van Heeren ins Gutshaus aufgenommen. Als Junge dachte ich, dass die van Heerens das getan hatten, weil sie sehr gute Menschen wären. Sie hätten mich auch in ein Waisenhaus stecken können. Dass die Dinge anders zusammenhingen, erfuhr ich erst viel später.
Ich wuchs zusammen mit den beiden Söhnen des Gutsherrn auf, musste also nicht im Gesindehaus wohnen. Denn eigentlich gehörte ich zum Gesinde, spätestens, nachdem ich mit sechzehn die Realschule im Nachbarort Hesel abgeschlossen hatte. Ich musste als Melker arbeiten und brachte es bei dieser Tätigkeit zu einer erstaunlichen Perfektion.
Man benutzte auf dem Gut tragbare Einzelmelkmaschinen, die Vorläufer der heutigen, vollautomatisierten Melkroboter. Es gab aber immer Tiere, die sich der Melkmaschine verweigerten, die nach dem Melker traten oder die Maschine umwarfen. Dann begann meine Aufgabe: Ich wärmte mir die Hände in heißem Wasser an und strich der Kuh mit sanften Bewegungen Melkfett auf die Zitzen. Das pflegte und heilte und war den Kühen offenbar angenehm. Ich molk also die Sensibelchen in der Herde von Hand. Die Mägde und die anderen Knechte nannten mich spöttisch den »Melker mit den warmen Händen«, ohne dass sie von meinem Schwulsein wussten.
Übrigens hat mir die Fähigkeit, einen heißen Zapfen gefühlvoll abzumelken, auch später viel Anerkennung eingebracht. Doch von dieser angenehmen Tätigkeit war ich damals noch weit entfernt. Ich musste mein kochendes Blut auf Sparflamme halten. Wenigstens durfte ich im ersten Stock des Gutshauses ein eigenes, kleines Zimmer bewohnen, ganz am Ende des langen Flurs. Jeden Abend und jeden Morgen – mindestens! – wichste ich mir im Bett die Seele aus dem Schwanz. Dabei hatte ich als Melker besonders früh aufzustehen und im Stall anzutanzen, denn wenn die Milchwagen der Molkerei kamen, mussten die gefüllten Milchkannen parat stehen. Der Gutsherr war da sehr streng.
Die beiden Van-Heeren-Söhne, die neben meiner Kammer in größeren, schöneren Zimmern residierten, hatten es besser, die durften länger schlafen.
Detlev, zehn Jahre älter als ich, war 1968 schon lange mit seinem Studium fertig und fungierte als Verwalter, Stellvertreter und Vertrauter seines Vaters Gustav van Heeren. Er hatte in Bonn Jura und Politik studiert, woran zu erkennen war, dass ihm die Landwirtschaft eigentlich wenig zusagte. Aber er war Gustavs Lieblingssohn und durfte sich viel erlauben. Ziemlich früh war Detlev in die konservative CDU eingetreten und hoffte auf einen lukrativen Posten im Stadtrat von Leer. Er maß einen Meter einundneunzig und wirkte muskulös und sportlich. Außerdem sah er verdammt gut aus, hatte tiefschwarze Locken und schöne, blaue Augen. So oft sich die Gelegenheit ergab, himmelte ich ihn von Weitem an. Von Nahem wagte ich es nicht.
Olav, Gustavs jüngerer Sohn, war genauso alt wie ich. Er hatte nur zwei Tage vor mir das Licht von Ostfriesland erblickt. Olav war viele Jahre lang mein Spielkamerad gewesen. Trotzdem empfand ich ihn nicht wirklich als Bruder. Vermutlich hatte sein Vater ihm beigebracht, dass ich nicht ebenbürtig wäre, und schon als Kind spürte ich diese unterschwellige Zurücksetzung. Olav war für mich nicht die unerreichbare Lichtgestalt wie Detlev, dafür war er mir zu nah und zu vertraut. Schon früh bemerkte ich jedoch, wie hübsch er aussah, und als wir älter wurden, himmelte ich auch ihn von Weitem an. Sein Körper wirkte schlanker als der seines Bruders, etwa so wie meiner, und er war nur einen Zentimeter größer als ich, nämlich ein Meter sechsundsiebzig. Sein dunkelbraunes, dichtes, glattes Haar schimmerte im Sonnenlicht wie reife Kastanien, und seine großen, grünbraunen Augen glitzerten golden. Je erwachsener er wurde, desto schöner sah er aus.
Von früher her kannte ich ihn auch nackt, denn wir hatten als Kinder zusammen in einer Wanne gebadet und waren in den Ferien oft ohne Höschen am Strand herumgelaufen. Irgendwann jedoch begann er, sich nicht mehr nackt vor mir zu zeigen. Ich wusste nicht, warum. Ich spürte in meinem Herzen nur immer ein tiefes Sehnen, wenn ich Olav sah.
So fühlte sich meine Seele hin- und hergerissen zwischen meinen beiden schönen Ziehbrüdern. Doch je mehr Zeit ins Land ging, desto weiter schienen sie sich von mir zu entfernen.
Meine schwärmerische Sehnsucht lenkte ich notgedrungen auf unsere Knechte. An einem milden Frühlingsabend des Jahres 1968 passierte etwas, das mich endlich aus meiner Naivität riss.
Das letzte Licht der Abenddämmerung lag über den Wiesen und Wäldchen des Gutes. Das Eintreiben der Kühe in den Stall und das abendliche Melken waren erledigt. Ich war an jenem Tag besonders unruhig. Mein Schwanz fühlte sich längst erwachsen, wollte Liebe und Nähe und vor allem Sex. Dieses ewige Versteckspielen, das Unterdrücken und Verschweigen quälten mich jeden Tag mehr.
An dem Abend wollte ich vor dem Schlafengehen wieder einmal hinaus in die Natur. Westlich vom Gutshaus erstreckte sich ein kleiner Wald. Dieses Wäldchen empfand ich als meinen Freund. Einen anderen Freund hatte ich ja nicht. Mitten zwischen den alten Bäumen gab es einen Teich, in dem Karpfen für das Silvesteressen heranwuchsen. Dort saß ich gerne und wichste, denn abends war da kein Mensch mehr. Doch diesmal erspähte ich zwei unserer Knechte, die am Teichufer lagerten. Ich erkannte Eibo und Bent, den Bent, über den die Magd so gehässig geredet hatte. Beide Männer waren zwanzig Jahre alt, echte Friesengewächse aus den Dörfern der Umgebung, blond und stämmig. Eibo hatte ich schon mal beim Pissen zugeguckt. Deshalb versteckte ich mich hinter einem dicken Baumstamm, denn ich hoffte, so etwas noch einmal geboten zu bekommen. Meine Erwartungen wurden weit übertroffen.
Gleich überlief mich die erste Hitzewelle: Die Knechte küssten einander! Zwei Kerle, die knutschten? Dann stimmte das, was die Magd geredet hatte? Meine Nägel krallten sich in die rissige Borke des Eichenstammes, mein Schwanz kribbelte und wuchs.
»Wenn uns einer sieht?«, zischte Eibo und schob Bent etwas zurück.
»Jetzt doch nicht! Die warten alle schon aufs Essen!«
Ich verstand jedes Wort in meinem Versteck.
Bent griff Eibo an die Schwanzbeule, was mir einen neuen, heißen Stich versetzte. »Komm! Ich will dich ficken!«
Das Wort »ficken« hatte ich zwar schon gehört, aber nie im Zusammenhang mit zwei Männern. Mein hartes Teil sprengte mir fast die Knöpfe der Arbeitshose auf, denn ich war von Mutter Natur bereits im zarten Alter von achtzehn mit einem großen, dicken Schwanz ausgestattet.
»Ich hab Angst!«, widersprach Eibo.
»Mach kein' Zirkus! Los, komm!« Bent riss an Eibos Hosenverschlüssen. »Wir wollten's doch mal im Grünen machen! Ich hab extra das Melkfett mitgenommen!«
Endlich machte Eibo seine Arbeitshose auf. Mir hing fast die Zunge aus dem Mund, als ich seinen total steifen Kolben aus dem Stoff federn sah. Der war nicht so groß wie meiner, aber das tat nichts zur Sache. Ich sah einen erregten Männerschwanz! Und dazu fest am Schaft anliegende Eier! Mit zitternden Fingern knöpfte ich mir den Hosenstall auf, weil ich fürchtete, sonst einfach in die Hose abzuladen. Ich biss mir auf die Lippen, um mein Stöhnen zu unterdrücken.
»Ja!«, seufzte Bent. »So ist gut! Komm! Streck mir den Arsch her!« Er riss sich selbst die Hose auf. Sein eisenharter Prügel schoss aus dem Hosenschlitz, und der war wirklich so groß wie meiner.
Aus meiner Eichel tropfte Honig auf den Waldboden. Voller Geilheit wichste ich mich.
Eibo ging jetzt auf alle Viere wie ein Hund. Sein nackter, weißer Arsch schimmerte in der Dämmerung. Bent schob seine Hose und die lockere Unterhose etwas tiefer, dann kniete er sich hinter Eibo, nahm seinen Ständer in die Hand, schmierte ihn mit Melkfett ein und drückte seine dicke Eichel an Eibos Arschloch.
Читать дальше