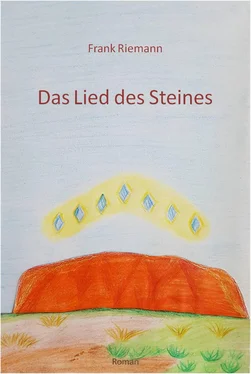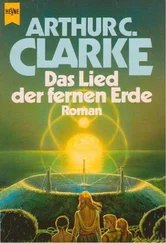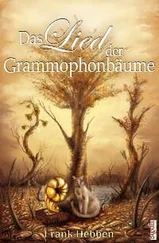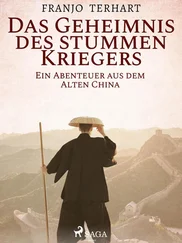»Gestern Abend hörte ich einen leisen aber doch hohen und anhaltenden Ton.« Naomi spitzte ihre Lippen und ließ ein langgezogenes `Uuuuuhhh` erklingen. »Da ich allein im Haus war, musste ich es natürlich verteidigen, bis meine Eltern wieder da waren. Ich nahm also eine Peitsche und all meinen Mut zusammen und sah mich draußen um. Gerade war ich durch die Tür, als das Geräusch wieder erklang, direkt unter mir. Deswegen krabbelte ich unter die Veranda und zuerst sah ich nichts.« Wie zum Beweis kniff sie die Augen zusammen. Nach einer kurzen Pause fuhr sie fort und einige Mitschüler erschraken. »Aber dann! Zwei teuflische Augen und blitzende Messerzähne. Dann sprang es mich an. Das Monster, schrecklich haarig und furchtbar schleimig.«
»Du spinnst ja«, wandte Tom Nelson, ein winziger Junge mit einer riesigen Brille, ein.
Zur Strafe erntete er einen vernichtenden Blick aus Naomis dunklen Augen.
Sie berichtete weiter: »Ich schrie und trat und kratzte und biß und schlug und zerrte. Und dann merkte ich, wie das Monster schwächer wurde. Nachdem es dann geflohen war, ging ich ins Haus zurück. Als ich es am nächsten Morgen meinen Eltern erzählte, waren sie ganz stolz auf mich.« Naomis strahlende Zähne mit der gähnenden Lücke grinsten in die Runde ihrer Zuhörer.
»Das glaubst du doch selbst nicht«, hatte Tom gezweifelt und seine Brille hochgeschoben. Drei Mitschüler nickten.
»Und was ist das?« Naomi öffnete ihre Hand und zeigte Allen ein kleines, mit einer seltsamen grünen Kruste verklebtes, Büschel Haare. »Das habe ich dem Monster aus dem Fell gerissen. Da seht Ihr es, es ist alles wahr.«
Tatsächlich war an jenem Abend ihr Hund in einen nahen Tümpel gesprungen und über und über mit Wasserpest und Algen überzogen gewesen. Er kam mit wedelndem Schwanz nach Hause und stürzte sich auf Naomi, um sie abzulecken, was ihr überhaupt nicht gefiel und sie zeterte und jammerte.
Aber wie sie jetzt mit dem vermeintlichen Beweisstück in der Hand dastand, wollte niemand mehr etwas Gegenteiliges behaupten. Eigentlich war es ihr egal, ob die anderen ihre Geschichten glaubten, oder nicht. »Hauptsache, sie hören mir zu«, dachte Naomi stets.
Ken stieß sie leicht an der Schulter. »Hey, was hast du denn?«
»Ich habe gestern etwas Schlimmes im Fernsehen gesehen.«
»Kommt jetzt wieder eine Story?«, wollte er wissen. Er war überhaupt nur noch mit ihr zusammen, weil sie ihn nie belog. Na, meistens jedenfalls nicht.
»Nein«, hörte Ken Naomi flüstern und nickte ernst.
Seine Freundin fuhr fort: »Ich habe gestern im Fernsehen gesehen, wie Männer miteinander gekämpft haben. Und sie haben aufeinander geschossen. Das war unten in Südafrika und mein Vater erklärte mir, dass dort schon lange schwarze gegen weiße Männer kämpfen. Früher soll das noch schlimmer gewesen sein, weil die Weißen die Schwarzen unterdrückt haben. Mein Vater hat mir das so erklärt, dass die Weißen alles durften, was sie wollten und die Schwarzen nicht. Das hat zwar schon nachgelassen, aber mein Vater sagt, dass es einige Weiße immer noch nicht ertragen können, dass Schwarze im selben Lokal essen, wie sie. Und heute Nacht habe ich geträumt, dass ein Junge hinter mir her läuft, mich fängt und mich dann verprügelt. Und dieser Junge warst du, Ken. Du warst größer als jetzt und stärker und hast mir sehr weh getan.« Eine Träne lief langsam über ihr Gesicht und sie fing sie mit der Zunge auf.
Ken verstand das Problem nicht. Nur weil irgendwo ein Weißer einen Schwarzen schlug, musste er das doch nicht bei seiner Freundin tun, nur weil er auch weiß und sie auch schwarz war. Ja, warum sollte er sie überhaupt schlagen? Er begriff gar nichts mehr. Die Nachbarn stritten sich auch öfters, und laut, und Mami und Daddy stritten sich nie. Der Mann im Laden schrie auch immer den Jungen an, der die Regale auffüllte. Der Hausmeister in der Schule machte das mit ihm auch nicht. Nicht alle Menschen waren gleich. Ken verstand Naomis Sorgen nicht, aber er spürte, dass er sie trösten musste. In solch einer Gemütslage hatte er sie noch nie erlebt, sonst war sie immer so fröhlich.
»Ich würde dir doch niemals etwas tun«, beruhigte er sie sanft.
»Nein?« Sie sah zu ihm auf.
Er witterte, dass er die richtigen Worte gefunden hatte.
»Nein. Und wenn die ganze Schule sich prügelt, oder unsere ganze Straße, ich werde immer dein Freund sein. Wir bleiben immer und ewig zusammen, ja?«
Naomi hörte zu weinen auf, schniefte laut und lächelte wieder.
Jetzt war er obenauf. »Und wenn dir Einer etwas tun will, bekommt er es mit mir zu tun.«
»Auch die Großen?«
Ken zögerte einen Moment aber als er bemerkte, wie sich ihre Miene wieder verfinsterte, bekräftigte er schnell: »Auch die Großen. Besonders die Großen.«
Sie nahm seine Hand, gab ihm einen Kuss auf die Wange, was ihn ganz ruhig und rot werden ließ und sie setzten ihren Weg fort. Sie sprachen über die Schule und darüber, dass Ken die Mathematiklehrerin nicht leiden konnte. Wenig später fanden sie heraus, dass Ken Mathe nicht mochte. Die Lehrerin mit ihrem streng zurückgekämmten Haar war gar nicht das eigentliche Problem.
Vor einer roten Ampel blieben sie stehen, als plötzlich ein Schuss die Stille zerriss.
Sioux City / Iowa, Montag 26. April, 07:40 Uhr
Gregory Bascomp trat aus der Tür, ging ein paar Schritte den schmalen Plattenweg hinunter, blieb vor seinem Dienstwagen stehen und sah sich noch einmal zu seinem Bungalow um. »Wie immer«, dachte er. »Niemand, der die Gardine zur Seite schiebt, um mir zum Abschied zu winken. Ich brauche ein Mädchen«, stellte er sehnsüchtig fest. »Eine, die mein Geld abholt, die Einkäufe tätigt, das Haus in Ordnung hält; und vor allem Anderen, die mich liebt, mich verabschiedet, wenn ich morgens gehe und mich begrüßt, wenn ich nachmittags nach Hause komme. Ich bin nicht fürs Alleinsein geschaffen«.
Es war bereits ein ganzes Jahr her, dass Suzie ihn verlassen hatte. Sie hatte die Schnauze voll von diesem Kaff, ging nach New York, um Kunst zu studieren.
»Meine Güte, Greg, hier fällt mir die Decke auf den Kopf. Der Mief erdrückt mich. Sioux City ist schon schlimm, aber hier am Stadtrand werde ich verrecken und niemand wird es bemerken.«
»Dann suchen wir uns ein Appartement im Zentrum.«
»Das ist doch nicht das Selbe. In New York habe ich doch ganz andere Möglichkeiten.«
Obwohl beide in Sioux City aufgewachsen waren, und obwohl er Suzie schon fünf Jahre gekannt hatte, hatte Greg immer das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie nur auf der Durchreise war.
Sie sprach immer davon, eines Tages die Welt zu erobern. Nach Chicago oder New York zu gehen, oder an die Westküste nach San Franzisco oder Los Angeles. Aber das war es nicht alleine. So viele, die in einer kleinen Stadt aufwuchsen, träumten doch davon, fort zu gehen und berühmt zu werden. Aber es war ihre Art, ihr Verhalten. Zum Beispiel schrieb sie fast nie ihren Absender auf irgendwelche Briefe.
»Die Menschen, die mir wichtig sind, wissen schon, wo sie mich finden«, sagte sie stets, wenn er sie darauf ansprach.
Allerdings wusste er jetzt nicht, wo sie in New York war. Was sagte das über ihre Beziehung aus? Wenn es denn überhaupt noch eine Beziehung war.
»Sieh es ein, Greg«, schalt er sich selbst, »Suzie hat nicht nur Sioux City verlassen.«
Dann war da noch, dass sie ein Jahr, nachdem sie bei ihm eingezogen war, noch immer nicht ihre Bücher aus den Kartons geholt und in die Regale gestellt hatte, obwohl dafür genügend Platz gewesen wäre.
»Das habe ich noch nie getan. Ich weiß genau, welches Buch sich in welchem Karton an welcher Stelle befindet.«
Sie ließ auch nie anschreiben. Am Ende der Straße hatte der alte Silver seinen Drugstore. Diesen Namen gaben ihm vor vielen Jahren ein paar kleine Jungs, Greg war selbst einer von ihnen gewesen, wegen seiner Haarfarbe. Sein Vater erzählte ihm einmal, dass Silvers Haare schon grau gewesen waren, als er als junger Mann in die Stadt gekommen war. Bei ihm ließ die ganze nähere Umgebung anschreiben.
Читать дальше