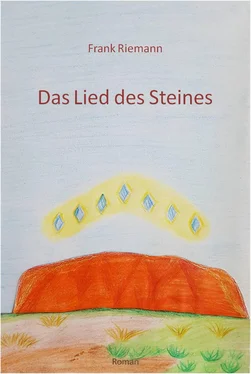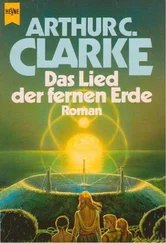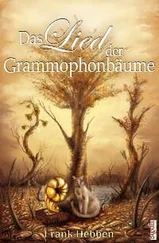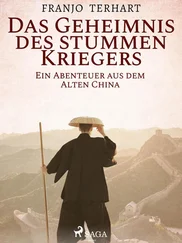Ben und Mondgesicht zogen durch die Straßen und hielten die Augen offen nach einem Zelt, einer Bretterhütte, einem leerstehenden Haus, einem Container, einem ausrangierten LKW, oder was sich sonst noch als Treffpunkt der Torros eignen würde.
»Warte mal«, meinte Roul nach einer Weile und stellte sich in einer Einfahrt an die Wand. »Meine Mutter gibt mir immer soviel Wasser zu trinken. Sie meint, ich würde davon abnehmen und glaubt, dass meine Haut dadurch besser werden würde. Sie nennt das verschlacken, oder so. Und dann muss ich immer den ganzen Tag davon pinkeln. Verrückte Alte.«
»Ist gut«, antwortete Ben, sah um die nächste Ecke und erschrak. Es waren ungefähr zehn Jungs, und sie sahen nicht freundlich aus. Sie bekämen die Prügel ihres Lebens, sobald die Torros um die Ecke biegen würden. Rasch eilte er zu Roul zurück, der sich gerade die Hose zuknöpfte und sich mit einer Hand durch die Haare fuhr. »Sie kommen. Zehn Mann. Lauf!«
»An der nächsten Straße trennen wir uns!«, rief Roul, der schon einige Meter vor ihm war. »Ich rechts, du links. Such die Anderen.« Und schon war er verschwunden.
Dass Ben nicht ohne Grund lief, verrieten ihm die Geräusche hinter ihm, das Stampfen der Füße und das Geschrei seiner Verfolger. Er rannte über die Straße und dann nach links. Er schaute über seine Schulter zurück und achtete darauf, ob die Anderen sich auch trennen würden, aber zu seinem Entsetzen stellte er fest, dass alle nur hinter ihm her waren. Anscheinend betrachteten sie ihn als das leichtere Opfer. Roul war zwar fülliger und schneller einzuholen, aber er war auch größer und stärker und würde vermutlich mehr Widerstand leisten, als der jüngere Ben.
Wie lange und wie weit er lief, wusste er hinterher nicht mehr zu sagen. Ben lief nur immer weiter in nördliche Richtung. Er bemerkte auch nicht, dass die Straßen etwas belebter wurden. Und dass die Torros immer noch auf seinen Fersen waren, entmutigte ihn eher, als dass es ihn anspornte. Er bekam kaum noch richtig Luft. Sein Kopf begann zu dröhnen und seine Bewegungen wurden langsamer, schleppender. Ben stolperte und stürzte. Er wollte sich fortzaubern, wollte aus dem Bett fallen und aufwachen oder zwei Stunden in die Vergangenheit reisen, dann würde er nach Hause gehen, aber nichts davon geschah. Er krümmte sich zusammen und umfasste mit beiden Armen seinen Kopf, um sich wenigstens notdürftig vor dem zu schützen, was nun kommen musste.
Und dann fielen sie über ihn her, wie seine dicken Cousinen über einen Kuchen. Es tat weh, er schmeckte Blut, zuckte unter den Schlägen und Tritten zusammen und schrie nach seiner Mutter. Erst als zwei Männer dazwischen gingen, seine Peiniger vertrieben und ihm auf die Beine halfen, konnte er wieder etwas sehen.
Hier stand er nun. Dreckig, zerlumpt, sein schwarzes Haar völlig verfilzt, Blut im Gesicht, alle Knochen schmerzten und da fuhr es genau vor ihm vorbei, dieses große amerikanische Auto. Die Erwachsenen redeten wild auf ihn ein, aber er hörte sie gar nicht richtig. Er hatte nur Augen für diesen Wagen. Er war sehr groß und lang. Er hatte viele Türen und dunkle Fenster. Er war von tiefem blau und er glänzte wie das weite Meer. Ben kannte die Marke nicht, aber in diesem Moment war dieses Auto für ihn zu einem Symbol der Kraft und Sicherheit geworden. Er wollte nicht mehr weglaufen, oder geschlagen werden. In so einem Wagen konnte einem nichts mehr zustoßen.
Und so hatte er angefangen all sein Geld zu sparen, auch auf der Polizeischule. Er wollte für Recht und Sicherheit einstehen und er wollte einen amerikanischen Wagen. Als es dann soweit war, reichte sein Geld lediglich für einen heruntergekommenen 1967er Buick, aber er liebte ihn.
Als Ramon Bastion ihn einließ, fühlte Ben sich nicht wohl. Er hatte den Mann der Toten aus dem Bett geholt, in Unterwäsche stand er vor ihm. Es war immer eine scheußliche Angelegenheit, jemanden vom Tod eines geliebten Menschen zu unterrichten.
»Was hat meine Alte jetzt schon wieder angestellt? Hat sie wieder das Gemüse geklaut? Hören Sie, Kumpel, wenn sie wieder Ärger gemacht hat, warum warten Sie nicht, bis sie nach Hause kommt, und kommen immer zu mir?«
»Senor Bastion, Ihre Frau kommt nicht mehr nach Hause.«
Bastion öffnete eine Flasche Bier mit den Zähnen, nahm einen tiefen Schluck, rülpste vernehmlich und knurrte: »Na toll. Und wer macht mir jetzt mein Essen?«
»Sie haben mich vielleicht nicht richtig verstanden. Ich bin Kommissar Latas, Mordkommission. Senor Bastion, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Frau ermordet wurde.« In Bens Kopf formten sich schon die nächsten Floskeln von `Es tut mir sehr leid` über `Wir werden alles daran setzen, den Mörder Ihrer Frau zu verhaften` bis zu `Wenn es Neuigkeiten gibt, werden wir Sie natürlich sofort benachrichtigen`, als Bastion seine Gedankengänge unterbrach...
»Das sieht ihr wieder ähnlich. Lässt sich irgendwo abmurksen und mich hier verrotten«, schimpfte der Mann ungehalten.
Ben startete sein Programm: »Es tut...«
»Ja sicher, es tut Ihnen leid und so weiter und so weiter. War`s das?«
»Ich fürchte, nein. Ich habe noch ein paar Fragen an Sie. Meinen Sie, dass Sie sie schon beantworten können, oder soll ich morgen wiederkommen?« Ben war etwas erschrocken über die Reaktion des Witwers und hätte nichts dagegen gehabt, wenn er jetzt gehen konnte. Andererseits hätte er dann noch einmal wiederkommen müssen. Der Typ widerte ihn an. Bastion war es egal. Der ungepflegte und unsympathische Mann war verärgerter über die morgendliche Störung, als über die Tatsache, dass soeben seine Frau getötet wurde. Und während Ben seine Fragen abspulte, leerte er eine weitere Flasche Bier. Nein, sie hatte keine Feinde. Nein, er wüsste nicht, wer sie umgebracht haben könnte. Nein, er wüsste auch kein Motiv. Es gab keine Versicherung und es gab auch nichts zu erben. Nein, sie hatte auch nicht sehr viele Freunde. »Sie hing ja nur zu Hause rum.«
Nach wenigen Minuten erhob sich Ben ohne den geringsten Hinweis.
»Fragen Sie doch mal in der Näherei nach«, waren die letzten verständlichen Worte, die er noch mitbekam, ehe Ramon Bastions Artikulation in ein undeutliches Murmeln überging.
Ben verließ die Wohnung, war froh über die frische Luft, stieg in seinen Wagen und fuhr in sein Büro. Vielleicht hatte ja der Gerichtsmediziner schon etwas herausgefunden. Er wollte erst den Bericht durchsehen, und später am Tag zum Arbeitsplatz der Toten fahren. Dann hätte er womöglich schon einen Anhaltspunkt. Oder sollte er der Pathologie noch etwas mehr Zeit geben und doch besser erst in der Näherei vorbei schauen?
Wie konnte er ahnen, dass sich in diesem speziellen Fall die Suche nach dem Mörder komplizierter und andersartiger erweisen sollte, als Alles, was er bisher erlebt hatte.
Mombasa / Kenia, Montag 26. April, 07:30 Uhr
Wie jeden Morgen holte er sie um diese Uhrzeit von zu Hause ab. Ken Gordon war sieben Jahre alt und seine großen grauen Augen blickten neugierig in die Welt. Naomi Banda war ebenfalls sieben Jahre alt und ihre langen dunklen Locken wippten bei jedem beschwingten Schritt im warmen Wind. Sie gingen jeden Tag zusammen zur Schule.
»Warum sagst du denn heute gar nichts? Du kannst doch sonst deinen Mund nicht halten und brabbelst den ganzen Tag.« Ken war ein wenig besorgt über die plötzliche Stille seiner Freundin.
»Gar nicht«, erwiderte Naomi schnippisch.
»Tust du doch.«
»Tu ich nicht. Ich brabbele nicht, sondern ich erzähle.« Naomi hielt sich für eine gute Geschichtenerzählerin. Sie erzählte Geschichten, die sie erfunden hatte, solche, die sie irgendwo aufgeschnappt und auf sich zugeschnitten hatte, und solche, die stimmten. Neulich trug sie der staunenden Schulklasse die Story vom Schleimmonster unter ihrer Veranda vor.
Читать дальше