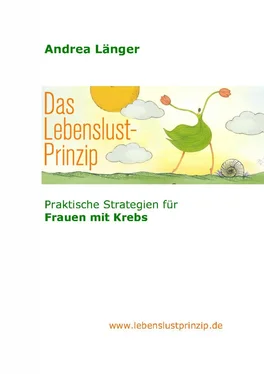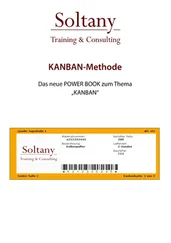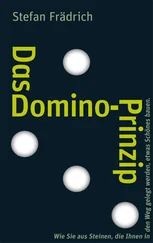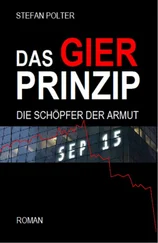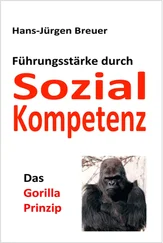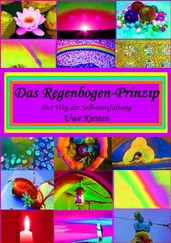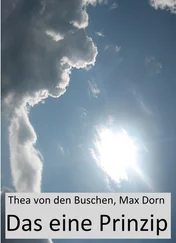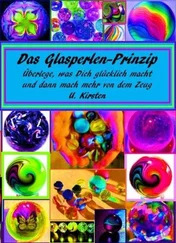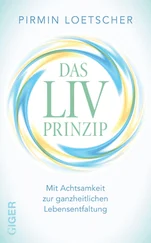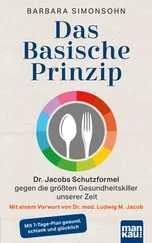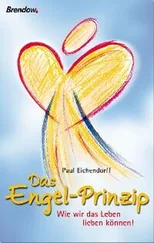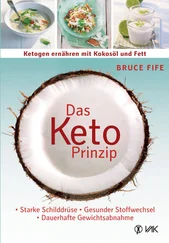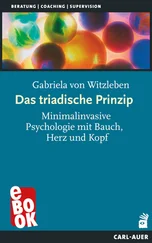Was wirklich fehlen würde, wenn es Krebs nicht gäbe, wäre die Liebe, die Nähe, die Zuneigung und Aufmerksamkeit, die Fürsorge und Pflege, die Menschen mit Krebs und ihre Familien und Freunde sich gegenseitig geben und miteinander erleben. Von Krebs Betroffene, ihre Angehörigen und Freunde stellen sich und ihr Leben in Frage, sie wenden sich einander zu, sie reden miteinander und zeigen ihre Gefühle. Durch Krebs entsteht ein Bewusstsein für sich und andere. Liebe zueinander und Verbundenheit miteinander werden sichtbar und erlebbar. In manchen Familien zum ersten Mal. Für manche Betroffene das erste Mal. Selbst Menschen, die den Krebs nicht überleben, lernen für ihr Leben und für ihr Sterben. Das kann für sie Heilung bedeuten. Erst am Ende ihres Lebens wird für manche erkennbar, dass der Krebs ihnen und ihren Angehörigen das Geschenk macht, sich verabschieden zu können.
Ängste haben, Schwäche zeigen, krank sein und sterben müssen, stellt unsere Welt des schönen Scheins, des Traums vom perfekten Körper und des stets wachsenden Konsums in Frage. Was uns fehlt ist der Mut, zu unseren Ängsten und Schwächen zu stehen und darüber zu sprechen. Warum ist diese Angst vor Schwäche so groß? Ist es die Angst vor den Gefühlen? Davor, sich überhaupt Ängste eingestehen zu müssen? Wie lebendig sind wir, wenn wir nicht fühlen? Haben wir Angst vor dem Leben? In diesen vermeintlichen Schwächen liegt ein großes persönliches Entwicklungspotenzial. Diese Schwäche und schwierige Gefühle erleben Frauen durch den Krebs zwangsläufig. Sich diesen Gefühlen zu stellen ist die große Herausforderung – nicht nur für Krebskranke. Für diese ganz besonders, da durch den Krebs womöglich weniger Zeit zum Leben bleibt.
Mit sich selbst und den eigenen Gefühlen (wieder) in Verbindung zu treten, die eigene Gefühlssprache zu lernen, ist die Aufgabe für jede Frau mit Krebs und letztlich für jede von uns. So wie wir in Beziehungen eine eigene Sprache mit dem Partner oder der Partnerin entwickeln, so können wir die Kommunikation mit uns selbst einüben. Wer dies kann, dem fällt es leichter, Krebsbetroffenen offen und ehrlich zu begegnen und heikle Gefühle anzusprechen. Krisen und schwierige Lebensphasen lassen sich besser bewältigen, wenn wir uns unseren Gefühlen stellen. Krankheiten und das Sterben bedrohen uns dann nicht mehr so sehr. Im Gegenteil: Wir können durch unsere Verlust-, Todes- und Existenzängste, unserer Angst vor dem Sterben ebenso lernen wie von unserer Wut, Panik, Verzweiflung, Ohnmacht, Traurigkeit und Trauer. Wir können durch den Krebs für unser Leben lernen: Liebe zu uns selbst, Vertrauen zu uns selbst, bedingungslose Liebe für andere, anderen Vertrauen schenken, Nähe und Verbundenheit zu dem Partner, den Angehörigen, Freundinnen, Freunden und Kollegen.
Mit Ihren Gefühlen und mit Ihrer Seele in Verbindung zu sein hilft Ihnen, sich selbst (wieder) zu vertrauen, Ihrer Intuition zu folgen, sich über Ihr Handeln bewusst zu werden und die für Sie richtigen Entscheidungen zu treffen. Darin liegt die große Chance für Sie und für Andere.
2. Schwierige Situationen, Gefühle und Herausforderungen
Schwierige Situationen gibt es nach der Diagnose Krebs viele: den Schock verkraften, Arzttermine wahrnehmen, Termine koordinieren, die passende Therapie finden, Entscheidungen treffen, Familie, Partner, Kinder versorgen, Freundschaften pflegen, sich die Krankengeschichten und Tipps anderer anhören sowie festgelegte Nachsorgetermine einhalten.
Noch unter dem psychischen Schock stehend, ist die Terminmühle bereits in vollem Gange: Untersuchungen absolvieren, Operationen bewältigen, Schmerzen aushalten und lindern, Arztgespräche über Diagnosen, Befunde, schulmedizinische und alternative Behandlungsmethoden sowie deren mögliche Nebenwirkungen führen. Alle Termine und Gespräche sind von Unsicherheiten und Ängsten begleitet, sie kosten Kraft und Energie. Schon die Koordination der Vielzahl von Terminen erfordert ein eigenes Zeitmanagement, damit diese vereinbar bleiben mit Ihrem Familien- und/oder Berufsalltag. Die passende und wirksame Therapie auszuwählen, gleicht der Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen. Groß ist die Informationsflut von allen Seiten, die zu filtern und einzusortieren sind. Mehr zu wissen heißt nicht unbedingt, weniger Angst zu haben oder schneller zu einer Entscheidung zu kommen. Die Materie „Krebs“ ist komplex, die Sprache zunächst fremd und unverständlich. Auch die zu erwartenden Nebenwirkungen der Therapien flößen Angst ein: Narben, Strahlenschäden, Haarausfall, Gewichtszunahme, um nur einige zu nennen. Die Komplexität und einhergehende Zukunftsängste können die Kommunikation mit Ärztinnen und Ärzten sowie mit Angehörigen und Freunden erschweren. Ratschläge, wie „das wird schon wieder“ oder „sei froh, dass du gesunde Kinder hast“ belasten zusätzlich anstatt zu trösten.
Sie müssen mitunter schnelle Entscheidungen treffen. Wenn Sie zum Beispiel vor der Frage stehen ob Sie eine Brust wieder aufbauen lassen wollen und dafür eine Muskel- und Hauttransplantation in Kauf nehmen. Oder ob Sie einer riskanten Operation Ihre Einwilligung geben oder sich mit den Folgeschäden einer Strahlentherapie schriftlich einverstanden erklären sollen. Die Dimensionen dieser Entscheidungen können Ihnen zu schaffen machen und sie haben Folgen für Ihr künftiges Leben. Tage oder Wochen nach der Operation setzt die Gedankenspirale über die Frage „was wäre, wenn ich wieder krank werde“ ein. Diese Frage taucht auch regelmäßig vor Nachsorgeterminen auf. Sie sind strapaziös, weil sie Erinnerungen an eine Zeit wach rufen, die mit Schrecken verbunden ist und die Sie vielleicht gerade erst mühsam bewältigt haben.
Diese Situationen zu meistern, alles im Blick zu behalten, das Heute und Ihre Zukunft, sich selbst und Ihr Umfeld, wird Ihnen bereits kurz nach der Diagnose abverlangt. Aufmerksam zuhören, klar bleiben und wichtige Entscheidungen bewusst treffen, ist für gesunde Menschen schon eine Herausforderung. In Ihrer aktuellen Situation kann es eine Überforderung sein.
Das Gefühlsleben während einer Krebserkrankung gleicht einer Achterbahnfahrt, vorerst ohne die Möglichkeit auszusteigen. Die Diagnose ist gestellt und hat das Leben in ein „davor“ und ein „danach“ geteilt. Im „danach“ gibt es keine Haltestelle und keinen Rückwärtsgang. Das Leben steht nun unter dem Vorzeichen vieler Ängste: vor dem Tod, vor dem Sterben, vor Schmerzen, vor einem langen Siechtum, vor körperlicher Verstümmelung, vor einem Rückfall, vor Metastasen, vor Einsamkeit, vor dem Verlassen werden, und so weiter. Das Gehirn entpuppt sich als regelrechte Angst-Erfindungsmaschine und füttert die Angstliste immer wieder neu. Der Nährboden für die Ängste ist die eigene Ohnmacht gegenüber dem Krebs im eigenen Körper. Zu erleben, wie wenig Sie selbst noch steuern können, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren und sogar den eigenen Gefühlen ausgeliefert zu sein – all dies überfordert. Schuldfragen, Panik, Verzweiflung und Verunsicherung machen sich breit. Der Lebensweg, das Berufsleben, Familienkonstellationen, Lebensentwürfe und Entscheidungen, die bisher als richtig galten, werden in Frage gestellt.
Begleitet werden die Ängste von Wut: auf den Krebs, auf sich selbst und auf das Schicksal. Die Wut treibt Betroffene um, erzeugt innere Unruhe, staut sich an und führt immer wieder zu der Frage „Warum ich?“, „Was habe ich falsch gemacht?“, „Was hätte ich anders machen können?“ und sogar „Für was werde ich bestraft?“. Der Umgang mit der Wut, sie zu spüren oder gar heraus zu lassen, ist für betroffene Frauen schwierig. Wütend und aggressiv sein, ist für Frauen nach wie vor ungewohnt und wenig vertraut. Wege, mit der Wut umzugehen und mit ihr zu leben, müssen erst erlernt werden.
Vertrauter ist Frauen dagegen das Gefühl der Traurigkeit. Deprimiert sein, innerlich leiden und weinen passen besser in das weibliche Rollenverhalten – auch heute noch. Frauen erlauben sich eher zu trauern als zu toben. Traurig sein können Frauen still und heimlich für sich alleine, niemand bekommt ihre Gefühle mit, wenn sie es nicht wollen. Frauen mit Krebs berichten von mehr Todes- als Lebensgedanken, von Selbstaufgabe, Dünnhäutigkeit und Einsamkeitsgefühlen bis hin zu dem Gefühl, nicht mehr vollwertig, gleich berechtigt und keine „richtige“ Frau mehr zu sein. Die Krebsdiagnose ist ein tiefer persönlicher Vertrauensverlust und mündet nicht selten in dem Vorwurf „ich habe ja wohl bisher alles falsch gemacht“. Die Wucht dieser Gefühle und Gedanken können Lähmung und Realitätsverlust hervorrufen. Depressive Verstimmungen, Trauerphasen, Rückzug und Depressionen sind häufige Folgen.
Читать дальше