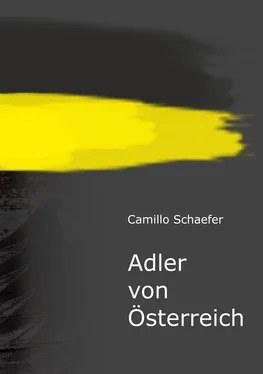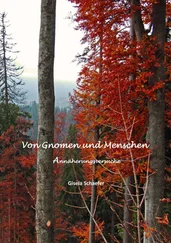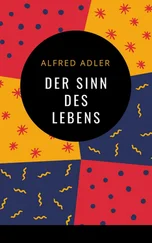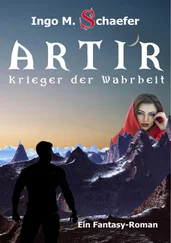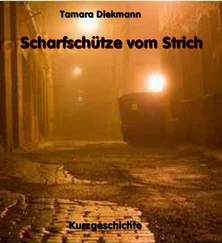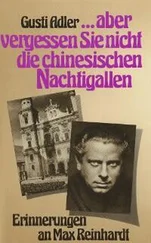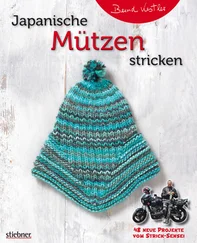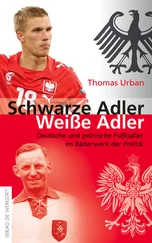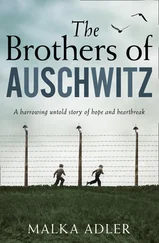Ein unentwegter, beharrlicher Trommler, hielt Ari Papp rückschauend fest, dass schon 1853 (also noch zu Zeit des Krimkriegs), auf österreichischer Seite 44 Bataillone, 32 Eskadronen, 11 Feld- und 4 Raketenbatterien, 8 technische Kompanien, insgesamt rund 70.000 Mann mit 7777 Pferden und 136 Geschützen, kampfbereit an der bosnischen Grenze gestanden seien. Erstes Operationsziel jener Geisterarmee, die im Ernstfall die türkische Grenze überschritten hätte, wäre Sarajevo gewesen - einzig der schlussendliche diplomatische Rückzug der Türkei hätte diesen militärischen Schlag buchstäblich in letzter Minute vereitelt.
Damit habe jedoch, erklärte Papp, gleichzeitig eine hochdramatische Entwicklung ihren langen Schatten vorausgeworfen, mit der auch das dualistische Österreich – nicht zuletzt durch seine rechtfertigten Ansprüche am Balkan bedingt -, nunmehr gewissermaßen schicksalhaft ins Zentrum der gegenwärtigen gesamteuropäischen Krise gerückt sei, deren Ausgang jedoch derzeit so düster und ungewiss erschiene, dass dringender Handlungsbedarf vonnöten bliebe.
Sein Chefredakteur bestellte Papp daraufhin zu sich, lobte ihn namens der neidvoll grinsenden Redaktion und erhöhte sein bisheriges Salär um die doppelten Bezüge, was umso willkommener war, da Papp teure Maßanzüge und handgenähte Budapesterschuhe bevorzugte, sich einen eigenen Hemdenschneider leistete und auch ansonsten sein Geld mit leichter Hand aus dem Fenster warf.
Seine wohl kalkulierten Artikelreihen, die den Gedanken an eine "Erwerbung" Bosniens, der schon lange festere Formen angenommen und heimlich und leise auch Anklang in den Staatskanzleien gefunden hatte, wo man ein militärisches Balkanabenteuer jedoch vorerst noch scheute, nunmehr in lebendiger Form öffentlich aufgriffen, beschäftigten freilich naturgemäß nicht nur die Abonnenten.
Während Papps Logik sich ohne jedes Zögern den Vorgängen auf dem Balkan anschmiegte, um damit ein emotionsgeladenes Echo zu finden, war die auswärtige Politik in Wien, wenngleich erfolglos, insgeheim längst mit obskuren Tauschabsichten beschäftigt gewesen, die Österreich durch den Zuschlag diverser Gebiete entschädigen sollten. Selbst Bismarck schien mittlerweile zunehmend geneigter, die Donaumonarchie in der sogenannten >Bosnischen Frage< maßgeblich zu unterstützen, umso mehr der plötzliche Sturz des österreichischen Außenministers Graf Beust, eines seiner erbitterten Gegner, sowie die überaus effektvolle Bestellung des ungarischen Ministerpräsidenten und ehemaligen 1848er-Rebellen, Graf Gyula (Julius) Andrássy zu dessen Nachfolger, dem Deutschen Reich schon im Vorfeld einen unabdingbaren Wechsel der österreichischen Außenpolitik signalisiert hatte.
In Dresden geboren, sah sich Beust, nach dem Scheitern seiner preußenfeindlichen Pläne, nunmehr auf einen Botschaftersessel nach London verbannt, wogegen der eigenwillige Graf Andrássy das von Österreich-Ungarn gemeinsam geführte k. u. k. Ministerium des Auswärtigen auf dem Ballhausplatz in Wien dirigierte.
"Ah, was!" hatte man in der Residenzstadt darüber gemeckert. "Was wollen diese hergelaufenen Erfinder des Paprika, die Ungarn, eigentlich noch von uns ham, he? Gibt man denen nur einmal die Hand, fehlt einem gleich ein Finger."
Dass damit, erstmals in der Geschichte der Monarchie, das Kaiserhaus einen Magyaren zum Vertreter seiner auswärtigen Interessen berufen hatte, war freilich keinesfalls Zufall gewesen - wohl kaum ein österreichischer Politiker hätte, wie auch Arpad Papp häufig anzumerken verstand, die überkommenen Regeln der bisherigen Außenpolitik dermaßen leicht abzuschütteln vermocht, wie der besagte Rebellengraf.
Als blutvoller Ungar, die - sowohl durch den vollzogenen Ausgleich wie von der "klein-deutschen" Lösung - nunmehr endgültig gebannte deutsche Vormachtstellung innerhalb der Monarchie nicht länger befürchten müssend, hatte Graf Andrássy als ungarischer Ministerpräsident schon bei Ausbruch der deutsch-französischen Feindseligkeiten auf strikte Neutralität beharrt, um inzwischen vielmehr ein alle überraschendes, politisches Bündnis zwischen Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reich anzustreben. Ein analytischer Geist mit stark ausgeprägten politischen Sensoren, wusste der Graf sich freilich ebenso - die menschliche Begrenztheit erkennend -, in seinen außenpolitischen Intentionen schon im Vorhinein ziemlich auf sich alleine gestellt. Aus einer Familie stammend, die ihre patriotische Gesinnung auch schon in der Türkenzeit niemals verleugnet hatte, empfand Andrássy einzig für den äußerst rechten Flügel der Monarchie, der für ihn einen übertrieben linken Kurs verfolgte, gewisse Sympathien. Von einer derartigen Einstellung geprägt, bereitete sein national-patriotisches Engagement sowie sein geradliniges Rechtsbewusstsein ihm naturgemäß Schwierigkeiten, sich in das bestehende diplomatische System willfährig einzuordnen. Sollte die von ihm inaugurierte, neue Balkanpolitik jedoch tatsächlich Wirkung zeigen und einen vollwertigen Ersatz für den Verlust der österreichischen Position in Deutschland und Italien bieten, sollte sie selbstverständlich aktiven Charakter besitzen - eine >diplomatisch aktive Balkanpolitik< vertrug sich jedoch mit Andrássys zeitweiligen Überlegungen, die marode Türkei bis auf weiteres noch "konservieren" zu wollen, nur äußerst schlecht - oder eigentlich gar nicht.
Seine Haltung in dieser Frage krankte somit von allem Anfang an einem logischen Zwiespalt; er befand sich damit in dem Dilemma, zwischen zwei politische Mühlräder geraten zu sein.
Einem alten Adelsgeschlecht entstammend, war Graf Andràssy, dem Ari Papp in seinen Kommentaren etliche Lobesartikel stiftete, ein Mann mit höchst abenteuerlicher Biographie. Zuerst Mitkämpfer und Rebell im ungarischen Unabhängigkeitskrieg 1848/49, danach als diplomatischer Agent der sogenannten >Debreciner Regierung< nach Stambul geflüchtet und in effigie (d. h. symbolisch) zum Tode verurteilt, war er, 1857 wieder amnestiert, 1861 bereits Abgeordneter im ungarischen Reichstag gewesen, um 1867 erster Ministerpräsident Ungarns zu werden.
Während das nationale ungarische Bewusstsein noch das Gedenken an das >Arader-Strafgericht< trübte, wo, nicht nur den Mitgliedern der ungarischen >Magnaten-Tafel< unvergesslich, nach der Niederwerfung der selbsternannten Ungarischen Republik, neun aufständische Generäle gehenkt und vier stante pede erschossen worden waren, während Ministerpräsident Graf Ludwig Batthyány sich, zum Galgen verurteilt, in der Haft selbst eine Halswunde beigebracht hatte, um füsiliert zu werden, war Graf Andrássy, neben dem damit sein politisches Lebenswerk krönenden Franz von Deák, daraufhin maßgeblich an den Präliminarien des Ausgleichs beteiligt gewesen. Zwar gemeinsam mit Deák auch noch die Wiederherstellung der ungarischen Verfassung von 1848 bewirkend, vertrat Andrássy als k. u. k. Außenminister jedoch keinen ausgesprochen "magyarischen" Kurs, zumal er die historischen Rechte seines Landes als mit der Großmachtstellung der freilich zerrissenen, unschlüssig handelnden Monarchie inzwischen in Einklang gebracht sah. Sein wahres Ziel bestand seither vielmehr darin, die Bedeutung des europäischen Orients für das alte Kaiserreich wahrzunehmen, um - nicht zuletzt dessen geopolitischer Lage sowie der äußeren Verhältnisse wegen - in Zukunft eine entscheidende Rolle im Kräftespiel auf der Balkanhalbinsel wahrzunehmen, ohne aber die Monarchie deshalb sogleich gefährlichen neuen Erschütterungen auszusetzen. Anstatt der Annexionsabsichten der Militärs, die sogar den Kaiser zu gelegentlichen Träumen hinrissen, verfolgte er als Außenminister insgeheim die Absicht, die dahinsiechende, kränkelnde Türkei möglichst lange zu erhalten, aber, wie er in kleinem Kreis sagte, "im gegebenen Moment an ihre Stelle zu treten, falls es ihr an der Kraft mangeln sollte, ihre Position selbst zu verteidigen".
Читать дальше