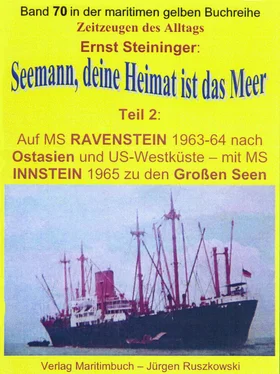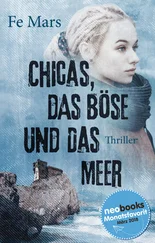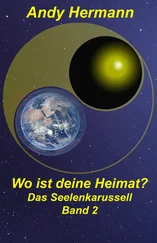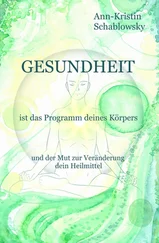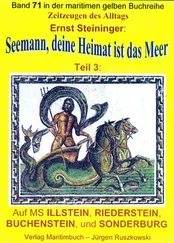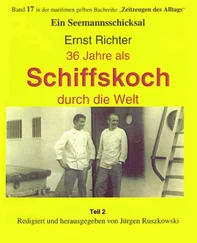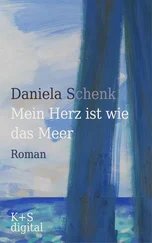Also zitiere ich wieder einmal mehr Wikipedia: Cabo de Sao Vicente (Kap Sankt Vinzenz) ist seit dem Neolithikum ein heiliger Ort, wie Menhire (Steinsetzungen) in der Umgebung zeigen. Zu Zeiten der Phönizier soll er der Gottheit Melkart geweiht gewesen sein. Die Griechen nannten den Ort Ophiussa (Land der Schlangen) und seine Bewohner Oestrimini (Bewohner des äußersten Westens), von den Römern wurde er Promontorium sacrum (Heiliges Vorgebirge) genannt, als magischer Ort am Ende der Welt, an dem die Götter wohnen und die Sonne im Meer versinkt.
Die Christen nannten die Küstenspitze nach dem Heiligen Vinzenz von Saragossa, einem Schutzpatron der Seefahrer. Der Legende nach soll hier im Jahr 304 der Leichnam des Märtyrers in einem Boot angetrieben und geborgen worden sein.
Und das soll ein Mensch glauben? Weiß doch jedermann, jedenfalls jeder Seemann, dass der Atlantik in das Mittelmeer hinein und nicht umgekehrt das Mittelmeer in den Atlantik hinaus fließt. Ferner: Saragossa liegt weit hinten im Binnenland, an einem Fluss namens Ebro; der ergießt sich wiederum beim Cap de Tortosa ins Mittelmeer. Ergo stellt sich die Frage: Wie soll der schwimmende Sarg nach dem eh schon von vielerlei Hindernissen gesäumten Weg entlang der spanischen Mittelmeerküste auch noch die natürliche Wasserbarriere von Gibraltar überwunden haben? Um die konstante west-östliche Oberflächenströmung auszutricksen, hätte das Boot samt Inhalt schon tauchen müssen, um sich mit dem gegenläufigen Tiefenstrom in den Atlantik zu mogeln. Allerdings – die gewitzten Seefahrer der Antike sollen angeblich von dieser „unterirdischen“ Gegenströmung bereits gewusst und sich ihrer auch bedient haben. Und zwar so, dass sie vom Steven ihres Schiffes einen Treibanker in ausreichende Wassertiefe verbrachten und auf diese clevere Art und Weise die Säulen des Herkules in Ost-West-Richtung passierten.
Na, ganz so einfach wird das nicht gewesen sein. Wer weiß, ob es überhaupt wahr ist? Vielleicht hat da bloß wieder einmal einer „g`schwanert“. Aber was ist nun mit unserem Märtyrer, dem Heiligen Vinzenz? Wollte der etwa auch mit Hilfe eines Treibankers an andere, neue Ufer? Gesetzt der Fall, er war bei der Abreise in Saragossa noch gar keine Leiche, sondern gesund und munter und voll des missionarischen Tatendrangs. Und nehmen wir weiter an, dass sich der gute Mann auf einem seetüchtigen Handelsschiff eingeschifft hatte, dessen Ziel vielleicht die heidnischen Zinninseln im fernen Nordwesten Europas waren. Ja, solchermaßen hätte er möglicherweise sein damals noch nicht nach ihm benanntes Kap auf seinen Namen taufen können. Weil er aber der Legende nach daselbst nur als Leiche in einem Beiboot antrieb, ist diese Option leider auszuschließen. Eher liegt die Vermutung nahe, dass es ihm wie dem Propheten wider Willen, dem störrischen Jonas, erging. Da soll nämlich der Kapitän des Schiffes es verabsäumt haben, dem jähzornigen Poseidon die ihm zustehende Gebühr zu entrichten. Und Götter zu ignorieren oder gar zu betrügen, das ist noch niemals nie gut ausgegangen. Die Folge in diesem Fall: ein fürchterlicher Sturm! Na, und was pflegten da die abergläubischen Seeleute in solch unerquicklicher Situation zu tun, um Neptun respektive Poseidon zu besänftigen? Sie brachten ihm ein Opfer dar. Wenn aber die Opfergaben rar, kein Gold, kein Weihrauch und auch kein Zwieback mehr an Bord waren, dann… Dann war es halt immer noch besser, lieber eine nutzlose Landratte anstelle eines wertvollen Seemanns zu opfern. Tja, so oder so ähnlich könnte das Kap zu seinem Namen gekommen sein. Mich verbürgen dafür, das möchte ich freilich nicht.
Da wir nun schon einmal an der Algarve sind, dem wohl bekanntesten Küstenabschnitt Portugals, darf auch das Städtchen Sagres nicht unerwähnt bleiben. Im Internet steht zu lesen: Sagres: Im Ortsnamen spiegelt sich Portugals Selbstbewusstsein. Denn in und um Sagres wirkte Infante Dom Henrique (Prinz Heinrich der Seefahrer), der Ahnherr der Entdeckungen zur See. Der Prinz hatte die Vision, sein Land, eingezwängt von Spanien und dem Atlantik, zu einer Seefahrernation werden zu lassen – was ihm mit Hilfe der Navigation auch gelang: Binnen zweier Generationen wurde das unbedeutende Portugal zum reichsten Land Europas. …
Davon spürt man hier im Ort allerdings nur noch wenig, sieht man von der Fortaleza ab. Diese einen Kilometer außerhalb gelegene Festungsanlage aus dem 17. Jahrhundert riegelt die Ponta de Sagres ab, ein kahles, vom Wind gebürstetes Felsplateau, das ins wellenbewegte Meer hinausragt. Ringsum stürzen schroffe Klippenwände über 60 m tief senkrecht ab. Die Ponta stellt das Schwesterkap zu Sao Vicente dar sowie den Anfangspunkt der Barlavento Küste. Vom westlichen Klippenrand haben Sie eine unvergessliche Aussicht auf die Bucht von Beliche bis Sao Vicente, vom östlichen auf die Bucht von Sagres mit den vorgelagerten Inseln von Martinhal und den Fischerhafen.
Beim Staunen können Sie sich ausmalen, wie hier vor 500 Jahren der Prinz und seine Mannen standen und davon träumten, draußen im Meer auf neue Ufer zu stoßen. …
Na, na, na, Prinz Heinrich (1394 - 1460) war ganz gewiss kein Träumer. Fakten belegen, dass er bereits im zarten Alter von 21 Jahren, also kaum großjährig, eine portugiesische Invasionsflotte befehligte. Die sollte den „Ungläubigen“, den verhassten Mauren, das afrikanische Ceuta entreißen – was auch gelang. Am 21. August 1415 obsiegten die christlichen Heerscharen über die Muselmanen, und als Dank für seine Leistung wurde Dom Henrique die Stadt anvertraut. Anvertraut? Das Wort erscheint mir ein bisschen zu zahm dafür, dass er sich eine ganze Stadt samt Umland gewaltsam unter den Nagel gerissen hat. Und überhaupt, wer hat das ganze räuberische Unternehmen eigentlich finanziert? Darüber schweigen die Geschichtsbücher. Aber immerhin sagen sie aus, dass der junge Aufsteiger königlichen Geblüts im Jahre 1418 zum Gouverneur und obersten Verwalter des Ordens der Christusritter avancierte. Aha, daher also wehte der Wind bzw. flatterte das Geld in des Prinzen Hosentaschen…
Nun muss man dem Prinzen aber zugute halten, dass er mit den Einahmen aus seinen Pfründen nicht so leichtfertig umging wie, zum Beispiel, heutzutage gewisse großkotzige Manager und willfährige Politiker. Weitsichtig, wenn auch nicht ganz uneigennützig, investierte er sein stetig wachsendes Vermögen in die Zukunft seines Landes. Und die Zukunft lag, das sah der Prinz ganz klar, auf dem Meer. Also mussten als erstes Schiffe her. Dazu verpflichtete er erfahrene holländische Schiffbauer, die aus einer Mischung von hanseatischer Kogge und arabischer Dhau die Karavelle erfanden.
Das flache, wendige Schiffchen, ausgerüstet mit Lateiner- und Rahsegeln, konnte das, was bislang nicht möglich war, nämlich: gegen den Wind segeln. Mit diesem neuen Schiffstyp, der die damalige maritime Welt geradezu revolutionierte, hatte Dom Henrique o Navegador, so wie er fürderhin genannt wurde, das geeignete Instrument für seine Afrika-Pläne zur Hand. Denn dort, irgendwo hinter der Sahara, lag der Sage nach das Reich des Priesterkönigs Johannes. Und weil der direkte Weg wegen der renitenten Mauren und erst recht wegen des vielen Sandes nicht in Frage kam, blieb eben nur der lange Seeweg längs der afrikanischen Westküste.
Der aber war auch nicht so ganz ohne, weil da die Küstenwinde nur sehr einseitig, dafür aber stetig aus NE blasen. Deswegen, so vermute ich, war diese Route bei den Kapitänen auch nicht sehr beliebt, war es doch für viele eine Reise ohne Wiederkehr. Dabei kann man da nicht einmal von einem Himmelfahrtskommando sprechen, denn hinter dem Kap Bojador, da lauerte das „Böse“ im „Meer der Finsternis“. Die Seeleute erfanden Schreckensbildnisse: Menschen verschlingende Seeungeheuer in einem kochend heißen, bleiernen Meer. Also, es war schlichtweg die Hölle, die einen da erwartete. Doch dann kam Heinrich mit seinen Karavellen und schlug alle noch so gängigen Ausreden einfach in den Wind. 1434 umsegelte Kapitän Gil Eanes als erster Portugiese das bislang so gefürchtete Kap Bojador und bewies mit seiner Rückkehr die „Segeltüchtigkeit“ der Karavelle. Daraufhin gab es für die Portugiesen kein Halten mehr. Sie erkundeten und eroberten die Westküste Afrikas sozusagen im Sturm. Allerdings, das sagenhafte Christenreich des Johannes, das fanden sie dabei nicht. Stattdessen stießen sie auf „menschenähnliche Zweibeiner“ mit schwarzer Haut, die sie kurzerhand als Ware mit in die Heimat transportierten, um sie da an reiche Latifundienbesitzer als Sklaven zu verkaufen. Auch der Prinz hatte keine Skrupel, sich an diesem Geschäft zu beteiligen. Seine Moral war eben die eines christlich erzogenen Potentaten. Das berechtigte ihn ja geradezu, sowohl die Mauren zu jagen, wo immer er ihrer habhaft werden konnte als auch sich fremdes Eigentum rücksichtslos anzueignen. Es wirft auch nicht gerade ein gutes Licht auf ihn, dass er seinen leiblichen Bruder Fernando, der 1437 bei dem missglückten Versuch, Tanger zu erobern, von den Mauren gefangen genommen wurde, in elfjähriger Gefangenschaft verrecken ließ. Der Prinz war schlicht nicht bereit, das hohe Lösegeld, die Rückgabe von Ceuta, zu bezahlen. Seine Pfründe galten ihm halt mehr als das Leben seines Bruders. Nun, man könnte einwenden, der gute Mann hatte Wichtigeres zu tun, und außerdem – als eine wichtige Staatsinstitution durfte er einfach nicht erpressbar sein. Aber ansonsten lief alles wie geschmiert. 1444 gründete er in Lagos die Companhia de Lagos, die das Handelsmonopol mit Afrika erhielt. 1458 eroberte er Alcacer Seguer. Das war sein letzter Triumph über die Mauren, denen er als Boss der Christusritter-Bande sein ganzes Leben lang stets eifrig nachgestellt hatte.
Читать дальше