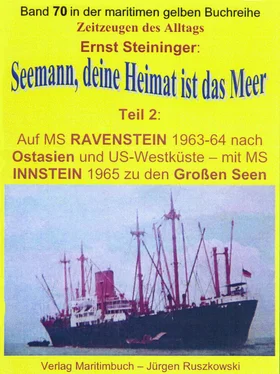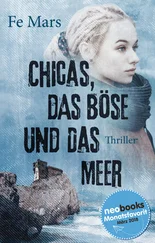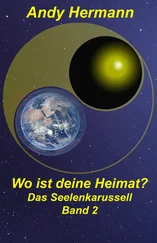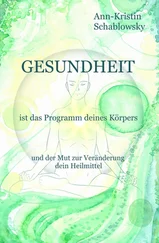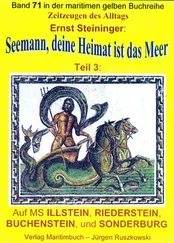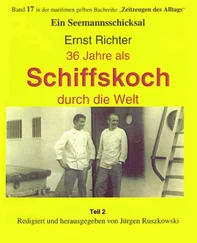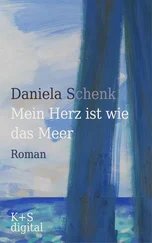Wenngleich das lateinische „finis terrae“ auf gut deutsch „Ende der Welt“ heißt, so heißt das aber noch lange nicht, dass das auch so stimmt. Allenfalls stimmt es für die hartnäckigsten unter den „Jakobspilgern“, die das Kap für das eigentliche Ende ihrer Pilgerfahrt halten. Der westlichste Punkt des europäischen Festlandes liegt aber auf portugiesischem Boden und heißt Cabo da Roca. Dieses Kap, auf das wir nun mit annähernd 180° zusteuern, liegt 30 Kilometer westlich von Lissabon und hat die Koordinaten Y = 38° 47’ Nord, l = 9° 30’ West. Es liegt somit 16, 5 km weiter westlich als das spanische Cabo de Finisterre. Jedenfalls behauptet das und anderes die freie Enzyklopädie Wikipedia:
Es gibt dort ein Fremdenverkehrsbüro, in dem man sich gegen eine Gebühr den Besuch auf einer kunstvoll gestalteten Urkunde bestätigen lassen kann. Ansonsten gibt es noch einen Leuchtturm und einen Seefunksender.
„Donnerwetter, einen Leuchtturm gibt es also auch!“ Er steht sogar 140 Meter über dem Meeresspiegel und ist somit kaum zu übersehen. Für die Seefahrt ist er neben dem Cabo Raso allerdings nur als Ansteuerungspunkt für die großen Häfen an der Tejo-Mündung – Barreiro, Belem und Lissabon – von Interesse. Und das, was der portugiesische Nationaldichter Luis de Camoa über diesen Ort aussagt, nämlich dass da die Erde endet und das Meer beginnt, das ist doch, bei allem Respekt vor der Poesie – Onde a terra acaba e o mar comeca – so umwerfend auch wieder nicht…
Mit annähernd SzE, (Süden zum Osten = 168° 30’), das deutsche Wort Ost musste mittlerweile dem englischen East weichen, visieren wir die nächste Kursänderung, pardon, den nächstfolgenden Waypoint an, Cabo de Sao Vicente: y = 37° 1’ 30’’ Nord, l = 8° 59’ 40’’ West. Die Leuchtfeueranlage mit dem 22 m hohen, rotweißen Turm sitzt auf der Kante einer 70 m hohen Steilküste. Mit 32 Seemeilen (knapp 60 km) Tragweite ist es das lichtstärkste Leuchtfeuer Europas. Vielleicht sollte ich hier einige technische Begriffe, entnommen dem „Handbuch für Brücke und Kartenhaus, ergänzend mit einfügen.
Da steht unter:
Leuchtfeuer und Nebelschallsender
Leuchtfeuer gehören zu den wichtigsten und besten Navigationshilfen für die nächtliche Fahrt an den Küsten und auf den Revieren. Sie dienen nicht nur als Warnung vor Untiefen und Gefahren, sondern ermöglichen zuverlässige Ortsbestimmungen und werden in besonderen Anordnungen zur Bezeichnung der Fahrwasser verwendet. Die Reichweite der einzelnen Leuchtfeuer hängt von der Höhe und Stärke ihrer Lichtquelle ab und wird außerdem durch den Sichtigkeitsgrad der Luft bestimmt.
Unter dem Titel: „Benennung der Leuchtfeuer nach besonderen Zwecken“ sind die verschiedenartigen Feuer angegeben: das Leit-, das Tor-, das Richt-, das Unter-, das Quermarken-, das Gefahren-, das Luftfahrt- und das Warnfeuer. Diese Feuer, auf die ich hier nicht extra eingehe, erfüllen ihren Zweck entsprechend ihrer Benennung.
Kennzeichnung der Leuchtfeuer
Lichterscheinungen der Leuchtfeuer. Die vorübergehenden Lichterscheinungen, die durch Verdunkelungen oder Änderungen der Stärke des weißen oder farbigen Lichtes entstehen, heißen Scheine, Blinke, Blitze; und zwar heißt in der Regel
Schein: die Lichterscheinung zwischen zwei Verdunkelungen oder Abschwächungen oder zwischen zwei Lichterscheinungen anderer Farbe. Diese dürfen höchstens die Dauer der Lichterscheinungen haben.
Blink: das Aufleuchten von mindestens 2 s Dauer aus einer im Verhältnis zur Lichterscheinung langen Dunkelheit oder aus schwachem Licht heraus.
Blitz: das Aufleuchten von weniger als 2 s Dauer aus einer im Verhältnis zur Lichterscheinung langen Dunkelheit oder aus schwachem Licht heraus. (Bei deutschen Feuern beträgt die Zeitdauer für den Blitz im Allgemeinen höchstens 1 s).
Der Unterschied zwischen Blink und Blitz liegt nur im Zeitmaß.
Wiederkehr: die Zeit vom Eintritt einer bestimmten Taktkennung bis zum Wiedereintritt der nächsten gleichen Taktkennung.
Arten der Kennung der Leuchtfeuer: Der ein Leuchtfeuer kennzeichnende Verlauf seiner Lichterscheinungen wird Kennung genannt. Zu unterscheiden sind folgende Arten der Kennung:
Festfeuer (F.), weißes oder farbiges Licht von gleich bleibender Stärke und Farbe.
Unterbrochenes Feuer (Ubr.), weiße oder farbige Scheine zwischen Verdunkelungen (Unterbrechungen), und zwar: Unterbrochenes Feuer mit Einzelunterbrechungen und unterbrochenes Feuer mit Gruppen von 2, 3, 4 Unterbrechungen.
Und so weiter. Gibt es doch, wie oben bereits angeführt, der unterschiedlichen Feuer gar viele. Im nächsten Absatz des Handbuches wird in der gleichen umständlich trockenen Schreibweise das Ausmachen der Kennung erklärt. Aber das will ich Ihnen lieber ersparen und stattdessen meine persönliche Art der „Takterkennung“ vorstellen, ganz so, wie ich es als „Moses“ erlernte. Beim ersten Blink oder Blitz zählte ich die Dauer der Unterbrechung(en) an den Fingern meiner beiden Hände ab. Mit dem linken Daumen begann ich zu zählen: Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, wenn nötig, bis neunundzwanzig. Das funktionierte immer, auch wenn eine der Unterbrechungen mal über 10 Sekunden lang war, dann fing ich eben mit dem linken Daumen noch einmal von vorne an. Sobald sich die Anzahl der Blitze und der dazwischen liegenden Unterbrechungen wiederholte, stand für mich die Kennung fest. Die servierte ich dann, innerlich voller Stolz auf meine nautischen Kenntnisse, dem angenehm überraschten Wachoffizier.
In jenen grauen nautischen Vorzeiten, damals, als sich die Steuermänner noch mit optischen Mitteln an den Küsten entlang peilen mussten und ihre „Orte“ nicht per GPS prompt und frei Haus laufend geliefert bekamen, war auch das Wissen von der Tragweite des Lichts, der geographischen Sichtweite, von großer Wichtigkeit. Ich zitiere:
Tragweite und Geographische Sichtweite. Unter Tragweite versteht man denjenigen Abstand, in dem ein Feuer einen noch eben deutlichen Lichteindruck am Auge des Beobachters hervorruft; die Tragweite ist unter anderem abhängig von der Lichtstärke des Feuers und dem Sichtwert = Lichtdurchlässigkeit der Atmosphäre.
International ist festgelegt worden, die Tragweite der Feuer für einen Sichtwert 0,74, der einer meteorologischen Sichtweite am Tage von 10 sm entspricht, anzugeben und als Nenntragweite zu bezeichnen. Die Tragweite eines Feuers bei anderen meteorologischen Sichtweiten und seine Lichtstärke lässt sich aus der Tafel „Tragweite der Leuchtfeuer“ ablesen. …
… Unter geographischer Sichtweite versteht man denjenigen Abstand, aus dem man ein in bestimmter Höhe über dem Meeresspiegel befindliches Ziel eben noch über die Kimm weg erblicken kann; die geographische Sichtweite eines Feuers ist also abhängig von der Feuerhöhe und der Augenhöhe des Beobachters. Aus der Tafel „Abstand eines Feuers in der Kimm“ kann bei bestimmter Feuerhöhe die Sichtweite in sm (1 sm = 1.852 m) für verschiedene Augenhöhen entnommen werden.
… Anleitung für die Benutzung der Tafel „Tragweite der Leuchtfeuer“. Ist die Nenntragweite eines Feuers z. B. mit 20 sm angegeben, so wird man dieses Feuer bei einer meteorologischen Sichtweite von 5,4 sm in einem Abstand von 12,5 sm sehen. Die Lichtstärke dieses Feuers beträgt 110 00 cd.
Das hört sich ja schon richtig akademisch an. Na ja, damals war das AG, Kapitänspatent für Große Fahrt, nicht unter 6 Semester Seefahrtschule zu haben, vorausgesetzt, man hatte einen qualifizierten Schulabschluss. Da sollte man dann schon mit Zahlentafeln umgehen können, wenngleich die Tafel für meteorologische Sichtweite in der Praxis wohl kaum Verwendung fand und ganz schlicht durch „Pi mal Daumen“ ersetzt wurde.
Читать дальше