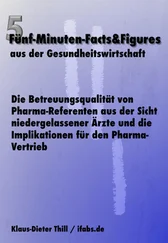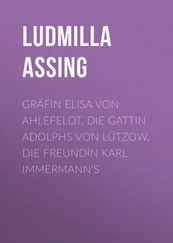1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 Allerdings nur solange, bis der ungebetene Gast endlich entdeckt wurde, und der Tanz abrupt endete.
Zunächst noch ein wenig zögerlich, dann immer rascher und von wachsender Neugier getrieben, bewegten sich die seltsamen Wesen jetzt auf ihn zu.
Bis sie ihm so nahe waren, dass er glaubte, sie berühren zu können.
Er konnte sich nicht satt sehen an ihnen.
Sie waren wunderschön!
Er wollte nur noch eines. Ihnen nahe sein.
Eins mit ihnen werden.
Sie nie mehr verlassen.
Er hätte schreien können vor Glück.
Und war zugleich von grenzenloser Trauer erfüllt.
Als wisse er bereits um die Einzigartigkeit dieses Augenblicks.
Nantai hatte jedes Gefühl für Raum und Zeit verloren, als die Wesen sich ein weiteres Mal veränderten, als sie zu verblassen begannen, mehr und mehr ihr Leuchten verloren.
Doch ehe sie seiner Wahrnehmung ganz entschwanden, schufen sie ein Bild für ihn. Zunächst nur ein Schemen, ein Schatten, von Nebelschwaden verdeckt, würden seine Konturen immer deutlicher.
Bis er die turmhohen Häuser mit den glänzenden Fassaden, und Tausenden von Fenstern erkannte.
Megalaia, die größte Stadt NanGaias.
Viele hundert Meilen nördlich der Waldgebiete gelegen, war sie in den vergangenen Jahrzehnten unermesslich rasch gewachsen - ohne dass jemand wusste, warum sie die Bewohner NanGaias wie ein Magnet anzog.
Denn jetzt lebten dort so viele Menschen wie nirgendwo sonst in dieser Welt.
Megalaia.
Die Stadt, die die Geschicke dieser Welt bestimmte. Die wohlhabende, und in den Augen der Waldbewohner dennoch arme Hauptstadt NanGaias.
Nantai hatte sie nie besucht – und wusste trotzdem genug, hatte genug Bilder von ihr gesehen, um sie sofort zu erkennen. Und trotz des strahlenden Glanzes löste ihr Anblick keinerlei Freude in ihm aus.
Zu deutlich war die Botschaft, die sich hinter ihrem Bild verbarg.
Die Geistwesen wollten, dass er nach Megalaia ging.
Sein Weg führte ihn am Ende also doch in die Stadt, in die er bereits vor vielen Jahren hätte gehen sollen.
Damals hatte er sich noch erfolgreich dagegen gewehrt.
Aber dieses Mal blieb ihm keine Wahl. Widersetzte er sich ihrem Willen, würde er den Zorn der Geistwesen auf sich laden.
Als er aus der Trance erwachte, war jede Freude in ihm erloschen. Alles, was er noch fühlte, war Enttäuschung.
Nun kannte er seinen Weg. Und es war nicht der, auf den er gehofft hatte … Er hatte es geahnt.
Niedergeschlagen verließ er die Kuppel und trat in den dunklen Felsengang, in dem der Älteste auf ihn wartete.
Der weise Mann bemerkte Nantais Kummer sofort. Doch er fragte nicht nach dem Grund. Seine Aufgabe war getan. Er hatte seinen Schützling auf die Begegnung mit den Geistwesen vorbereitet, und während der Trance über ihn gewacht, um einzugreifen, falls er den Kräften aus der anderen Welt nicht standhielt.
Was nun folgte, war allein für Nantai bestimmt. An ihm war es, den Weg zu beschreiten, den die Geistwesen ihm gewiesen hatten.
Denn dies war ihr Wille. So geschah es seit Menschengedenken.
„Lass uns gehen.“ Ohne auf Antwort zu warten, wandte sich der Älteste um, und schritt eilig voran, dem Ausgang zu. Und Nantai folgte ihm, stumm, und seltsam kraftlos. Fand sich irgendwann am Fuß der Treppe wieder - ohne sich an den Weg dorthin zu erinnern - und stieg hinter dem alten Mann die Steinstufen empor, ins Freie.
Draußen dämmerte es bereits. Sie waren länger in der Finsternis gewesen, als er gedacht hatte. Zudem war es empfindlich kühl geworden. So kühl, dass er nach der Wärme der Höhle plötzlich fröstelte, und dem raschen Schritt des Alten nun willig folgte.
Noch ehe das Tageslicht erlosch, erreichten sie die Siedlung, die trotz der frühen Stunde verlassen wirkte. Die Kälte hatte die Bewohner in ihre Hütten getrieben. Nur Achak und Pohawe saßen noch am Feuer und warteten auf die Rückkehr des Sohnes, voller Unruhe, weil diese sich so lange hinauszögerte.
„Endlich seid ihr zurück!“
Erleichtert sprang Pohawe auf, als sie die beiden Männer erblickte. Dann erst sah sie die bedrückte Miene ihres Sohnes.
„Ist alles, wie es sein soll?“ fragte sie besorgt.
„Das ist es“ erwiderte der Älteste an Nantais Stelle. „Nach unseren Bräuchen ist Nantai jetzt zum Manne geworden.“ Er lächelte. „Und dies ist nicht alles – denn die Geistwesen waren ihm überaus wohl gesonnen. Sie zeigten sich ihm so lange wie niemandem zuvor.“
Pohawes Blick glitt zu ihrem Sohn, der gedankenverloren in die lodernden Flammen starrte. Er hatte gar nicht zugehört.
„Trotzdem ist Nantai nicht glücklich“ murmelte sie. „Sagte er dir, welchen Weg sie ihm wiesen?“
Der alte Mann schüttelte den Kopf. „Nein, das sagte er nicht.“
Und verneinte erneut, als sie ihn bat, bei ihnen zu essen. „Ich danke dir für deine Gastfreundschaft, Pohawe“ erklärte er müde. „Aber mein alter Körper verlangt jetzt nach Ruhe, nicht nach Nahrung, und ich sollte auf seinen Ruf hören.“ Dann ging er. Mit mühsamen Schritten, die zum ersten Mal an diesem langen Tag sein hohes Alter erkennen ließen.
Sorgenvoll blickte ihm Pohawe nach, bis er im Eingang seiner Hütte verschwand. Erst dann wandte sie sich Nantai zu, der noch immer seltsam verloren am Feuer stand.
Sie füllte eine Schale mit Essen und reichte sie ihm. „Setz dich zu uns, Nantai, und teile diese Mahlzeit mit uns! Dein Vater und ich haben auf dich gewartet.“
Sie hatten dieses besondere Mahl mit ihm teilen wollen - das erste, an dem er als ihnen gleichgestellt teilnahm.
Von nun an hatten sie kein Recht mehr, Gehorsam von ihm zu verlangen. Von nun an durften sie keine Rechenschaft mehr von ihm erwarten, konnten nur darauf hoffen, dass er sie um Rat fragte, wenn er Rat brauchte …und dass er Rat brauchte, war mehr als offensichtlich.
Auch Achak war die bedrückte Stimmung des Sohnes nicht entgangen. Im Gegensatz zu Pohawe nahm er Nantais Schweigen zunächst jedoch gelassen hin, beobachtete fast amüsiert, wie sie sich um den Sohn bemühte. Trotz aller gegenteiligen Bekundungen sah sie in Nantai noch immer ihr Kind, es fiel ihr schwer, hinzunehmen, dass er schon bald für sich selbst sorgen würde… vielleicht sogar für seine eigene Familie.
Ich bin neugierig, wie sie reagiert, wenn er eine Partnerin wählt. Schließlich ist er alt genug, um den Bund einzugehen. Auch wenn es schien, als ginge Nantai zumindest in dieser Hinsicht denselben Weg wie sein Vater. Denn Achak war Mitte zwanzig gewesen, als er die damals sechzehnjährige Pohawe getroffen hatte - in einem Alter also, in dem die meisten Waldbewohner den Bund bereits eingegangen waren. Doch ihn hatte bis zu diesem Tag keines der Mädchen interessiert. Bis zu diesem Tag war auch für ihn die Geisterwelt das Zentrum seines Lebens gewesen - ebenso wie für Nantai, dessen ganzes Streben bisher der Suche nach seiner Gabe gegolten hatte. …Und dies, obwohl seine Chancen ausgesprochen gut standen, eine Partnerin zu finden. Nicht ohne Stolz hatte Achak bemerkt, wie die jungen Frauen des Stammes Nantai umgarnten, und wie sehr sie um seine Aufmerksamkeit rangen. Mit nur mäßigem Erfolg allerdings. Zwar gab sich Nantai gerne mit ihnen ab, lachte und scherzte oft mit ihnen. Doch keines der Mädchen hatte jemals sein Herz berührt. Vielleicht sollte er sich auf andere Dinge besinnen. Vielleicht würde ihm die Liebe einer Frau sogar helfen, sich seiner Gabe zu nähern. Schmunzelnd musterte er den Sohn, der mit finsterer Miene vor sich hin starrte… Allerdings wird er mit Sicherheit kein weibliches Herz erobern, wenn er so grimmig dreinblickt wie jetzt. Dieser Gedanke rief den Schamanen in die Gegenwart zurück. Nantai war heute zum Manne geworden und hatte von den Geistwesen seinen Weg erfahren. Doch anstatt sich den Eltern stolz mitzuteilen, hockte er niedergeschlagen am Feuer und löffelte stumm seine Schale leer. Und mit einem Mal drängte es Achak doch, seinen Sohn nach dem Grund seines Verhaltens zu fragen. Aber Pohawe kam ihm zuvor, wie so oft. Sie hatte nur gewartet, bis Nantai ihr die leere Schale zurückgab, um ihn auf die Botschaft der Geistwesen anzusprechen. „Ich weiß, dass ich keine Erklärungen mehr von dir verlangen darf, mein Sohn“ begann sie. „Trotzdem bitte ich dich, uns den Kummer anzuvertrauen, der dich ganz offensichtlich quält. Vielleicht wissen dein Vater und ich Rat. Vielleicht können wir helfen.“ Nantai rang mit sich. Lange Zeit. Aber dann erzählte er den Eltern von der Botschaft der Geistwesen, und dass sein Weg ihn nach Megalaia führte. Pohawe reagierte wie erwartet. „Du musst dich täuschen, Nantai!“ stammelte sie entsetzt. „Die Botschaft der Geistwesen muss etwas anderes bedeuten. Du gehörst hierher in die Wälder, zu deinem Stamm! Warum solltest du nach Megalaia gehen? Wie sollte eine Stadt, die vor langer Zeit von den Geistwesen verlassen wurde, dir bei der Suche nach deiner Gabe helfen?“ Doch zu ihrem Leidwesen blieb sie mit dieser Meinung allein. „Nein, Pohawe“ erklärte Achak entschieden, „Nantai hat Recht. Auch ich habe keinen Zweifel, dass die Geistwesen ihn nach Megalaia sandten." Empört öffnete sie den Mund, um zu widersprechen. Doch der Blick ihres Gatten erstickte die Worte, noch ehe sie ihre Lippen verließen. „Wir sollten den Willen der Geistwesen nicht noch einmal in Frage stellen“ erklärte der Schamane ernst. „Wenn sie wollen, dass Nantai in diese Stadt zieht, dann wird er es diesmal tun - und dort vielleicht endlich zu seiner Gabe finden.“ Pohawe begriff, dass sie Nantais Abreise diesmal nicht verhindern würde. Deshalb versuchte sie sich damit zu trösten, dass er nun kein Kind mehr war, dass er eine starke Seele besaß, und dass ihm das Leben in der Fremde jetzt um vieles leichter fallen würde als dem Zehnjährigen damals. Aber irgendetwas in ihr wollte nicht daran glauben. * Nantais Weg stand nun fest. Doch wie er die Zeit in Megalaia verbringen, und wovon er dort leben sollte, war ein noch ungelöstes Problem. Nicht allein, weil die Stadt kein Mitleid mit jenen kannte, die sich nicht selbst halfen, sondern auch, weil man dort, um den Zustrom zu begrenzen, für Neuankömmlinge hohe Hürden gesetzt hatte. Aber noch ehe Nantai eine Entscheidung traf, hielt der Winter Einzug in den Wäldern, viel früher als sonst, und ungewohnt heftig, mit Schneestürmen, die die Dorfbewohner tagelang von der Außenwelt abschnitten. Zum Bleiben gezwungen, nutzte er die dunklen und kalten Wochen, um nachzudenken. Er rief sich ins Gedächtnis, was er über Megalaia wusste, redete mit den wenigen, die die Stadt aus eigener Erfahrung kannten - und mit den vielen, die durch andere von ihr wussten. Horchte immer wieder in sich hinein. Was wollte er selbst? Sollte er sich wie fast alle Waldbewohner, die sich zuvor in die Stadt gewagt hatten, als Handwerker oder als Bauarbeiter verdingen? Oder sollte er einen anderen Weg beschreiten? Sich auf etwas einlassen, das kaum einer vor ihm getan hatte? Sollte er ein Studium beginnen? Den Kopf dazu besaß er zweifellos. Aber seine Seele? Würde sie dieser Belastung standhalten? Immer wieder wog er beide Möglichkeiten ab, entschied sich mal für die eine, mal für die andere. Doch nur, um sie wieder zu verwerfen - und wenig später erneut zu bedenken. Viele Nächte lang lag er wach, und lauschte dem Wüten der Elemente draußen, während seine Gedanken sich unablässig um diese Frage drehten. Bis er sich, mit dem Ende des Winters, endlich entschied. Er würde studieren, und dafür ein Stipendium nutzen, mit dem die Regierung versuchte, die jungen Waldbewohner in die Stadt zu locken - ohne Erfolg bisher. Die wenigen, die das Angebot vor ihm genutzt hatten, waren allesamt gescheitert und hatten Megalaia lange vor dem Abschluss den Rücken gekehrt. Aber das störte ihn nicht. Er hatte ohnehin nicht vor, lange zu bleiben. Er wollte seinem Aufenthalt durch das Studium lediglich einen Sinn verleihen. Und die Stadt wieder verlassen, sobald seine Gabe erwachte.
Читать дальше