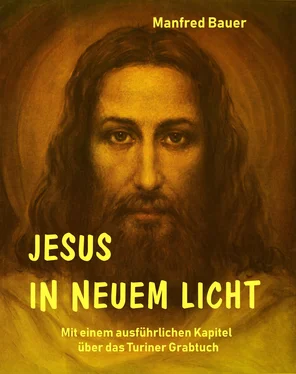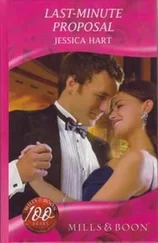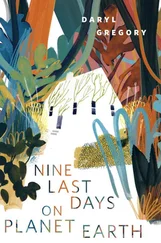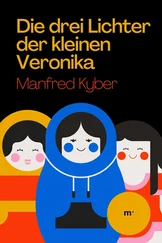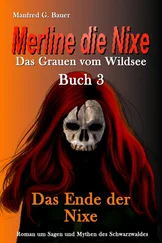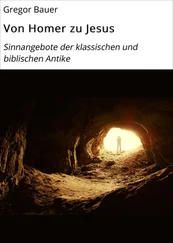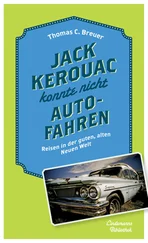Es gab auch noch eine andere Gruppe von Essenern, die in Lebensart, Sitte und Gesetzgebung mit der ersteren übereinstimmte, jedoch heiraten und ein Familienleben führen durfte. 27
Zwischen 1947 und 1956 wurden in Felshöhlen nahe der Ruinenstätte Qumram eine große Anzahl von Schriftrollen aus dem antiken Judentum entdeckt, die zwischen 250 v. Chr. und 40 n. Chr. gefertigt wurden. Soweit sie noch intakt sind, geben sie größtenteils Texte der jüdischen Schriften wieder. Eine Textgruppe betrifft Regeln und Organisation, Lehre und Alltagsleben einer jüdischen Gemeinschaft, darunter ein sogenannter Sektenkanon, ein Regelbuch, eine Kriegsrolle, Verträge und Aufzeichnungen über Geschäfte. Ferner gehören gottesdienstliche Texte in diese Gruppe.
Man nahm lange an, Qumram, das 70 n. Chr. von den Römern zerstört wurde, wäre ein Zentrum der Essener gewesen und diese Texte würden von ihnen stammen. Neuerdings kamen an dieser Theorie jedoch Zweifel auf, da viele Artefakte der Ausgrabungen von Qumram nicht zu der essenischen Lebensweise passen. Allein die Schriftrollen seien von etwa 500 verschiedenen Schreibern gefertigt worden. Hierfür gab es aber nicht genug Wohnunterkünfte. Auch wurden keine Materialien, die zur Herstellung der Schriftrollen benötigt gewesen wären, gefunden.
In keiner der etwa 970 Schriften fand man Hinweise auf Esseni oder Essaioi oder Begriffe, die sich von einem dieser Wortstämme ableiten lassen. Für Askese und Zölibat fanden sich dort ebensowenig Belege wie für einen Unsterblichkeitsglauben.
Gegen die Annahme eines Essenerklosters spricht auch die Lage Qumrams zur damaligen Zeit. Es war keine abgelegene Siedlung, wie sie die Essener bevorzugten, sondern lag an einem belebten Verkehrsknotenpunkt und war wirtschaftlich mit benachbarten Orten verbunden.
Viele Historiker sind daher mittlerweile der Meinung, die Schriften hätten unter anderem aus der Tempelbibliothek von Jerusalem gestammt und seien im Jahre 70 n. Chr. vor den Römern in Sicherheit gebracht worden.
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Zustände
Das wirtschaftliche Rückgrat Israels war jahrhundertelang von kleinbäuerlicher Landwirtschaft und Fischerei bestimmt. Nach der Eroberung Jerusalems durch die Römer im Jahre 63 v. Chr. verschlechterte sich aber deren Lage. Sie mussten nun zusätzlich zum Zehnten an die Tempelpriesterschaft auch noch Steuern an den römischen Kaiser bezahlen. Dies konnte, vor allem in Zeiten schlechter Ernten, die Ablieferung bis zur Hälfte des Ertrages bedeuten. Viele Bauern mussten sich bei den Großgrundbesitzern oder der Priesterschaft verschulden. Aufgrund eines Verbotes in der Schrift durften Juden zwar von Ihresgleichen keine Zinsen nehmen; war der Schuldner jedoch in Verzug, wurden kräftige Strafzahlungen erhoben, die die fehlenden Zinsen bei weitem aufwogen. So fiel sein Land oft an den Gläubiger, der es seinerseits von Verwaltern und Tagelöhnern bearbeiten ließ.
(Von den Fremden magst du Zinsen nehmen, aber nicht von deinem Bruder… . 29).
War der ehemals selbstständige Landwirt noch zusätzlich einem Beruf nachgegangen, hatte er durch die rege Bautätigkeit, die mit den Römern und vor allem mit Herodes einsetzte, die Möglichkeit, seine Existenz und die seiner Familie zu sichern. Andernfalls blieb ihm nur der Gang in die Armut als Tagelöhner. Nach Herodes' Tod kam jedoch die Bautätigkeit zum Erliegen, so dass auch diese Erwerbsmöglichkeiten verloren gingen. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis die Not dieser Unzufriedenen und Leidenden in einen Aufstand münden würde.
Herodes konnte das Volk bis zu seinem Tode 4 v. Chr. durch seine konsequent despotische Politik klein halten. Was aber war mit seinen Nachfolgern? Konnten sie den Druck in diesem brodelnden Kessel niederhalten?
Schon kurze Zeit nach der Eroberung Jerusalems durch die Römer (63 v. Chr.) bildeten sich nationalistische Widerstandsbewegungen gegen die römische Besatzungsmacht. Für das Volk waren diese Banden aus religiösen Eiferern, Bauern und Tagelöhnern Werkzeuge der göttlichen Gerechtigkeit gegenüber den Eroberern und deren jüdischen Kollaborateuren.
In seiner Not und Abscheu gegen die Fremdherrschaft klammerte sich das Volk an die Weissagungen der Schrift, die einen Messias vorhersagte, der das Reich Gottes errichten würde, in dem alle Feinde vernichtet und alle Not behoben wäre. Ein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens. Auch wurde die Erinnerung an vergangene machtvolle Könige wie David beschworen, die die Feinde der Nation in die Flucht geschlagen hatten.
Diese Vorstellungen spukten in den Köpfen der Aufständischen. Sie verkündeten ihren jeweiligen Anführer als König Israels oder Messias, der das Gottesreich auf Erden wiederherstellen würde. Dies war jedoch gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung an Rom.
Unter einem von ihnen, dem charismatischen Anführer Hiskia, der sich als Messias ausrufen ließ, sammelten sich sowohl die in der Gesellschaft zu kurz gekommenen, als auch Söhne reicher Familien aus Jerusalem. Sie entfachten von Galiläa aus einen Guerillakrieg, überfielen römische Einrichtungen und raubten die Reichen aus. Aber der junge Herodes – erst etwa 15 Jahre alt – bekämpfte sie erfolgreich und ließ Hiskia und seine überlebenden Anhänger hinrichten. Fortan war unter seiner Herrschaft an Aufstand nicht mehr zu denken.
Als nun die Frage der Nachfolge nach Herodes' Tod anstand, teilte Kaiser Augustus das Herrschaftsgebiet unter dessen drei Söhnen auf: Judäa, Samaria und Idumäa wurden Archelaos übertragen. Herodes Antipas erhielt Galiläa und Peräa, während Philippos Gaulanitis (heutige Golanhöhen) und die Gebiete nordöstlich des Sees Genezareth regierte. Den Königstitel erhielten sie jedoch nicht. Herodes Antipas und Philippos wurden Tetrarchen (Herrscher eines Viertels); Archelaos wurde Ethnarch (Herrscher eines Volkes).
Diese Aufteilung erwies sich als ein katastrophaler Fehler der römischen Besatzungsmacht. Religiös motivierter Hass auf die „gottlosen“ Unterdrücker und deren jüdische Handlanger sowie Verbitterung über die eigene aussichtslose wirtschaftliche Lage, während die weltliche Oberschicht wie auch die Tempelpriesterschaft ein Leben in Luxus führte, mündete nun in eine Flut von Aufständen und gewaltsamen Protesten.
Zunächst gab sich Archelaos als neuer Herrscher in Jerusalem milde und leutselig und wurde daher vom Volk nach der harten Herrschaft des Herodes begeistert begrüßt. Sofort wurden Wünsche an ihn herangetragen wie Abschaffung von Steuern, Freilassung von Gefangenen und Bestrafung von Günstlingen des Herodes. Als Archelaos sie in dem Glauben ließ, ihre Forderungen würden erfüllt, sie jedoch auf später vertröstete, kam derartiger Unmut gegen ihn auf, dass er mit einem Aufstand rechnen musste. Er schickte daher eine Abteilung Soldaten in den Tempel.
„Gegen diese Soldaten aber hetzten die am Aufruhr beteiligten Gesetzeslehrer das Volk durch lärmende Zurufe auf, so dass es schließlich zum förmlichen Angriff des Volkes auf die Kriegsleute kam, die umzingelt und größtenteils mit Steinen zu Tode geworfen wurden, … . " 30
Archelaos bot nun seine ganze Streitmacht auf, diesen Aufstand niederzuwerfen. „Auf diese Weise wurden gegen 3000 der Empörer von der Reiterei zusammengehauen, während der Rest sich auf die nahe gelegenen Berge zurückzog." 31
In der Folgezeit wurde Archelaos durch seinen launischen und grausamen Regierungsstil immer verhasster, so dass ihn Juden und Samaritaner deswegen bei Kaiser Augustus verklagten. Er wurde daraufhin seines Amtes enthoben und nach Gallien verbannt. Römische Präfekten verwalteten danach sein Herrschaftsgebiet. Zwanzig Jahre später hieß der amtierende Präfekt Pontius Pilatus.
Während Archelaos sich in Rom vor Augustus verteidigte, vertrat ihn der Römer Sabinus in Jerusalem. Seine Habsucht und das momentane Machtvakuum waren der Auslöser für den Aufstand einer ungeheuren Menschenmenge aus Judäa, Galiläa, Idumäa, Jericho und Peräa, wie Josephus schreibt. Sie kesselten zunächst die römischen Soldaten in Jerusalem ein, wonach diese zurückschlugen und Teile des Tempels, in dem sich die Aufständischen verschanzt hatten, in Brand setzten. Für die Soldaten war dies eine günstige Gelegenheit, den Tempelschatz zu plündern, was die Erbitterung des Volkes auf den Höhepunkt trieb.
Читать дальше