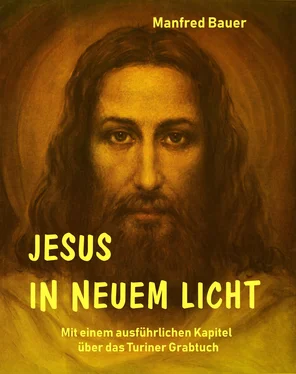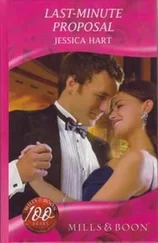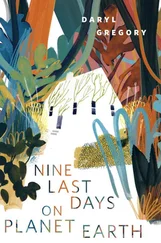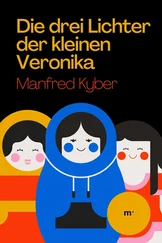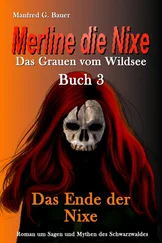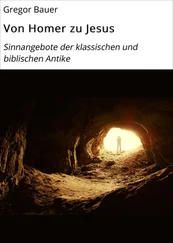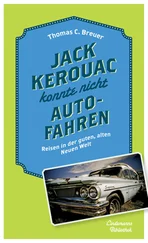1 ...7 8 9 11 12 13 ...28 Allerdings bleibt ihm nichts anderes übrig, als an diesem „kirchlichen Jesus“ festzuhalten, da er bei Leugnung eines Dogmas, beispielsweise der Gottessohnschaft oder der Jungfrauengeburt, sich als Papst außerhalb der Lehre der Kirche gestellt hätte und sich selbst hätte exkommunizieren müssen. Vielleicht sollte man als Papst wegen dieser zwangsweisen Voreingenommenheit besser kein exegetisches Buch über Jesus schreiben.
Trotz dieser unterschiedlichen, von der jeweiligen Weltanschauung abhängigen Forschungsergebnissen, bemüht sich die Bibelwissenschaft den Menschen Jesus im Kontext mit der politischen und weltanschaulichen Situation seiner Zeit zu verstehen. Dies ist eine ihrer Hauptaufgaben. Zu lange wurde er vornehmlich aus der abendländischen Perspektive betrachtet wie ihn beispielsweise manche Bilder mit heller Haut, blauen Augen und blonden Haaren zeigen. Gegenüber dem Attribut Gottes Sohn zu sein, trat sein Menschsein in den Hintergrund.
Die Exegese kämpft aber mit fast unlösbaren Problemen. Wie schon erwähnt, hatten die Evangelisten Jesus nie kennen gelernt und lebten zudem außerhalb Palästinas im griechischen Kulturbereich. Sie schrieben lange nach Jesu Tod Überlieferungen auf, die ursprünglich in Aramäisch, der Sprache Jesu, mündlich weitergegeben worden waren und übertrugen diese ins Griechische.
Bereits hierbei ergaben sich Fehler, durch mangelnde Kenntnis der jüdischen Sitten, fehlende Ortskenntnis und falsche Übersetzung. Wurden diese Urschriften vervielfältigt, machten die Kopisten manchmal Fehler oder fügten Worte oder Sätze nach eigenem Gutdünken oder aufgrund von „political correctness“ ein. Aus diesen Gründen arbeitet man in der Exegese des Neuen Testaments in erster Linie mit Wahrscheinlichkeiten und selten mit Sicherheiten.
Der jüdische Bibelwissenschaftler Pinchas Lapide schreibt:
„Das damalige Judentum beruhte weitgehend auf einer Gedächtniskultur, die von Rabbinenenjüngern ein hervorragendes Gedächtnis erwartete, so dass sie wie Zisternen werden, welche nicht einen einzigen Tropfen Wasser verlieren. (…). ,Mein Sohn, sei vorsichtig bei den Worten der Schriftgelehrten‘, so hieß eine Grundregel der Toraschulen, ,denn wer sie übertritt, ist des Todes schuldig‘ (…). Und: ,Jeder, der die Worte der Meister verunehrt (d.h.: falsch zitiert oder sich Freiheiten in der Überlieferung nimmt), wird in der kommenden Welt in siedendem Kot bestraft...‘.“ Und weiter: „Die rund Viertelmillion von Lesarten und Textvarianten in den Handschriften der griechischen Evangelien hingegen … spricht für eine viel freiere Handhabung kirchlicher Urkunden durch spätere Heidenchristen." 17
Exegeten suchen daher seit Jahrhunderten nach dem „Urevangelium“, den tatsächlichen Worten und Taten Jesu. Allerdings bislang mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen.
Die Freilegung der Person Jesu, allein aufgrund der Erforschung der Schriften, birgt die Gefahr in sich, dass letztlich ein „Papier–Jesus“ entsteht, gebildet nach den Vorstellungen des jeweiligen Exegeten.
Für einen Atheisten, für den es keine übernatürlichen Ereignisse gibt, sind zum Beispiel die Heilungswunder Mythen, die von den Evangelisten erfunden wurden, weil auch in antiken Mythen die Rede von Wundertätern ist. Aussprüche oder Handlungen Jesu können oft als Kopien aus den jüdischen Schriften betrachtet werden, um darzulegen, dass „die Schrift erfüllt werde".
Einzelne Exegeten machten aus Jesus ein Kunstprodukt, zusammengesetzt aus griechischen und ägyptischen Mythen. Vor allem aus dem seit dem 1. Jahrhundert n. Chr. im Römischen Reich sehr populären Mithraskult ist offenbar einiges von dessen Kultpraxis in das Christentum eingeflossen.
Andere wie zum Beispiel Rudolf Bultmann sind der Meinung, dass es sich verbietet, den Glauben oder die inneren Seelenzustände Jesu des Gottessohnes zu ergründen. Augstein zerlegt in seinem Buch: Jesus Menschensohn, die Evangelien derart, dass von Jesus nur noch ein „Abziehbild" übrig bleibt.
Papst Benedikt schreibt hierzu: „Diese Zerschneidung der Menschensohn–Worte entspringt einer Logik, die fein säuberlich die verschiedenen Aspekte eines Prädikats verteilt und dem strengen Modell professoralen Denkens entspricht, aber nicht der Vielfalt des Lebendigen... . Der grundlegende Maßstab für diesen Auslegungstypus beruht aber auf der Frage, was man eigentlich Jesus in seinen Lebensumständen und in seiner Bildungswelt zutrauen könne. Offenbar sehr wenig! Wirkliche Hoheitsaussagen und Passionsaussagen passen für ihn nicht. Eine Art gemilderter apokalyptischer Erwartung wie sie damals umging, kann man ihm ,zutrauen‘– mehr anscheinend nicht. Aber so wird man der Gewalt des Jesus–Ereignisses nicht gerecht. (…). Der anonymen Gemeinde wird eine erstaunliche theologische Genialität zugetraut: Wer waren eigentlich die großen Gestalten die solches erfanden? Nein, das Große, das Neue und Erregende kommt gerade von Jesus; im Glauben und Leben der Gemeinde wird es entfaltet, aber nicht geschaffen. Ja, die ,Gemeinde‘ hätte sich gar nicht erst gebildet und überlebt, wenn ihr nicht eine außerordentliche Wirklichkeit vorausgegangen wäre." 18
Ich denke, diese Einschätzung hat Hand und Fuß. Die Apostel und andere Jünger waren so sehr von der Person Jesu sowie seinen Taten beeindruckt, dass sie ihre Überzeugung unter Lebensgefahr lebten und weitergaben.
Viele von ihnen büßten dies mit einem qualvollen Tod. Wie wäre dies erklärbar, wenn Jesus nur ein normaler Wanderprediger oder politischer Revolutionär gewesen wäre? Deren gaben es im Judentum viele, aber keinen, nach dessen Tod sich eine beständige Glaubensbewegung gebildet hätte.
Allerdings werden wir im weiteren Verlauf des Buches noch sehen, mit welcher Unbekümmertheit Evangelisten oder Kopisten der neutestamentlichen Schriften Jesus ihre eigenen theologischen Vorstellungen in den Mund legten. Nicht der eigenen Theologie entsprechende Aussagen wurden weggelassen oder umformuliert. David Friedrich Strauß schreibt bereits im 19. Jahrhundert:
„ ‚Bei jedem Schritt‘, sagt Schwegler treffend, ‚den das theologische Bewusstsein vorwärts tat, wurde auch an den Evangelien nachkorrigiert, Veraltetes und Anstößiges ausgemerzt, Zeitgemäßes zugesetzt, mitunter selbst manches Schlagwort der neueren Zeit eingeschaltet, und so sehen wir die Kirche in einer fortwährenden Produktion evangelischer Reden und Sprüche begriffen, bis diese Evangelienreform mit der ausschließlichen Anerkennung unserer synoptischen Evangelien und der Verfestigung der katholischen Kirche ihre Endschaft erreichte.‘ “ 19
Die meisten Exegeten legen mit viel kriminalistischem Gespür dar, was Jesus nicht getan und gelehrt hat. Sein Wesen, seine Lehre und seine Taten bleiben dabei jedoch im Unklaren.
Was damals wirklich geschah und was Jesus in Einzelnen lehrte ist zwar nicht mehr mit Sicherheit festzustellen. Wir können jedoch aus den Schriften sowie dem Leben und der Überlieferung der ersten Christen Rückschlüsse ziehen, die uns einen Überblick über Leben und Lehre Jesu vermitteln. Mit etwas kriminalistischem Gespür und spirituellem Einfühlungsvermögen werden wir sodann versuchen, ein Bild des wirklichen historischen Jesus zu erhalten.
Wichtig ist, beim Lesen der Evangelien zu beachten, dass Matthäus, Lukas und Johannes nach der Zerstörung Jerusalems durch die Römer im Jahre 70 schrieben. Die christlich–jüdische Urgemeinde, soweit sie überlebt hatte, war in andere Gebiete des römischen Reiches geflüchtet. Als Ansprechpartner hatten sie nun statt palästinensischer Juden solche, die hellenisiert waren sowie Griechen, Römer und andere Völker.
Um Jesus für Nichtjuden verständlich und annehmbar zu machen, mussten die Evangelisten die jüdische Identität Jesu möglichst in den Hintergrund treten lassen. Die Evangelien wurden quasi für das neue Zielpublikum homogenisiert.
Читать дальше