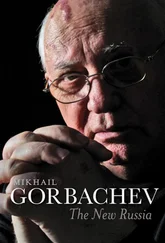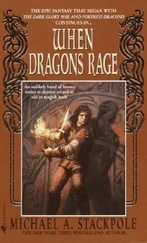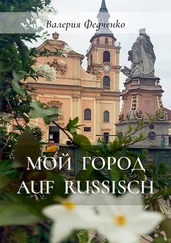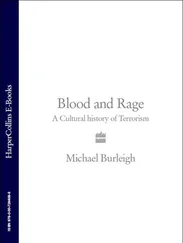Morosow unterbrach ihn: „Ich weiß nicht, wer dich bestohlen hat, ich weiß auch nicht, wer dir das Wasser abgraben will. Das Wohl der Allgemeinheit, das dir schlaflose Nächte bereitet, da weiß ich sehr wohl, dass du vor Wochen zwei Millionen Dollar außer Landes geschafft hast. Eine hübsche Summe, die hätten die Arbeiter in deinem Betrieb gern als Investition gesehen. Also, erzähle mir nichts von Dingen, die mit dir nichts zu tun haben.“
„Was ich gemacht habe, war kein illegaler Transfer“, sagte Volkov.
„Hast du die Summe versteuert? Hast du? Du hast natürlich nicht“, erwiderte Morosow.
„Was glaubst du denn, wie Teile der staatlichen Betriebe privatisiert worden sind“, meinte Volkov.“ Es gibt mehr Milliadäre in Russland, als vergleichsweise im hochkapitalistischen Amerika. Wie ist das möglich, Genosse Oberst?“, fragte Volkov und er merkte, wie die nackte Wut ihn beherrschte.
„Hier geht es nicht um mein Vermögen, hier geht es eindeutig darum, mich aus dem Geschäft zu drängen.“
Nun war Morosow der Meinung, Klartext reden zu müssen.
„Niemand will dir Schwierigkeiten machen. Das Ministerium will die Staatsbahn in eine Aktiengesellschaft umwandeln. Das geht natürlich nur, wenn alles vorhanden ist, was zur Bahn gehört.“
„Hat man das nicht früher gewusst?“, polterte Volkov.
„Nikolai, wer kann in diesen unsicheren Zeiten vorher sagen, was in einem halben Jahr geschieht“, sagte Morosow in versöhnlichem Ton. Er ging zum Schrank, holte eine Kiste kubanischer Zigarren und bot Volkov eine an. Sie qualmten still vor sich hin, der Dampf verteilte sich an der Zimmerdecke.
„Ich mach dir einen praktikablen Vorschlag. Du verkaufst deinen Besitz an die Staatsbahn und mit dem Erlös baust du dir etwas Neues auf.“
„Das ist ja alles so einfach“, erwiderte Volkov mit spöttischem Unterton. „Was ist mit der Belegschaft?“, fragte er weiter.
„Da kann ich dich beruhigen, die Leute werden übernommen,“ sagte Morosow und war bemüht, die Asche der Zigarre im Aschenbecher sicher unterzubringen.
Die alte Wirtschafterin hatte Feierabend und ging nach Hause. Volkov überlegte krampfhaft, wie er ohne großen Schaden aus der Sache heraus kommen könnte. Es war ihm klar, dass Widerstand nichts brachte. Einen Kampf gegen den FSB, den zukünftigen Bossen der Staatsbahn, konnte er nur verlieren. Die Justiz war nicht weniger korrupt, als die Gesellschaft. Er konnte niemandem trauen, schon gar nicht in diesen Zeiten. Volkov kannte die verschlungenen Pfade der Bürokratie, diesen Dschungel. Ohne Federn zu lassen, kam er da nicht durch. Ob es jemals Rechtssicherheit geben würde, wusste nur Gott und der hatte sich in diesem Land nicht mit Ruhm bekleckert.
Volkov wusste, wollte er weiter im Überfluss leben, musste er andere Wege gehen.
„Meine redlich erworbenen Fahrzeuge kann ich wohl abschreiben“, sagte Volkov und er schaute böse und misstrauisch zu Morosow. Der saß unbeeindruckt in seinem Ohrensessel, paffte genüsslich an seiner Zigarre und bestätigte durch Kopfnicken Volkovs Frage. Der erhob sich, er wollte mit diesem Menschen nicht unnötige Zeit verbringen. Jahrzehntelange, geheime, brutale Polizeiarbeit machte aus jedem Menschen einen charakterlosen Kotzbrocken.
Morosow blieb sitzen. Warum sollte er diesen Volkov zur Tür bringen? Betrübt schaute er auf den Rest der teuren Havanna, die im Aschenbecher kalt wurde. Er griff zum Telefon, besprach sich mit einigen Leuten aus dem Herrenclub und alle waren zufrieden.
Volkov fuhr nach Hause. Er fühlte sich leer und ausgebrannt. Als er in seinem Garten stand, fragte er sich, wie lange er und seine Familie das schöne Anwesen wohl noch ihr eigen nennen durften. Sie werden mich fertig machen und wenn ich nicht aufpasse, lande ich in einem Straflager, irgendwo in der Weite Russlands, dachte er, als er das Haus betrat.
14.
Wasil Saizew saß wie so oft am Fenster der Plattenbauwohnung und sah lustlos zu den verkommenen Fabrikhallen, die mal sein Arbeitsplatz waren. Das mit dicken Eisenketten verschlossene Tor verpasste dem Objekt ein trostloses Bild. Wasils Situation hatte sich nicht verändert. Er war immer noch arbeitslos, lebte von Gelegenheitsarbeiten und lag seiner Mutter auf der Tasche. Oft fragte er sich, wie machen andere junge Männer das, so ganz ohne Perspektive leben? Nie hätte er gedacht, dass der Zusammenbruch ein derartiges Chaos schaffen würde. Es gab nie Überfluss, aber die Versorgung mit dem Notwendigsten wurde garantiert.
Es klopfte, seine Mutter wollte ihn zum Abendbrot holen. Sie war alt geworden, ihre Gesundheit hatte sie in einer Großwäscherei gelassen und war mit ein paar Rubeln Rente abgespeist worden. Die tägliche Hausarbeit fiel ihr sehr schwer, sie bekam oft schmerzhafte Gichtanfälle. Die Medikamente, die sie brauchte, musste sie selbst bezahlen, eine kostenlose Versorgung gab es nicht mehr. Während des Essens schellte es an der Tür. Wasil öffnete, Lew Rabitschew war gekommen. Sie gingen in die Küche und Lew grüsste mit einer leichten Verbeugung die Mutter seines Freundes. Frau Saizew lächelte, sie mochte Lew, er war immer freundlich und nett. Er war schon als Kind öfter Dauergast bei den Saizews. Mit Wehmut dachte sie an die Zeit, als die jungen Männer noch Kinder waren.
Rabitschew war nervös, er hatte etwas mitzuteilen, was er für sehr wichtig hielt. Beide gingen in Wasils Zimmer.
„Wasil, was hältst du von einer Arbeit, die wenig Aufwand verlangt und doch sehr gut bezahlt wird?“
Lew war so aufgeregt, dass er in seiner Euphorie den Freund am liebsten umarmt hätte.
„Ich habe dir doch von Grigori Moskwin erzählt, der Typ, der gute Beziehungen zu einflussreichen Leuten hat. Du erinnerst dich?“
Lew sah ungeduldig zu Wasil und wartete, dass der sich an diesen Moskwin erinnerte.
„Ja, ja ich weiß, von wem du sprichst“, sagte Saizew, er war lange nicht so begeistert von diesem Moskwin.
„Lew, was du mir von dem erzählt hast, hat mich nicht überzeugt. Ich sage dir, wenig Arbeit, die mit viel Geld bezahlt wird, da ist was faul. Es wird Zeit, dass du konkreter wirst.“
„Der Grigori hat noch nichts Konkretes gesagt, er möchte dich und Nina näher kennenlernen und wenn ihr seinen Vorstellungen entsprecht, so würde er über Zukünftiges mit uns reden.“
„Mein Gott, was ist das bloß für ein großer Menschenfreund“, sagte Saizew mit spöttisch ironischem Unterton. „Ich überlege mir das noch“, fügte er hinzu.
„Wasil, du hast keine Zeit zur Überlegung, Moskwin will sich morgen in dem neuen Café an der Kirche mit uns treffen. Wir hören uns an, was er zu sagen hat, dann kann jeder selbst entscheiden, was er machen will.“
„Nun gut, wir werden sehen, was der anzubieten hat“, sagte Saizew.
Er wusste, seine Lage war nicht gut und mit Anständigkeit konnte er sich nichts kaufen.
„Hast du kein Auto mehr?“, fragte er Lew.
Der schüttelte den Kopf und meinte: „Wir fahren mit dem Bus.“
Er blieb noch eine Weile. Sie wollten sich bei Rabitschew treffen, um gemeinsam zum Treffpunkt zu fahren.
Es war spät geworden. Wasils Mutter war schon zu Bett gegangen und Wasil lag noch lange wach und ließ die letzten Jahre Revue passieren.
Den Tod seines Vaters, die fragwürdige Zukunft seiner Mutter, die immer eine tatkräftige Sowjetbürgerin gewesen war und nun alt und krank, ein kümmerliches Dasein fristete. Er, als Sohn, konnte ihr nicht zur Seite stehen, weil ihm die Beine zum Gehen fehlten. Wasil wusste, er musste etwas tun, er musste diese unerträgliche Lebenssituation ändern, sie verbessern. Als Kind wollte er, wenn er so groß wäre wie der Papa, seiner Mutter einen Urlaub auf der Krim schenken. Sie träumte von dieser schönen Insel, doch es hatte nie gereicht und die verbilligten Inselurlaube von der Großwäscherei, waren über die Gewerkschaft meist schon vergeben. Sie hatten sich oft gefragt, ob es bei der Vergabe immer mit rechten Dingen zuging. Dem braven Arbeiter seine rote Fahne, seine Parolen, sein Wodka, dass musste reichen, dachte Wasil und stellte verbittert fest, dass ihm selbst das nicht geblieben war.
Читать дальше